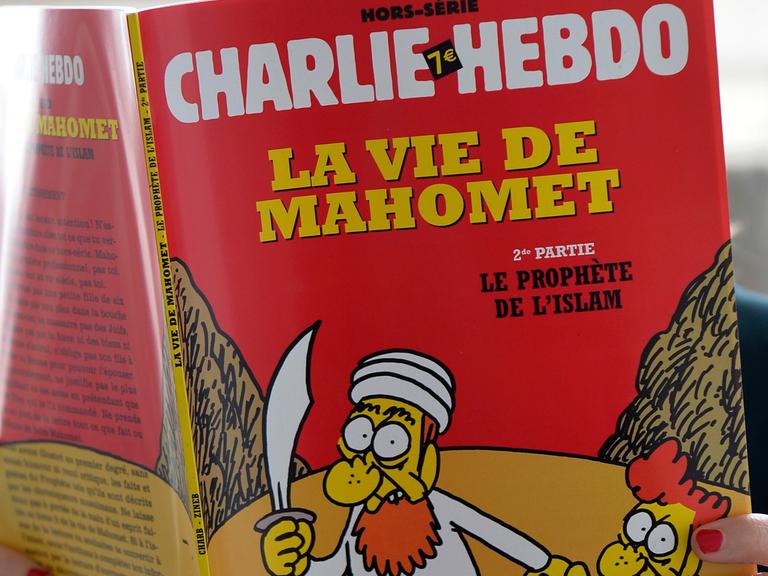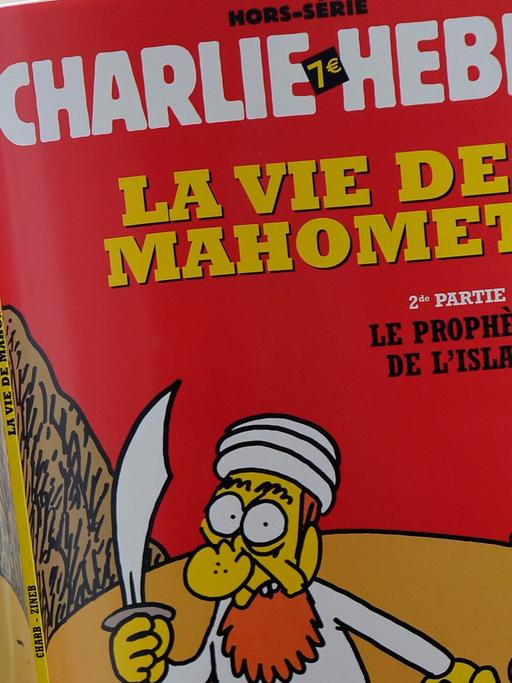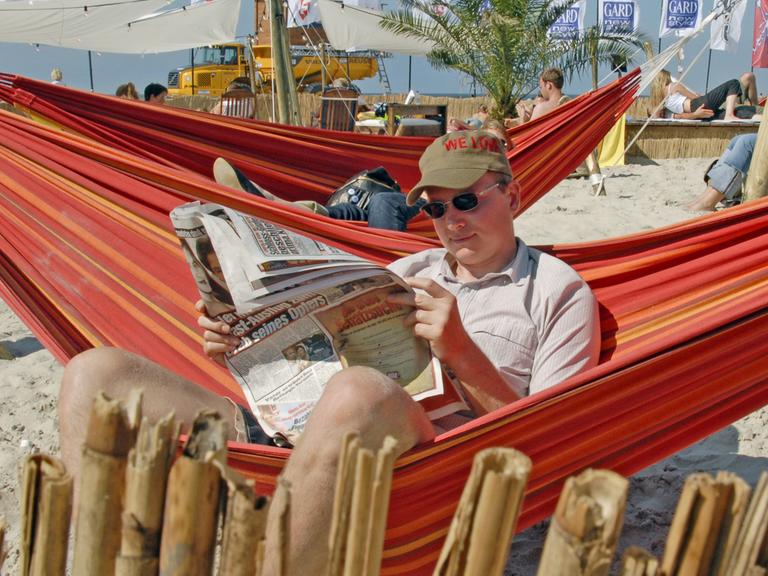Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schreiben

"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen", verfügte der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Die Schriftstellerin Ulla Lenze (Die endlose Stadt, 2015) nutzt in ihrem Wochenkommentar die Gelegenheit, ihm zu widersprechen.
Philosophie und Literatur haben ein enges Verhältnis: Beide bestehen aus Sprache. Oft teilen sie auch dieselben Fragen, und gelegentlich machen sie sogar Anleihen beieinander – es gibt philosophische Passagen in berühmten Romanen, und es gibt metaphernreiche und dramaturgiebewusste philosophische Texte. Von literarischen Philosophen ist die Rede und von philosophischen Literaten. Der Konstruktivismus geht sogar so weit, alle Texte als Literatur lesen zu wollen.
Doch gibt es bei aller Durchmischung Unterschiede, die sich nicht einebnen lassen. Bittet man zum Beispiel eine Schriftstellerin, ihren Roman zusammenzufassen oder auch nur das Thema anzugeben, wird sie vermutlich mit Unbehagen, wenn nicht gar Unwillen reagieren. Denn Schriftsteller wissen, dass ihr Werk nur in der mit sich identischen Form zu haben ist: Kürzer oder auch nur anders lässt sich eben nicht sagen, was sich oft über mehrere hundert Seiten entfaltet. Die literarische Sprache ist mehr als nur Transportmittel für einen bereits feststehenden Sinn oder für eine Geschichte, die unabhängig vom Sprachkunstwerk existierte.
Ein philosophischer Text hingegen verzichtet auf ästhetischen Mehrwert
Sie ist die Sache selbst. Alles, was in der philosophischen Sprache meist nur Zusatz ist und nicht sinngebend – der Klang, der Rhythmus, poetische Momente, Anschaulichkeit durch Metaphorik – ermöglicht eine Erfahrung, die sich jenseits des referierbaren Sinns abspielt.
Die Literatur konstituiert in jedem Moment das, was sie erzählt, als Gesamtheit von Inhalt und Klang in sinnlicher Evokation. Der Philosoph Alexander Gottlieb Baumgarten, der im 18. Jahrhundert die Ästhetik als philosophische Disziplin begründete, propagierte diese sinnliche Erkenntnis, die cognitio sensitiva, als unverzichtbare (und seriöse) Form der Erkenntnis – neben der rationalen.
Ein philosophischer Text hingegen braucht diesen ästhetischen Mehrwert nicht. Im Gegenteil: Zu viel Schönheit und Stilwillen führt schnell zu dem Verdacht, dies gehe auf Kosten diskursiver Strenge, intersubjektiver Überprüfbarkeit, kurz: der Wissenschaftlichkeit. Darum duldet die philosophische Sprache durchaus ein refererierendes Zusammenfassen ihrer Thesen, steht sie doch im Dienst eines als unabhängig von ihr angenommenen Inhalts. Sie nimmt sich nicht wichtig – zumindest nicht in jenem totalen, weltschaffenden Sinn wie die literarische Sprache.
Der literarische Text wiederum geht über das Diskursive und Verständnisorientierte hinaus. "Kunst argumentiert nicht", sagte Ingeborg Bachmann.
Die Philosophie bewegt sich immer wieder auf die eigene Grenze zu
Doch bewegt sich gerade die Philosophie in ihrem Tun auch immer wieder selbstgefährdend auf die eigene Grenze zu. So folgte auf die Epoche der großen, durchkonstruierten Systementwürfe des Deutschen Idealismus das Interesse am Nicht-Begrifflichen und Unverfügbaren. Aber wenn die Philosophie die Begriffe hinterfragt, tut sie es wiederum mit Begriffen – sie kann ihr eigenes Terrain nicht verlassen, ohne sich aufzugeben. "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen", verfügte der Philosoph Wittgenstein.
Vielleicht aber gilt das gemeinsame Interesse von Literatur und Philosophie gerade diesem Jenseits, dem, was sich genau hinter der Grenze des eigenen Mediums befindet. Und dem Versuch, sie zu verrücken und auf das Andere (stets Unverfügbare) hin zu öffnen - ein gewaltiger, immer wieder neuer Prozess.
Während nun die Philosophie diese Begrenztheit ihres eigenen Mediums in einer meist intakten, rational codierten Sprachgestalt zu möglichst sachadäquatem Ausdruck bringt, will es der Schriftsteller anders: Er versucht, in seinen Sätzen gerade dem Nichtsagbaren – und doch Existenten – einen Ort zu geben: indem sich im Idealfall von den Worten etwas ablöst wie von einem Sprungbrett und im Leser ein eigenes Leben beginnt. Wie das im Einzelnen geschieht, lässt sich so wenig erklären wie voraussagen. Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller nennt dieses Nichtformulierte, das den "Irrlauf im Kopf" möglich macht, den "poetischen Schock, den man als Denken ohne Worte gelten lassen muss".
Und so könnte der Schriftsteller (aber vielleicht nicht der Philosoph) Wittgenstein entgegenhalten: Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man – schreiben.