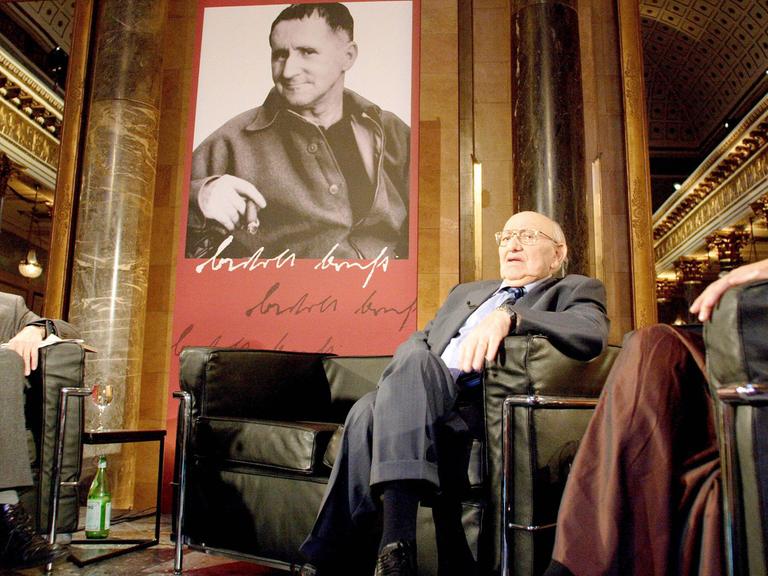Der Kritiker verlässt den Richterstuhl

Ist die Literaturkritik dadurch bedroht, dass es immer weniger klassische Rezensionen gibt? Nein, meint "Lesart"-Redakteur Thorsten Jantschek. Dieser Strukturwandel in der literarischen Öffentlichkeit führe aber weg von der Deutungshoheit einzelner Kritiker.
Seit kurzem steht wieder einmal die Literaturkritik als solche im Zentrum einer kleinen Debatte, die auf der Internetseite "Perlentaucher" geführt wird. Und zwar in Reaktion auf einen Text des Feuilletonisten Wolfram Schütte, der eine Verdrängung der klassischen Literaturrezension aus den Feuilletons der großen Zeitungen diagnostiziert und deshalb die Neugründung einer literarischen Zeitschrift im Internet unter dem Titel "Fahrenheit 451" vorschlägt. Ein Vorschlag, den mittlerweile eine Reihe von Kritikern, Bloggern und Verleger kommentiert haben.
Hören Sie hier (Audio) das Streitgespräch zur Frage "Nur noch im Netz? Brauchen wir neue Foren für die Literaturkritik?" zwischen der Autorin Sieglinde Geisel und "Lesart"-Redakteur Thorsten Jantschek.
Der Mon-Chéri-Effekt
"Wer könnte dazu schon nein sagen?" Diesen Piemontkirschenslogan bringt der Vorschlag von Wolfram Schütte, eine Internet-Literaturzeitschrift zu gründen, unweigerlich hervor. Jedenfalls bei jedem Buchmenschen, Literaturaffizierten. Und das gilt selbst dort, wo jenes beiläufige, zufällige Umherschweifen, das Schütte mit Goethe jedem Leser ans Herz legt, längst ein vagabundierendes Surfen im Internet geworden ist. Eine ganz andere Kulturtechnik also, die im besten Falle als das Reiten jener Welle zu verstehen ist, die der Buchmarkt an den Strand dessen spült, was man wohl immer noch "literarische Öffentlichkeit" nennen kann.
Ein weiterer virtueller Ort für Bücher? Hurra! Der Mon-Chéri-Effekt stellt sich unweigerlich ein. Wobei allerdings nicht ganz klar ist, um welche gehaltvollen süßen Lesefrüchte es Schütte beim Umherschweifen oder Surfen geht. Ginge es ihm um die Bücher selbst, die entdeckt werden sollen, liefe das Anliegen, die Zeitschrift "Fahrenheit 451" zu gründen, freilich ins Leere, oder vielmehr in die Fülle. Denn zu keiner Zeit konnte man so viel über Literatur lesen und also Bücher entdecken wie heute, auch und gerade durch das Surfen von einer Seite zur nächsten, von der "New York Review of Books" bis hin zum "Lesen mit links"-Blog von Jan Drees etwa. Eine weitere Zeitschrift also? Warum nicht: "Fahrenheit 451 – Das charmante kleine Vergnügen". – Übrigens auch ein Slogan aus der Mon-Chéri-Werbung.
Es darf aber bezweifelt werden, dass es Schütte nur um das ungesuchte Finden von Büchern geht. Denn gefunden werden sollen vor allem: Rezensionen. Zumal solche, für die großen Zeitungen – und wir ergänzen: die Rundfunkanstalten – immer weniger Platz zu haben glauben. Schütte beklagt nämlich vor allem den Niedergang eines journalistischen Genres. Diese Diagnose ist in ein einfaches Argument gekleidet: Die Zahl der Rezensionen in den Qualitätsmedien nimmt erstens ab, woraus der Niedergang des Genres zu schließen ist. Und dieser Niedergang ist zweitens nur aufzuhalten durch die Neugründung einer literarischen Zeitschrift, die diesem Genre zu neuer Blüte verhilft.
Trotz des Mon-Chéri-Effekts glaube ich nicht, dass dieses Argument überzeugt. Und zwar aus zwei Gründen nicht: Aus der Verringerung der Anzahl der Rezensionen kann man nicht auf den Niedergang des Genres schließen. Wohl aber kann man von einem Bedeutungsverlust der klassischen Rezension sprechen, deren Ausdruck die geringere Anzahl klassischer Rezensionen ist. Aus diesem Grund ist zweitens die erwartete neue Blüte der klassischen Rezensionen in einer digitalen oder gedruckten Zeitschrift eine Illusion.
Warum die geringer werdende Anzahl von Rezensionen nicht den Niedergang eines Genres bedeutet
In den Qualitätsmedien werden heute eindeutig weniger klassische Rezensionen veröffentlicht als noch vor wenigen Jahren. Und das betrifft nicht nur die Literatur und das Sachbuch, sondern auch Film, Ausstellungen, Theater, Musik und Oper. Etwa hier im Deutschlandradio Kultur werden inzwischen etwas weniger klassische Buch-Rezensionen gesendet als bis vor einem guten Jahr – allerdings immer noch täglich mindestens zwei, eine davon in der Primetime am Morgen und eine in der Literatursendung "Lesart". Nach wie vor – und das gilt meiner Meinung nach auch für die Qualitätszeitungen – werden trotz steigender Titelzahlen die wichtigen Bücher auch rezensiert, und manchmal sind die wichtigen Bücher auch die, die Redakteure für wichtig erachten, jenseits des Mainstreams, jenseits der großen Verlage, jenseits der Bestsellerlisten. Vom Niedergang eines journalistischen Genres kann man nicht sprechen.
Zugleich wird heute in diesem Programm mehr über Bücher und Literatur gesprochen als vorher, Autorengespräche, Portraits, Literaturtipps, aktuelle Berichterstattung zur Literatur findet im ganzen Programm, von der Frühsendung "Studio 9" bis hin zu kulturellen Tagesschau "Fazit" statt. Zudem in der täglich einstündigen Literatursendung "Lesart", die es seit einem Jahr gibt. Es gibt weniger Rezensionen und mehr Literatur. Zum Finden von Büchern, ohne sie gesucht zu haben, ist für die literarisch interessierte Öffentlichkeit sehr viel Raum gegeben.
Dennoch kann man von einem Schwinden der Bedeutung der klassischen Rezension sprechen, weil sie nun neben all die anderen Formen des journalistischen Umgangs mit Literatur tritt und ihre "Pole Position" als kulturjournalistische Königsdisziplin eingebüßt hat. Die Ursachen dieser Relativierung der Rezension erkennt Wolfram Schütte allein in der durch ökonomische Zwänge vollzogenen Anpassung an den Mehrheitsgeschmack. Dagegen sieht Sieglinde Geisel in ihrem Beitrag zur "Perlentaucher"-Debatte abnehmende literarisch-ästhetische Urteilskraft und den Mangel an Mut zum angreifenden Urteil auf Seiten der Kritiker selbst am Werk. Beide Diagnosen treffen meiner Meinung nach nicht zu, ja, sie verkennen, dass sich in den letzten mindestens 20 Jahren ein Strukturwandel der literarischen Öffentlichkeit ereignet hat, der sich auch im Bedeutungsschwund der klassischen Rezension zeigt.
Der Ausgang des Lesers aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit
Als der Philosoph Jacques Rancière vor zwei Jahren in Berlin sein Buch "Aisthesis" vorgestellt hat, füllten überwiegend junge Zuhörerinnen und Zuhörer theorievergnügt und denklustig ein Theater. Cord Riechelmann schrieb damals:
"Denn ebenso wie bei Vorträgen von Alain Badiou, Slavoj Zizek und Giorgio Agamben sitzen auch bei Rancière genau jene jungen, hellwachen Leute im Publikum, denen die Feuilletons vergeblich hinterherlaufen. Und das hat auch einen einfachen Grund, der sehr viel mit den Praktiken der Kunst seit etwa 250 Jahren zu tun hat. Die Zeitungen schaffen es einfach nicht, auf die der Kunst immanenten Deterritorialsierungstendenzen adäquat zu reagieren. Kein Mensch ist heute mehr auf die Meinung eines seine Ressorthoheit im Stil eines Provinzfürsten verteidigenden Theaterkritikerzampanos angewiesen, und das liegt nicht nur am Internet. Es hat auch mit den Kunstbiennalen der Welt, mit Theatern wie dem HAU und Theoretikern wie Badiou, Zizek und Rancière zu tun."
Dass die Literatur von diesen Deterritorialisierungstendenzen längst ergriffen ist, scheint mir Teil des angesprochenen Strukturwandels zu sein. Zu entfalten, was das genau heißt, fehlt hier der Raum. Hier nur einige Symptome: Literatur wird viel stärker als noch vor 20 Jahren als zeitdiagnostisches Medium gelesen, jenseits überzeitlicher Geltungsansprüche oder emphatischer Wahrheitsbegriffe, die von der Gutenberg- zur Adornogalaxis geführt haben, in welcher einem Celan-Gedicht der Sinnzusammenhang des Großen und Ganzen abzulauschen war. Und in der Schriftsteller in den Medien als großintellektuelle Deutungsinstanzen par excellence auftraten, egal ob es um den Nato-Doppelbeschluss oder um Naturkatastrophen ging. Eine Haltung, über die kürzlich die Rapp Formation "Antilopen Gang" angesichts brennender Flüchtlingsheime im Refrain ihres Songs "Beate Zschäpe hört U2" noch spotten konnte: "Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht".
Wahrheit und Bedeutung
Die Wahrheit überlässt das Debattenfeuilleton von heute gerne denen, die sich bei der Erforschung der Wirklichkeit auskennen, den Wissenschaftlern. Auch die zunehmende Wertschätzung des Sachbuchs im Feuilleton ist ein Zeichen des angesprochenen Strukturwandels der literarischen Öffentlichkeit, in der nicht mehr der Literat und sein Kritiker die Deutungshoheit über die intellektuellen Diskurse inne haben.
Spricht man heute über die Bedeutung eines literarischen Textes, landet man umgekehrt nicht automatisch bei der Wahrheitsfrage, sondern bei einer Vielzahl von Bezügen, die solche ein Gebilde zum Leben, zur Gesellschaft, zum Kino, zu Fernsehserien, zur Popmusik oder zur bildenden Kunst etc. hat. Der Kritiker ist nicht mehr ein Wahrheitssucher, sondern ein im semantischen Sinne Bedeutungsspurenleser, was sicher nicht weniger anstrengend, aber sehr viel hedonistischer ist. (Übrigens wird mit einer solchen Perspektive auf Literatur die Form ästhetischer Urteile, von der Kant sagte, sie seien von "subjektiver Allgemeinheit", konkret eingelöst.) Für den Leser, so scheint es mir, wird oft im gelungenen Reden über Literatur – ob im Printtext, Blog oder Radiogespräch – eine Fährte in ein Kunstwerk gelegt, das offen bleibt und nicht durch ein Kunstrichterurteil verstellt wird. Hier könnte man vom Diskurs um die Kritik in der bildenden Kunst oder der Popmusik einiges lernen.
Rein literaturästhetische Kriterien, wie sie Sieglinde Geisel aufbietet ("Was leistet ein Text literarisch? Stellt ein Autor mit der Sprache etwas an, was vor ihm keiner getan hat? Hören wir eine eigene Stimme?"), scheinen mir kaum mehr hinreichend, um in die Bedeutungsvielfalt einzutauchen, die sich aus dem Zusammentreffen von Texten und Lesern ergibt. Leserinnen und Leser stehen zudem viel selbstbewusster für den Eigensinn ihrer "Lesarten" als manche Rezensenten sich das denken oder wünschen können. Sich die Blüte des klassischen Rezensionswesen in einer neuen Zeitschrift vorzustellen, scheint mir eine Illusion zu sein in einer Zeit, in der das Gespräch über Literatur offener geworden, in der sich die durch die klassische Kunstrichterposition entstandene Diskurshierarchie abgeschliffen hat. Auf die Gefahr hin freilich, dass dieses Gespräch und mithin die literarische Öffentlichkeit sich in subjektive Perspektiven aufsplittert, und die Allgemeinheit, von der Kant sprach, verloren geht. Jüngst etwa hat Mark Terkessidis in seinem Buch "Kollaboration" beklagt, dass die Kritik als "kollektive, systematische Anstrengung" verloren zu gehen droht.
"Was wäre", so fragt er sich, "wenn ich die Subjektivität und Kollektivität meines Ausdrucks annehme und zur Voraussetzung meiner Erkenntnisse mache? Nähe, Affekt, Leiblichkeit, Liebe wären Dispositionen für Kritik. Ich würde die Tatsache anerkennen, dass ich Bestandteil eines 'Wir' bin, mit dem ich bei jedem Ausdruck auf die eine oder andere Weise in Verbindung stehe. Kritik ist kollaborativ, wenn sie ihre Subjektivität und Vergemeinschaftung akzeptiert. Wenn ich kritisiere, bin ich fundamental eingebunden in eine geteilte Welt von Nähe, Affekt und Körperlichkeit."
Es gibt viele Anzeichen dafür, dass sich die Position der Kritikerin und des Kritikers in diese Richtung verändert, vom exponierten Gegenüber auf dem Richterstuhl hin zum Teilnehmer eines Gesprächs, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, dass in ihm mitunter die Fetzen fliegen. Der Versuch, das "Literarische Quartett" wieder aufleben zu lassen, ohne die Autorität des Großkritikers im klassischen Sinn, darf als weiteres kleines Indiz gesehen für diese Rollenverschiebung gesehen werden. All das geschieht nicht, weil es – wie Sieglinde Geisel nahelegt – den Kritikern heute an Mut für angreifende Kritik fehlt oder weil sich Kritiker und Kritisierte im Literaturbetrieb ständig über den Weg laufen, sondern weil sich die literarische Öffentlichkeit vom Großkritiker ebenso emanzipiert hat wie vom Großschriftsteller. Sie führt das Gespräch über Literatur mindestens auf Augenhöhe. Wer das Klagenfurter Wettlesen auf Twitter verfolgte, wird sich dieser Einsicht kaum verschließen können.