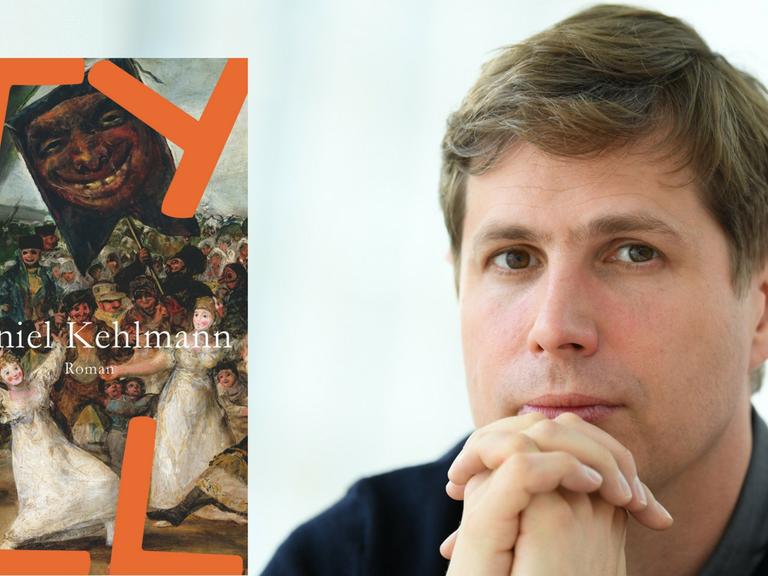"Wir sind professionelle Papageien"

"Man muss dasselbe Buch schreiben wie der Autor, aber mit den Mitteln der anderen Sprache", sagt Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Wie man einen Houellebecq oder Diderot also quasi neu, auf deutsch schreibt, erklären er und sein Kollege Frank Heibert.
Joachim Scholl: Heute sind die Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel unsere Gäste und Begleiter. In über 30 Jahren Tätigkeit haben sie sich beide ein, man kann schon sagen, enormes Renommee erschrieben durch die Übertragung vieler, vieler bedeutender Autoren.
Sie, Frank Heibert, kenne ich vor allem durch Ihre Übersetzungen amerikanischer Literatur von Don DeLillo und Richard Ford. Und Sie, Herr Schmidt-Henkel, sind vor allem Fachmann für französische Werke. Sie haben Klassiker übersetzt, Diderot, Céline, neuere Literatur, Houellebecq oder Édouard Louis. Was liegt denn derzeit auf Ihrem Schreibtisch, woran arbeiten Sie?
Hinrich Schmidt-Henkel: Nichts Französisches, nur Norwegisches, weil Norwegen ja dieses Jahr Gastland bei der Buchmesse ist und da gibt es ein ganz enormes Interesse und eine sehr breite Publikationsplanung. Und ich bin seit letztem Januar mit Norwegischem beschäftigt, was nämlich meine zweite Arbeitssprache ist.
Scholl: Gleich mal dazu: Wie kommt man dazu? Also, ich meine, Romanistik haben Sie, glaube ich, studiert, und dann denkt man Französisch, Italienisch vielleicht. Aber Norwegisch ist ja dann doch ein "special case".
Schmidt-Henkel: Das ist wie immer bei Literaturübersetzern – die Lebenswege. Ich bin mit Plattdeutsch aufgewachsen, habe als Kind angefangen, Dänisch zu lernen, an der Uni Schwedisch studiert und hatte dann lange einen norwegischen Schatz und habe dann alles auf Norwegisch umgebaut. Und seitdem habe ich sehr, sehr viel mit dem Land und seiner Literatur zu tun.
Scholl: Und Sie, Herr Heibert, was liegt auf Ihrem Schreibtisch?
Frank Heibert: Da liegen drei Sachen nebeneinander, das ist typisch für Übersetzer, dass die Bücher in verschiedenen Stadien der Entwicklung ja sind. Ich übersetze im Moment noch, ich bin mitten drin, ich mache eine Neuübersetzung von "Der große Schlaf" von Raymond Chandler, eine Neuentdeckung der literarischen Seiten dieses ja eigentlich als Krimiklassiker bekannten Buches für Diogenes. Und im Lektorat befindet sich gerade bei Suhrkamp meine Neuübersetzung von "Zazie in der Metro" von Raymond Queneau, also dieser Klassiker, der ja auch durch den Louis-Malle-Film bekannt geworden ist. Und im Februar erscheinen wird von Marie Darrieussecq "Unser Leben in den Wäldern" beim Secession Verlag, eine schwarzhumorige, finstere Dystopie der bekannten französischen Autorin, die am 21. Februar eben hier nach Berlin damit kommt, und deswegen muss ich das auch vorbereiten.
"Man muss einen historischen Abstand überwinden"
Scholl: Sind diese Klassiker, also diese schon vorliegenden Bücher, sind das eigentlich schwerere Übersetzungen als jetzt, sagen wir mal, zeitgenössische, ganz neue Literatur, weil man dann doch sich immer mit einem Vorbild oder einem Vorläufer misst oder vielleicht etwas anders, besser machen soll, muss, kann, will?
Heibert: Ja, es ist nicht schwerer, sondern es ist anders herausfordernd, denn man muss ja meistens einen historischen Abstand, einen zeitlichen Abstand zwischen der Sprache damals und der Sprache heute irgendwie überbrücken und überwinden.
Ich gucke mir die älteren Übersetzungen tatsächlich ganz am Anfang, wenn ich überlege, ob ich das mache, kurz an, ob sich das lohnt. Und dann nicht mehr, damit ich meinen eigenen Ton und Zugang finde. Und ganz am Schluss, wenn ich eigentlich fertig bin, gucke ich noch mal, habe ich irgendwelche supergenialen Ideen nicht gehabt, die der oder die gehabt hat. Aber ansonsten gucke ich mir die eigentlich nicht an.
"Infiziert von fremden Formulierungen"
Scholl: War das bei Ihnen auch so, bei Diderot, den Sie zum Beispiel übersetzt haben?
Schmidt-Henkel: Ja, es gibt ein Hauptproblem, man kann den Autor nicht mehr fragen. Das ist ziemlich misslich. Fragen kann man allerdings die früheren Übersetzungen, man kann schauen, was haben die verstanden, was haben die anders verstanden als ich, was haben sie falsch verstanden – die können Lektürehilfe sein.
Aber man muss sich da sehr hüten, denn wir sind ja professionelle Papageien, man wird sehr schnell infiziert von den fremden Formulierungen. Also wenn, dann eigentlich erst hinterher, man hat seinen Satz oder Absatz fertig, man weiß, hier ist noch eine Lücke. Céline zum Beispiel ist einfach auch für Franzosen, wenn sie genau erklären sollen, was ein Satz bedeutet, sind sie oftmals auch überfragt. Man muss dann die Bedeutung sozusagen einkreisen und so langsam sich erschließen, und da kann eine frühere Übersetzung tatsächlich auch Lektürehilfe sein.
Scholl: Sie sind beide vielfach ausgezeichnet worden schon für Ihre Arbeit. Im vergangenen Jahr haben Sie einen gemeinsamen Preis bekommen für die Übersetzung von Raymond Queneaus "Stilübung", das war, glaube ich, auch ein Preis für Ihr beider Lebenswerk. Das war schon etwas Besonderes.
Heibert: Man kommt sich vor wie kurz vor der Rente.
"Es macht auch einen Monsterspaß"
Scholl: Wie muss man sich das denn vorstellen, ein Queneau-Band, der Lyriker, keine leichte Kost zu übersetzen, denke ich mal, schon im Original anspruchsvoll. Und das dann auch noch gemeinsam, wie ging das?
Schmidt-Henkel: Erstens ist das ein Buch, das das wirklich erfordert, dass da mehrere Leute dransitzen. Die frühere Übersetzung war ja auch von zweien, Ludwig Harig und Eugen Helmlé, und man muss sich vorstellen, es gibt eine ideelle und eine ökonomische Seite.
Die ideelle ist, man arbeitet zusammen, lernt wahnsinnig viel voneinander, tut in dem Fall gut 60 Jahre Übersetzererfahrung in die Waagschale, und es macht auch einen Monsterspaß.
Heibert: Fortbildung auf eigene Kosten.
Scholl: 60 Jahre hat Herr Henkel jetzt mal gerade zusammengezählt.
Schmidt-Henkel: Und die ökonomische Seite ist: mindestens anderthalbmal so viel Arbeit und dafür ein halbes Honorar.
Zu zweit am Küchentisch, jeder an seinem Laptop
Heibert: Aber bei dem Buch hat es sich wirklich geeignet, weil es ja eine … Also, Stilübung heißt ja eben, es werden bestimmte Stilformen und Stilrichtungen durchexerziert, immer an derselben kleinen, dummen Geschichte. Und da ist Spielerisches gefragt, also, Sprachkreatives – und das geht natürlich im Dialog und im Pingpong dann noch mal besser, man kriegt noch mal zugespitztere und witzigere Ideen.
Schmidt-Henkel: Das Foto, wo wir uns gegenübersitzen am Küchentisch, jeder an seinem Laptop. Und so haben wir eine nach der anderen dieser kleinen Geschichten wirklich so mit der Goldwaage, aber so, dass es trotzdem fetzt, bearbeitet – und das war ein Heidenspaß.
Scholl: Jetzt haben Sie dieses Pingpong schon räumlich aufgelöst. Wir dürfen es ja verraten, Sie beide machen ja auch keinen Hehl daraus, dass Sie auch ein Paar sind, Lebensgefährten. Lebensgefährten und seit einem Jahr auch richtig verheiratet. Das ist, man vermutet es instinktiv, noch produktiver im Austausch, sozusagen von Arbeitszimmer zu Arbeitszimmer über den Flur. Hat das auch Schattenseiten, nervt man sich dann auch gegenseitig mit den Problemen der Arbeit?
Heibert: Ich finde das nicht nervig, ich finde es immer spannend, den anderen Blickwinkel, auch teilweise von der anderen Sprache zu sehen. Also, Norwegisch spreche ich, so zehn Prozent verstehe ich vielleicht, mehr leider nicht. Aber ich finde es trotzdem dann spannend mitzukriegen, was sich da abspielt und da irgendwie meinen Senf dazuzugeben, wenn er gefragt ist. Ich finde es eher bereichernd und auch rückversichernd, wenn ich bei einer bestimmten Sache einfach unsicher bin, dann sag ich: Was denkst du dazu?
Scholl: Sie haben viele Schnittmengen, dann kommt der eine zum anderen und sagt, guck, lies das mal, was sagst denn du dazu?
Schmidt-Henkel: Wir treffen uns in der Mitte in der Küche und sprechen darüber, manchmal sitzen wir auch beide etwas umflort blickend in der Küche, weil jeder noch so tief in seinem Text ist. Vor allem hilft es einem, nicht in der Vereinsamung zu verschwinden wie viele, die alleine zu Hause arbeiten. Wenn man die um elf Uhr anruft, sind die noch nicht eingesungen und müssen sich erst mal räuspern. Das kann bei uns nicht passieren.
Der Impuls, etwas in die eigene Sprache zu nehmen
Scholl: Wie wird man das eigentlich, möchte ich Sie jetzt mal fragen, was Sie sind, literarische Übersetzer. Das ist ja kein Ausbildungsberuf, für den man sich, glaube ich, irgendwann entscheidet beim Arbeitsamt und sagt, ich möchte Übersetzer werden.
Wenn man auf Ihre Vita schaut, dann steht da erst mal literaturwissenschaftliches Studium. Sie sind beide fast gleich alt, um den Jahrgang 1960, wie ging das los bei Ihnen, Herr Schmidt-Henkel, wie kamen Sie zum Übersetzen?
Schmidt-Henkel: Ich habe immer gerne übersetzt, auch in der Schule. Ich bin schon so alt, dass mein Abitur 1978 noch darin bestand, aus dem Französischen zu übersetzen und ins Französische zu übersetzen. Ich hatte schon immer diesen Impuls, wenn etwas, das ich auf Französisch las, auch mit 15 oder 16, dass ich das in den eigenen Mund, in die eigene Sprache nehmen wollte.
Ich bin aber erst mit 27 als zukünftiger arbeitsloser Lehrer auf den Trichter gekommen, dass das ja ein Beruf ist. Ich hätte es längst wissen können, weil meine Eltern sehr mit Eugen Helmé befreundet waren, und ich das ja wusste, dass das ein anständiger und vollständiger und hochinteressanter Beruf ist. Und da kam ich auf die Idee, versuch das mal.
Die erste Übersetzung: ein Geburtstagsgeschenk
Scholl: Bei Ihnen, Frank Heibert, da liest man auch von einer musikalischen Begabung, Sie sind auch Musiker, haben Bandprojekte. Wie kamen Sie zur Literatur in dieser Form?
Heibert: Ich habe mich mit 18 entschieden, ob ich Musik studiere oder Literaturwissenschaft. Und dann habe ich mich für die Literatur entschieden.
Schmidt-Henkel: Gut so!
Heibert: Ich habe die Musik immer beibehalten, aber eben nicht hauptberuflich gemacht. Und ich habe Französisch studiert und da haben wir ein Buch gelesen, was mich begeistert hat und was ich meinem damaligen Schatz irgendwie zugänglich machen wollte, der aber nicht Französisch sprach. Und dann habe ich ganz naiv mit 21 mich dahingesetzt und habe gesagt, ach, ich übersetze das einfach mal. Das war ein Briefroman, 100 Seiten, Marguerite Yourcenar, "Alexis ou le traité du vain combat", und das habe ich in drei Monaten nebenbei so gemacht und dann als Geburtstagsgeschenk überreicht.
Und dann haben wir das Freunden gezeigt und dann war einer dabei, Klaus Völker, der die Gesamtausgabe von Boris Vian für 2001 betreute und sagte, da brauchen wir noch welche, die mitmachen, hast du nicht Lust? Und schwups war ich drin und habe gemerkt, das ist voll mein Ding!
Scholl: Wie kriegt man denn eigentlich so die erste Übersetzung los? Ich meine, jetzt ist es natürlich für Sie kein Problem mit Ihrem Namen, aber man muss ja erst einmal landen. Schickt man dann eine Probeübersetzung an einen Verlag oder lernt man Leute kennen, schreibt Leute an?
Schmidt-Henkel: Das ist so ein Mix. Klar, man sucht sich Lieblingsprojekte aus, die noch nicht übersetzt sind, und macht ein Dossier und versucht, das irgendwie dann anzubieten. Und irgendwann kommt man auf dem Wege, wenn es gut ist, was man gemacht hat, auch rein.
Einfühlen in die Erzählerstimme
Scholl: Was zeichnet denn jetzt aber auch eine gute Übersetzung aus? Es ist ja bei der Literatur immer mehr als jetzt nur die Übertragung von Sprache. Na gut, natürlich müssen auch Kochbücher übersetzt werden, aber Literatur ist ja doch mehr eine Art, ja, es ist ein Transfer von Atmosphäre, von Stil, Stimmung, als dass man das, was das Werk im Original auszeichnet, irgendwie rüberbringt.
Schmidt-Henkel: Man kann es auf eine sehr knappe Formel bringen. Man muss dasselbe Buch schreiben wie der Autor und dasselbe schreiben wie der Autor, aber mit den Mitteln der anderen Sprache. Das klingt relativ griffig, aber enthält alle Schwierigkeiten, die dabei eben einhergehen.
Ich muss alle Merkmale des Originals erfassen, erkennen, muss mich dann von ihrer Struktur, von ihren Wörtern, ihrer Grammatik, ihrem Zeitengebrauch und so weiter, aller Idiomatik freimachen – und muss all diese erkannten Elemente neu und möglichst restlos mit den Mitteln der anderen Sprache dann wieder ausdrücken. Schreiben wie der Autor, nur mit den Mitteln der eigenen Sprache, das ist es eigentlich.
Heibert: Und um das hinzukriegen, muss ich mich auch letztlich psychologisch einfühlen in die Erzählerstimme. Jedes Buch ist ja im Grunde eine Stimme, die mir eine Geschichte erzählt. Und ich muss selber diese Geschichte erzählen, erzählen wollen, erzählen können, mit demselben Ton, mit derselben Haltung zur Geschichte, zur Wirklichkeit, wie sie eben die Autorin eingenommen hat, und dann aber mit den Mitteln des Deutschen.
"Qualität setzt sich durch"
Scholl: Kann man das lernen?
Schmidt-Henkel: Man kann es üben. Man kann es auch üben in Aufbaustudiengängen, die es zum Beispiel in Düsseldorf, Düsseldorf ist ein grundständiges Studium sogar, Aufbaustudiengänge gibt es in München und Leipzig. Das Diplom, was man danach in der Hand hat, garantiert einem nicht, dass man irgendwann an den Vertrag eines Verlages kommt. Da gilt: Qualität setzt sich durch.
Scholl: Ich wollte vorhin schon die Einschränkung machen, man kann es natürlich inzwischen auch studieren. Aber die Frage ist ja dann auch, wie in Schreibschulen, ob es dann dafür reicht oder … Ab wann merkt man denn, dass man Übersetzer ist?
Heibert: Ach du Scheiße. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, einerseits hat man selber das Gefühl dafür.
Schmidt-Henkel: Vor der ersten Übersetzung merkt man das.
Heibert: Nein, eigentlich hat man das Gefühl, während man es macht, dass man genau diesen Prozess des Übertragens, des Findens in der eigenen Sprache, dass der einen elektrisiert, dass man das toll findet, wohingegen viele andere stöhnen würden und sagen würden, meine Güte, das ist ja irgendwie Sisyphos und diese Fleißarbeit und so weiter, dann wärst du es nicht.
Und dann gibt es den zweiten Moment, wenn man plötzlich merkt, okay, da erscheint ein Buch, da erscheint vielleicht noch ein Buch, es gibt Verlagslektorate, die mich jetzt langsam kennen, die mich fragen, mit denen ich in Kontakt bin, wenn ich einen Vorschlag mache, dann hören die, merken die auf, so dieser Moment. Also, diese zwei Punkte gibt es eigentlich, wo man merkt, das ist mein Ding und ich bin beruflich angekommen.
"Alles lässt sich übersetzen"
Schmidt-Henkel: Es ist eine eigene Fähigkeit. Mancher denkt, ach, ich kann Englisch, ich kann Deutsch, jetzt übersetze ich mal, und macht sich an die Arbeit und merkt, das geht ja gar nicht. Und die Fähigkeit nämlich zu übersetzen, diesen Transfer zu machen, die muss auch noch dazukommen.
Scholl: Waren Sie schon mal so bei einem Buch mit Ihrem Latein am Ende? Gab es mal so Momente, wo Sie sagten, also jetzt schnalle ich irgendwie ab, ich habe keine Ahnung, wie ich das irgendwie rüberbringe in die Sprache. Oder gibt es einfach Probleme oder lösen sich dann Dinge – oder haben Sie einen Moment, wo Sie sagen, bei diesem Buch, da kam es mal fast zum Äußersten, dass ich sagte, ich hör auf?
Heibert: Nein, das nicht. Ich glaube, Sachen, wo ich das Gefühl hätte, die würde ich gar nicht annehmen. Es gibt natürlich Bücher, wo ich denke, die könnte ich nicht übersetzen aus verschiedensten Gründen, die würde ich dann nicht machen. Aber wenn ich es annehme, dann denke ich, die Probleme, die sich daraus ergeben, die kriege ich auch irgendwie gelöst. Und es gibt Einzelmomente, wo ich dann denke, jetzt bin ich mal echt herausgefordert, aber dann finde ich doch einen Weg.
Schmidt-Henkel: Ich finde, alles lässt sich übersetzen. Es ist ein Ersetzungs- und Verhandlungsprozess und der geht mit Gewinnen und Verlusten einher, vor allem aber mit viel Freude. Manche Dinge muss man sich halt zurücklegen und die Lösung später finden.
Das Gespräch ist in gekürzter Form transkribiert. Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.