Ljudmila Ulitzkaja: "Jakobsleiter"
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt, Hanser, München 2017, 600 Seiten. 26 Euro
Zu viel Wahrheit, zu wenig Roman
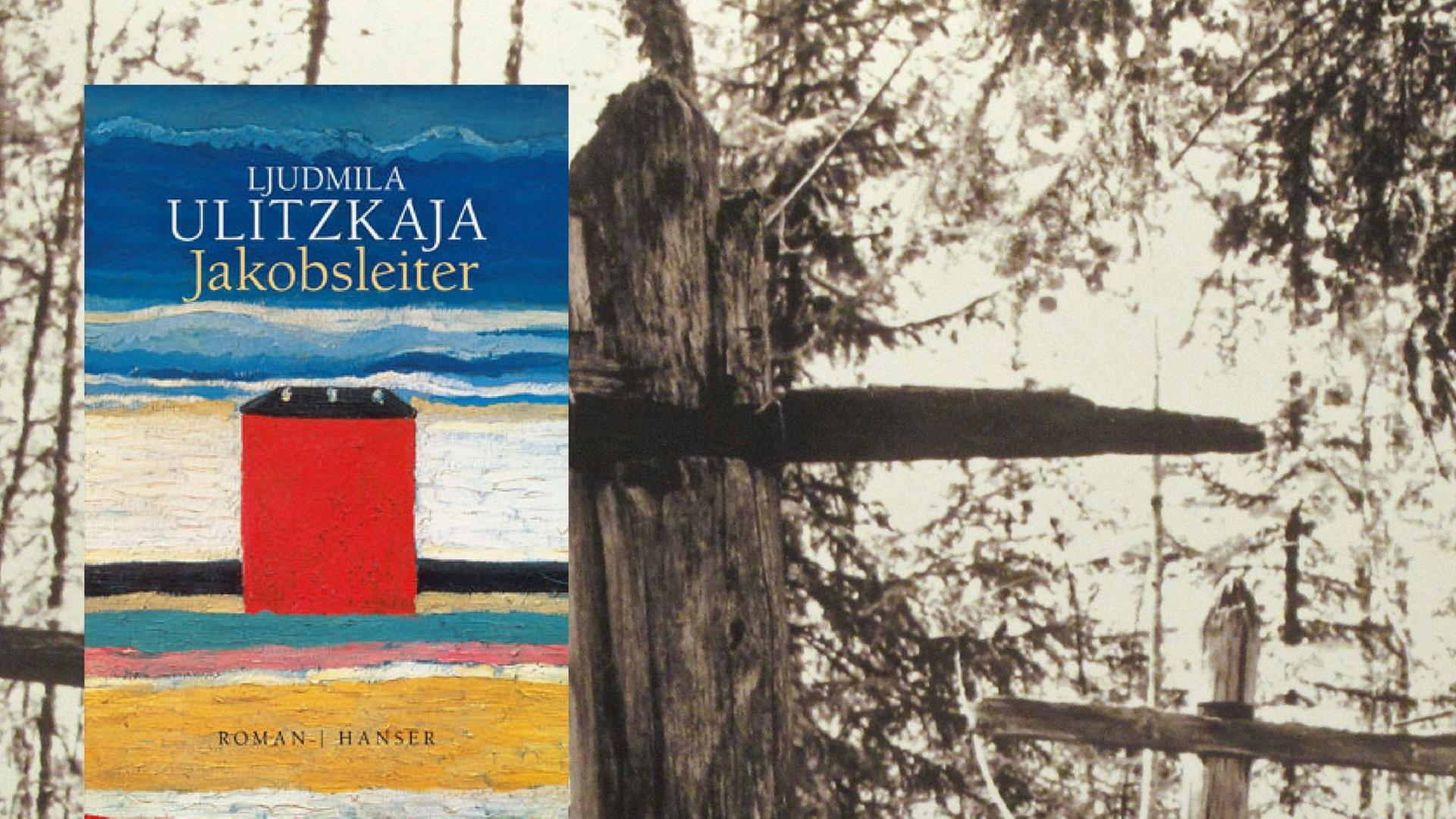
Sehr persönlich und dann doch wieder sehr distanziert und mit vielen Leerstellen - Ludmilla Ulitzkaja hat die Liebesgeschichte ihrer Großeltern in eine Romangeschichte verpackt. Aber offenbar fühlte sie sich dabei zu sehr der Wahrheit verbunden.
Familienromane über die eigenen Vorfahren sind ein tückisches Genre: Die Autoren sind einerseits – wie in einer Autobiografie - selbst Protagonisten und müssen doch gleichzeitig viele Lücken füllen, die sich allein durch Überlieferungen nicht schließen lassen. In einem gewöhnlichen Roman kann man vieles erfinden, ausschmücken und nach Belieben vergrößern, man kann eine schlüssige, runde, deutlich konturierte und am Ende glänzend polierte Geschichte daraus machen. Die Wirklichkeit aber ist immer mittelmäßiger. Schäbiger. Und sinnloser.
Dieses Problem belastet auch Ljudmila Ulitzkajas "Jakobsleiter", in dem sie die Liebesgeschichte ihrer Großeltern in Zeiten der russischen Revolution und des Stalinismus nachzuerzählen versucht.
Er kommt aus dem Lager, aber sie ist nicht da
Jakow Ulitzki, der im Buch Ossitzki heißt, wurde zweimal zu Lagerhaft verurteilt, und wurde erst nach Stalins Tod 1956 rehabilitiert. Seine Frau Maria Petrowna, die sich von der Bohemienne und modernen Tänzerin zur glühenden Kommunistin entwickelte, ließ sich in seiner Abwesenheit von ihm scheiden. "Briefmarken halten keine Ehe zusammen", schrieb Jakow in mehreren seiner Briefe aus Sibirien. Auf die letzten antwortet Maria Petrowna nicht einmal mehr. Schon als er in den 1930er Jahren nach seiner ersten Lagerhaft entlassen wird, ist sie nicht da - sie ist mit dem Sohn in den Urlaub gefahren.
Wieviel politischer Opportunismus war da im Spiel, wieviel ideologische Überzeugung, wieviel enttäuschte Liebe? Diese Frage beantwortet Ulitzkaja nicht. Ihre Quelle sind Jakows KGB-Akte und die Briefe, die sich die beiden zwischen 1913 und 1954 geschrieben haben, und die geben darüber keine genaue Auskunft. Obwohl vieles andere in diesem Buch fiktional ausgearbeitet und ausgebreitet wird – wie die ersten heimlichen Liebesnächte des jungen Paares -, wagt die Autorin an dieser wesentlichen Stelle keine Interpretation. Vorsichtig und mit vielen "vielleichts" erfindet sie eine Liebesaffäre zwischen Maria und einem Politikprofessor, der sich um die alleinstehende Mutter kümmert und sie - vielleicht, vermutlich, wahrscheinlich - beeinflusst.
Eine seltsame Distanz
Auf einer anderen Zeitebene erzählt Ulitzkaja die Geschichte einer Frau namens Nora, die Enkelin der Ossetzkis, die mit ihr selbst das Geburtsdatum und noch eine Menge anderer Dinge gemeinsam hat. Vom Todesjahr der Großmutter, 1975, bis in die Gegenwart hinein erlebt diese Nora, Bühnenbildnerin und Ehefrau eines autistischen Genies, das Ende der Sowjetunion. Doch der Kunstgriff, die eigene Erzählposition in einer fiktiven Figur zu verankern, schafft eine seltsame Distanz.
Ulitzkaja hat in einem ausführlichen Interview vom Entstehen dieses Buches und von ihren Großeltern erzählt. Das klingt stellenweise tatsächlich interessanter und berührender als das, was im Buch mit handwerklichem Pragmatismus zusammengefügt ist: Da wurde mal geglättet, mal erfunden, mal zitiert, mal vermutet. Einerseits hat sich die Autorin gescheut, als erzählendes Ich mit seinen eigenen Gedanken in Erscheinung zu treten; und andererseits – vielleicht aus Respekt – auch nicht gewagt, ihre Großeltern als Romanfiguren neu zu erschaffen. Das Problem aller Familienromane – hier bleibt es ungelöst.






