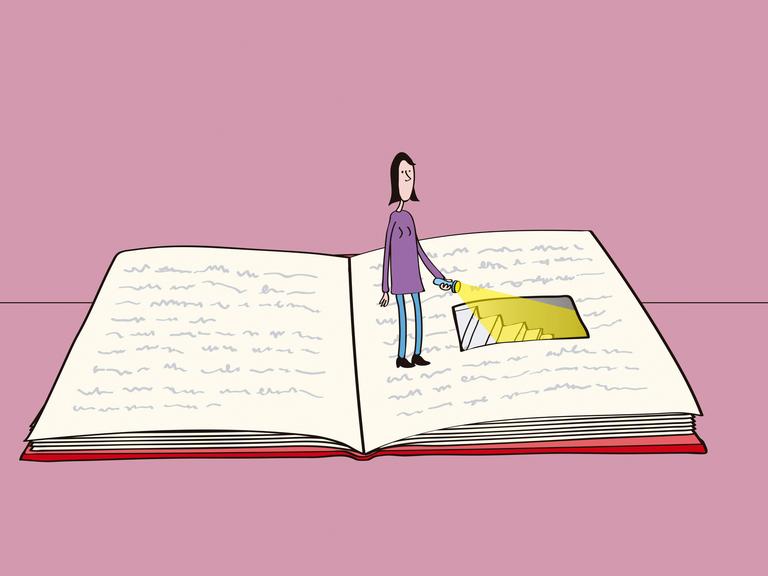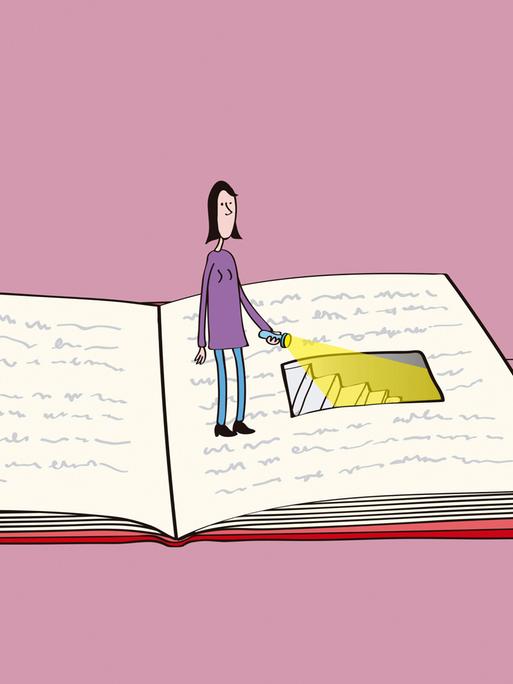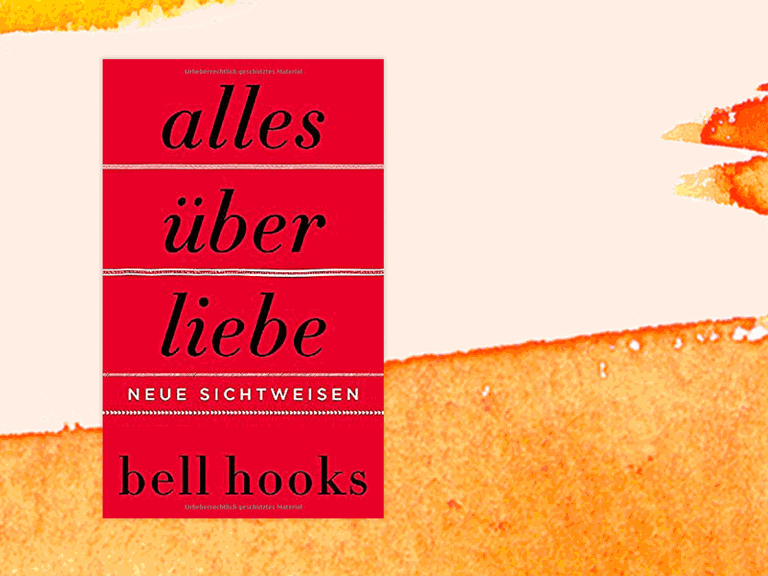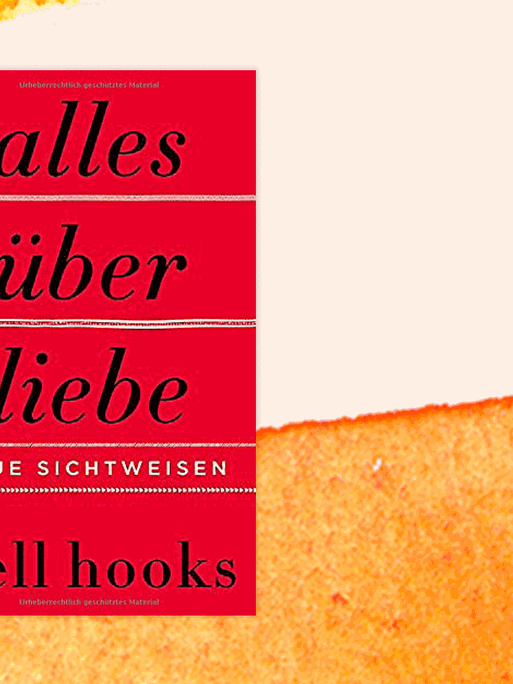Lucy Delap: „So sieht Feminismus aus. Die Geschichte einer globalen Bewegung“
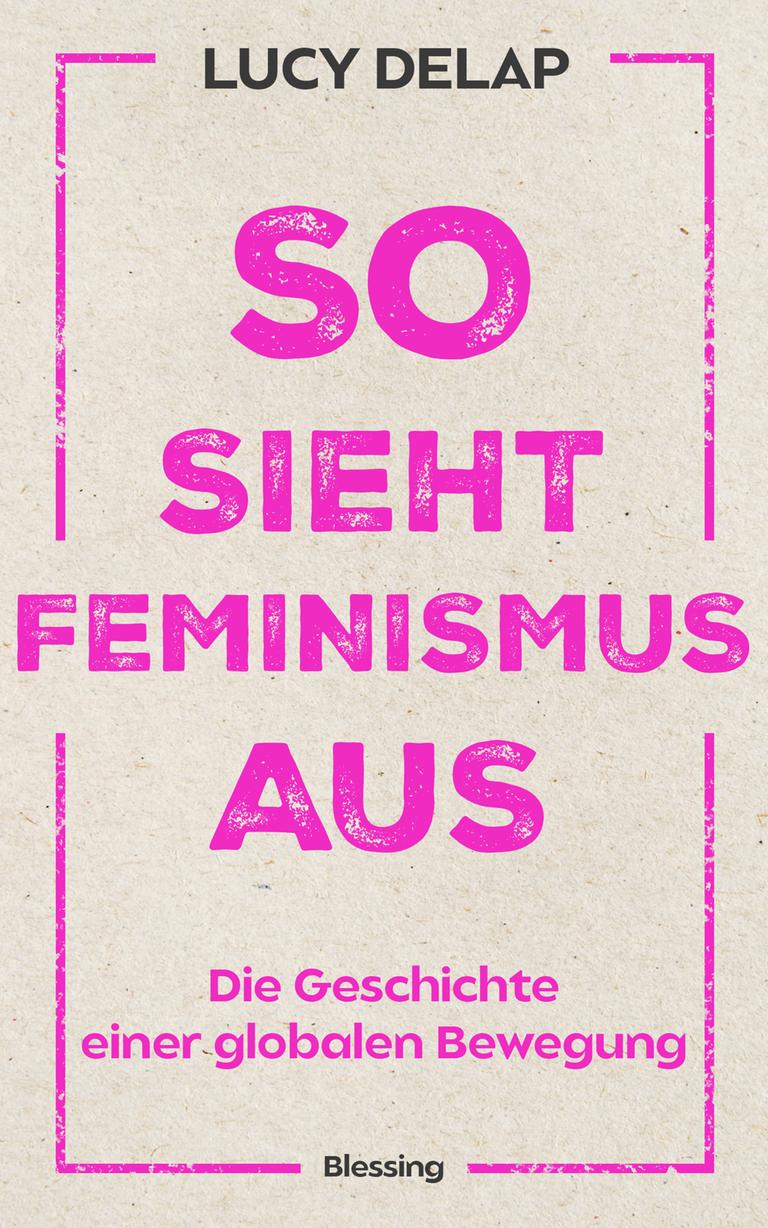
© Blessing
Feminismus gibt es nur im Plural
06:18 Minuten
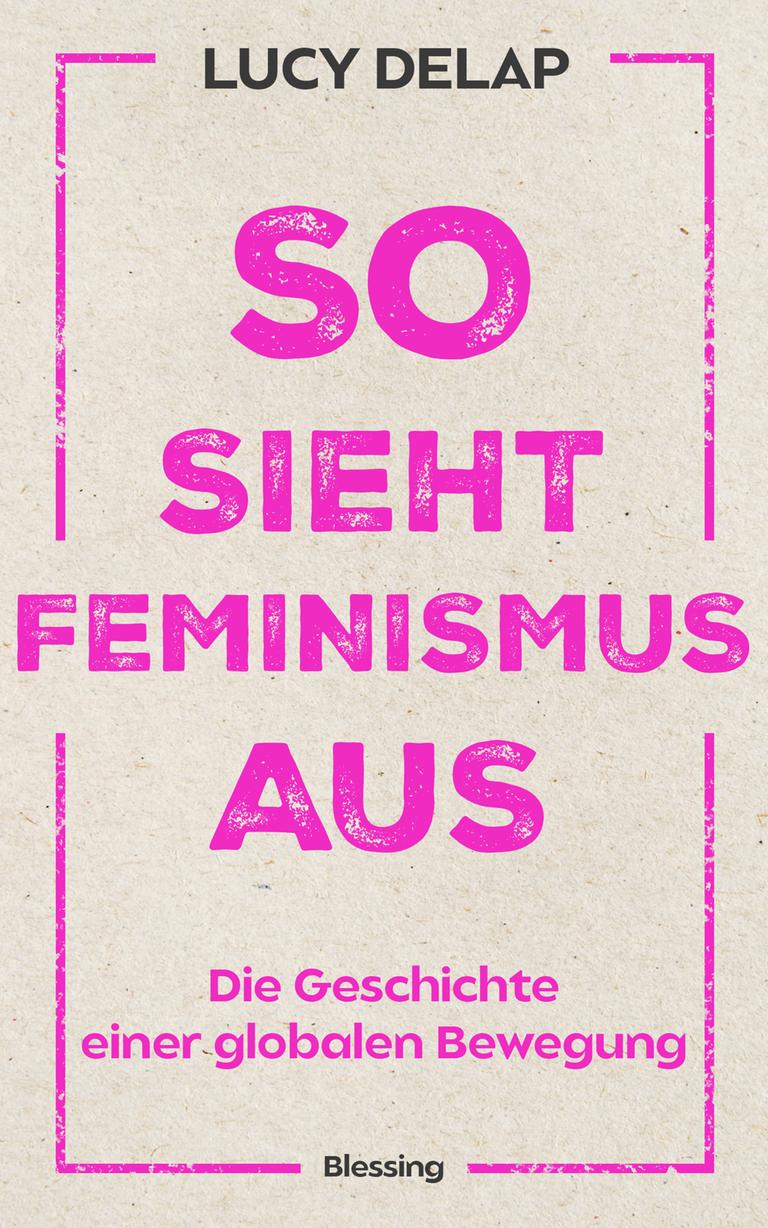
Lucy Delap
Aus dem Englischen übersetzt von Alexandra Hölscher
So sieht Feminismus aus. Die Geschichte einer globalen BewegungBlessing, München 2022448 Seiten
22,00 Euro
Wie wurde Feminismus im Laufe der Zeit inszeniert, geträumt und gelebt? Die britische Historikerin Lucy Delap zeigt uns den Kampf für Frauenrechte als weltweites, lebendig-vernetztes und gleichzeitig von deutlichen Unterschieden geprägtes Mosaik des Denkens, Fühlens und Handelns.
Wer das neue Buch von Lucy Delap aufschlägt, muss erst einmal den plakativen deutschen Titel überwinden: „So sieht Feminismus aus“. Das strahlt platte Selbstgewissheit aus - und ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was die britische Historikerin und Cambridge-Professorin in ihrem Buch plastisch und dreidimensional auf die Bühne bringt.
Kreuz und quer durch die Jahrhunderte
Das zeigt sich schon im Inhaltsverzeichnis, das Kapitel ankündigt, die schillernd „Träume“, „Räume", „Klänge“, „Konzepte“ oder „Gefühle“ heißen. In jedem davon wandert Lucy Delap auf eine Weise durch die Geschichte des Feminismus, wie es bislang zwischen zwei Buchdeckeln populärwissenschaftlich noch nicht zu lesen war. Souverän bewegt sich die Autorin nicht nur kreuz und quer durch die Jahrhunderte und die politischen, sozialen, philosophischen und künstlerischen Bewegungen, sondern auch durch die Kulturen und Regionen der Welt.
Patriarchat der Schriftzeichen
So zeichnet Delap minutiös den Kampf chinesischer Frauen um Gleichberechtigung nach. Schon im 19. Jahrhundert befasste sich die Anarchistin und Feministin He-Yin Zhen mit einem Thema, das einhundert Jahre später in das Blickfeld westlicher Frauen gelangen sollte: wie tief patriarchaler Machtanspruch die wirtschaftlichen, sexuellen und psychischen Strukturen der Gesellschaft prägte.
Diese Frau, die sich trotz Heirat weigerte, den Namen ihres Mannes anzunehmen, nahm sogar die Sprache in den Blick und zeigte akribisch, wie frauenverachtendes Denken selbst den chinesischen Schriftzeichen eingeschrieben war. Später, in den 1910er-Jahren, gingen in Shenzhou Aktivistinnen eines Frauenwahlrechtsbündnisses auf die Straße, um gleiche Rechte für alle Menschen zu fordern, und stürmten in Nanjing die chinesische Nationalversammlung, wo sie die männlichen Redner mit lauten Parolen übertönten.
Sprechchöre und Totenklagen
Dem Tönen der Frauen – einem reichhaltigen Erbe an Reden, Liedern und Songs, Sprechchören und Totenklagen – widmet Delap sogar ein ganzes Kapitel. Bevor es Lautsprecher und Mikrofone gab, hatten Frauen es oft schwer, mit ihren Stimmen Säle zu füllen. Ohnehin wurden ihre Stimmen selten gehört.
Anna Julia Cooper, 1858 in den USA noch als Sklavin geboren, erhob ihre Stimme laut und dachte gleichzeitig über diesen Akt nach. 1892 publizierte sie das Buch „A Voice from the South“, dessen Kapitelüberschriften sie mit musikalischen Begriffen versah: In „Soprano Obligato“ ging es um das Frausein, in „Tutti Ad Libitum“ um Rassismus. Insbesondere schwarze Frauen, so unterstrich sie, würden zum Verstummen gebracht. Dieses Schweigen, die stimmlose Leere gelte es wahrzunehmen.
Kraftvoll und differenziert
Lucy Delap gelingt es, auf einer einzigen Seite über nigerianische Feministinnen, indische Vordenkerinnen der Frauenbefreiung und europäische Suffragetten zu schreiben, ohne je undifferenziert oder vereinnahmend zu werden. In ihrem kraftvollen Buch kann sie zeigen: Feminismus gibt es nur im Plural – als weltweites, lebendig-vernetztes und gleichzeitig von deutlichen Unterschieden und Abgrenzungen geprägtes Mosaik des Denkens, Fühlens und Handelns.