Luise Rinser: "Ein Mensch eigener Art"
Sollte man Luise Rinser lieber dem Vergessen überlassen? Um es vorwegzunehmen: Die Antwort muss nein lauten. José Sánchez de Murillo Biograf, der sich schon im Vorwort als Freund der 2002 Gestorbenen zu erkennen gibt, entfaltet ein schillerndes Persönlichkeitsspektrum einer allzu menschlichen Heldin.
Luise Rinser sollte in jeder Schule behandelt werden: als warnendes Beispiel für die atemberaubende Verdrängungsleistung einer ehrgeizigen und nicht untalentierten Frau - und mit ihr einer ganzen Generation von Deutschen:
"Literarisch hoch begabt, leidenschaftlich am Leben interessiert, schwärmerisch, anerkennungsbedürftig, großzügig, doch auch autoritär, jähzornig, geltungssüchtig, opportunistisch …"
Ihre Reisen stilisierte Luise Rinser gerne als Mission – und sich als die Auserwählte. In ihrem "Nordkoreanischen Reisetagebuch" schreibt sie:
"Weil ich mich vor sechs Jahren auf das Abenteuer der Südkorea-Reise eingelassen habe, muss ich jetzt das Abenteuer der Nordkorea-Reise auf mich nehmen. Muss ich? Offenbar ist mir das schicksalhaft gesetzt."
Es ist nicht schwer, Luise Rinser für eine Nervensäge zu halten. Mit ihrer unterschwelligen Eitelkeit und mahnend erhobenem Zeigefinger macht sie es ihren Kritikern leicht. Das gilt auch für ihren Umgang mit der eigenen Vergangenheit im Dritten Reich, über die sie verlauten ließ:
"Ich war ja schon 1932 gegen den Nationalsozialismus, und das sage ich heute nicht etwa, weil ich gerne möchte, dass es so gewesen sei". "
Die Chuzpe, mit der Rinser hier log, ist bemerkenswert. Tatsächlich war sie eine glühende Nazi-Anhängerin mit Leitungsfunktion im "Bund Deutscher Mädel", sie gehörte dem NS-Lehrerbund und der NS-Frauenschaft an.
" "Kühl, hart und wissend ist dies wache Geschlecht, / Nüchtern und heiliger Trunkenheit voll, / Tod oder Leben, ein Rausch, gilt uns gleich - / Wir sind Deutschlands brennendes Blut."
So dichtete Rinser 1935 in der Zeitschrift "Herdfeuer". Nicht gerade typisch für eine angebliche Widerstandskämpferin. Als die Verse in den 70er-Jahren bekannt wurden, war Rinser längst zur Jeanne d’Arc der deutschen Friedensbewegung aufgestiegen und mächtig pikiert über die unliebsame Enthüllung. Sie klagte gegen die Bezeichnung "Nazi-Poetin", unterlag aber vor Gericht.
Auch ihr Biograf durfte im Gespräch mit ihr das Thema Drittes Reich nie anschneiden. Dennoch verschweigt er die braunen Flecken nicht und fördert sogar noch Unappetitlicheres zutage: Die stramme NS-Lehrerin denunzierte sogar ihren jüdischen Schulleiter.
Nach 1945 habe sich Rinser in den "Dienst der Menschheit und der sozialen Gerechtigkeit" gestellt, schreibt reichlich wohlwollend ihr Biograf. Ihre 1981 erschienene Autobiografie "Den Wolf umarmen" ist auf weiten Strecken eine schlichte Umkehrung der Tatsachen, wie Sánchez de Murillo detailliert aufzeigt. Als BDM-Führerin und feurige Hobby-Propagandistin hat Luise Rinser im Dritten Reich auch mit dem Wolf getanzt.
Ihr Biograf will dennoch nicht als Ankläger auftreten, sondern bemüht sich um Verständnis für den Menschen Luise Rinser. Er sieht in ihrer Autobiografie eine Heldensage à la Jeanne d’Arc und hält der Autorin zugute, sich diese Heldenvita auch unter dem Druck ihrer öffentlichen Rolle erdichtet zu haben.
"Sich selbst stellte Luise Rinser gern als Heldin dar. Doch auch sie war nur ein Mensch. Ein Mensch eigener Art allerdings, eine ungewöhnliche Frau. Zu ihrer Wesensart passt das Wort "Unbedingtheit". Alles Halbherzige war ihr ein Gräuel."
Unwillkürlich denkt man an Michael Wildts epochale Studie über die "Generation der Unbedingten", jener 30-Jährigen, gebildeten und fanatischen Männer, die in Heydrichs Reichssicherheitshauptamt dem Dritten Reich ergeben dienten. An der Tragödie dieser talentierten, aber fehlgeleiteten jungen Deutschen hat auch Rinser teil, glaubt man ihrem Biografen:
"Denn erschütternd wie leider so oft bei Gestalten des deutschen Geisteslebens zeigt sich bei Luise Rinser, was das Dritte Reich angerichtet hat. ... Der brutalste Krieg aller Zeiten hat nicht nur Städte zerstört und Millionen unschuldiger Menschen getötet. Er hat ebenso viele geistig und moralisch Verstümmelte hinterlassen, die ihr Unglück den Nachkommen weitergaben. Viele Menschen, die damals die Einsicht verloren hatten und später wiedergewannen, fanden nicht mehr aus den Irrwegen heraus. Es fehlte ihnen der Mut zum Bekenntnis – auch weil der gesellschaftliche Rahmen dafür nicht bestand und selbst heute noch nicht gegeben ist."
Man denke nur an Walter Jens oder Dieter Wellershoff, die ihre spät bekannt gewordene NSDAP-Mitgliedschaft immer abgestritten haben. Die Debatte um die SS-Mitgliedschaft von Günter Grass bestätigt auch die Vermutung von Sanchez de Murillo, dass selbst heute der "gesellschaftliche Rahmen" noch nicht gegeben ist, um der Verdrängung durch offenes Bekenntnis ein Ende zu setzen.
Doch man muss sich hüten, Grass mit Rinser zu vergleichen: Der Autor von "Blechtrommel"und "Hundejahre" hat sich nie als Held stilisiert. Er hat sich zwar spät, aber aus eigenem Antrieb zu seiner SS-Mitgliedschaft bekannt. Sein jugendlicher Sündenfall hat ihn zeitlebens gegen Versuchung und Verblendung autoritärer Macht gefeit. Luise Rinser hingegen erklärte noch in den 80er-Jahren einen brutalen Gewaltherrscher wie Kim Il Sung zu einem großen Kinderfreund:
"Die Kinder hier haben ihr Glück einem einzigen Mann zu verdanken. Er hat ihnen dieses Kinderparadies geschaffen. Ihm allein sind sie Dank schuldig. Wem sollten die Kinder im Westen danken. Dem Staat? Wer ist das?"
Das schrieb die spätere Bundespräsidentenkandidatin Rinser nach dem Besuch einer ziemlich schäbigen Dorfschule, wo ihr eine Schulklasse vorsang: "Wir sind glücklich, wir leben im Paradies."
Wer sich noch einmal so verführen lässt, hat offensichtlich nichts gelernt. Nicht einmal mutiger Widerstand war hier von der erfolgreichen Bestsellerautorin gefragt, sondern Skepsis, Kritik, vielleicht auch einfach Skrupel. Dass sie diese trotz der Erfahrung ihrer eigenen Verführbarkeit auch später nicht aufbrachte, ist die bittere Lektion dieser Biografie.
José Sánchez de Murillo: "Luise Rinser. Ein Leben in Widersprüchen"
Verlag S. Fischer, Frankfurt/2011
"Literarisch hoch begabt, leidenschaftlich am Leben interessiert, schwärmerisch, anerkennungsbedürftig, großzügig, doch auch autoritär, jähzornig, geltungssüchtig, opportunistisch …"
Ihre Reisen stilisierte Luise Rinser gerne als Mission – und sich als die Auserwählte. In ihrem "Nordkoreanischen Reisetagebuch" schreibt sie:
"Weil ich mich vor sechs Jahren auf das Abenteuer der Südkorea-Reise eingelassen habe, muss ich jetzt das Abenteuer der Nordkorea-Reise auf mich nehmen. Muss ich? Offenbar ist mir das schicksalhaft gesetzt."
Es ist nicht schwer, Luise Rinser für eine Nervensäge zu halten. Mit ihrer unterschwelligen Eitelkeit und mahnend erhobenem Zeigefinger macht sie es ihren Kritikern leicht. Das gilt auch für ihren Umgang mit der eigenen Vergangenheit im Dritten Reich, über die sie verlauten ließ:
"Ich war ja schon 1932 gegen den Nationalsozialismus, und das sage ich heute nicht etwa, weil ich gerne möchte, dass es so gewesen sei". "
Die Chuzpe, mit der Rinser hier log, ist bemerkenswert. Tatsächlich war sie eine glühende Nazi-Anhängerin mit Leitungsfunktion im "Bund Deutscher Mädel", sie gehörte dem NS-Lehrerbund und der NS-Frauenschaft an.
" "Kühl, hart und wissend ist dies wache Geschlecht, / Nüchtern und heiliger Trunkenheit voll, / Tod oder Leben, ein Rausch, gilt uns gleich - / Wir sind Deutschlands brennendes Blut."
So dichtete Rinser 1935 in der Zeitschrift "Herdfeuer". Nicht gerade typisch für eine angebliche Widerstandskämpferin. Als die Verse in den 70er-Jahren bekannt wurden, war Rinser längst zur Jeanne d’Arc der deutschen Friedensbewegung aufgestiegen und mächtig pikiert über die unliebsame Enthüllung. Sie klagte gegen die Bezeichnung "Nazi-Poetin", unterlag aber vor Gericht.
Auch ihr Biograf durfte im Gespräch mit ihr das Thema Drittes Reich nie anschneiden. Dennoch verschweigt er die braunen Flecken nicht und fördert sogar noch Unappetitlicheres zutage: Die stramme NS-Lehrerin denunzierte sogar ihren jüdischen Schulleiter.
Nach 1945 habe sich Rinser in den "Dienst der Menschheit und der sozialen Gerechtigkeit" gestellt, schreibt reichlich wohlwollend ihr Biograf. Ihre 1981 erschienene Autobiografie "Den Wolf umarmen" ist auf weiten Strecken eine schlichte Umkehrung der Tatsachen, wie Sánchez de Murillo detailliert aufzeigt. Als BDM-Führerin und feurige Hobby-Propagandistin hat Luise Rinser im Dritten Reich auch mit dem Wolf getanzt.
Ihr Biograf will dennoch nicht als Ankläger auftreten, sondern bemüht sich um Verständnis für den Menschen Luise Rinser. Er sieht in ihrer Autobiografie eine Heldensage à la Jeanne d’Arc und hält der Autorin zugute, sich diese Heldenvita auch unter dem Druck ihrer öffentlichen Rolle erdichtet zu haben.
"Sich selbst stellte Luise Rinser gern als Heldin dar. Doch auch sie war nur ein Mensch. Ein Mensch eigener Art allerdings, eine ungewöhnliche Frau. Zu ihrer Wesensart passt das Wort "Unbedingtheit". Alles Halbherzige war ihr ein Gräuel."
Unwillkürlich denkt man an Michael Wildts epochale Studie über die "Generation der Unbedingten", jener 30-Jährigen, gebildeten und fanatischen Männer, die in Heydrichs Reichssicherheitshauptamt dem Dritten Reich ergeben dienten. An der Tragödie dieser talentierten, aber fehlgeleiteten jungen Deutschen hat auch Rinser teil, glaubt man ihrem Biografen:
"Denn erschütternd wie leider so oft bei Gestalten des deutschen Geisteslebens zeigt sich bei Luise Rinser, was das Dritte Reich angerichtet hat. ... Der brutalste Krieg aller Zeiten hat nicht nur Städte zerstört und Millionen unschuldiger Menschen getötet. Er hat ebenso viele geistig und moralisch Verstümmelte hinterlassen, die ihr Unglück den Nachkommen weitergaben. Viele Menschen, die damals die Einsicht verloren hatten und später wiedergewannen, fanden nicht mehr aus den Irrwegen heraus. Es fehlte ihnen der Mut zum Bekenntnis – auch weil der gesellschaftliche Rahmen dafür nicht bestand und selbst heute noch nicht gegeben ist."
Man denke nur an Walter Jens oder Dieter Wellershoff, die ihre spät bekannt gewordene NSDAP-Mitgliedschaft immer abgestritten haben. Die Debatte um die SS-Mitgliedschaft von Günter Grass bestätigt auch die Vermutung von Sanchez de Murillo, dass selbst heute der "gesellschaftliche Rahmen" noch nicht gegeben ist, um der Verdrängung durch offenes Bekenntnis ein Ende zu setzen.
Doch man muss sich hüten, Grass mit Rinser zu vergleichen: Der Autor von "Blechtrommel"und "Hundejahre" hat sich nie als Held stilisiert. Er hat sich zwar spät, aber aus eigenem Antrieb zu seiner SS-Mitgliedschaft bekannt. Sein jugendlicher Sündenfall hat ihn zeitlebens gegen Versuchung und Verblendung autoritärer Macht gefeit. Luise Rinser hingegen erklärte noch in den 80er-Jahren einen brutalen Gewaltherrscher wie Kim Il Sung zu einem großen Kinderfreund:
"Die Kinder hier haben ihr Glück einem einzigen Mann zu verdanken. Er hat ihnen dieses Kinderparadies geschaffen. Ihm allein sind sie Dank schuldig. Wem sollten die Kinder im Westen danken. Dem Staat? Wer ist das?"
Das schrieb die spätere Bundespräsidentenkandidatin Rinser nach dem Besuch einer ziemlich schäbigen Dorfschule, wo ihr eine Schulklasse vorsang: "Wir sind glücklich, wir leben im Paradies."
Wer sich noch einmal so verführen lässt, hat offensichtlich nichts gelernt. Nicht einmal mutiger Widerstand war hier von der erfolgreichen Bestsellerautorin gefragt, sondern Skepsis, Kritik, vielleicht auch einfach Skrupel. Dass sie diese trotz der Erfahrung ihrer eigenen Verführbarkeit auch später nicht aufbrachte, ist die bittere Lektion dieser Biografie.
José Sánchez de Murillo: "Luise Rinser. Ein Leben in Widersprüchen"
Verlag S. Fischer, Frankfurt/2011
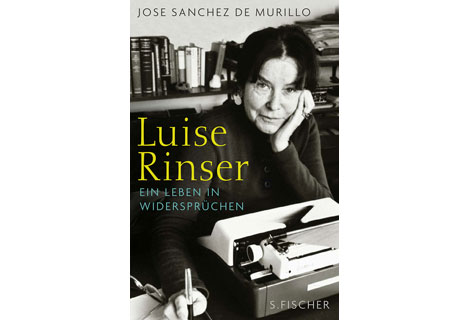
Cover: "Luise Rinser. Ein Leben in Widersprüchen"© Verlag S. Fischer
