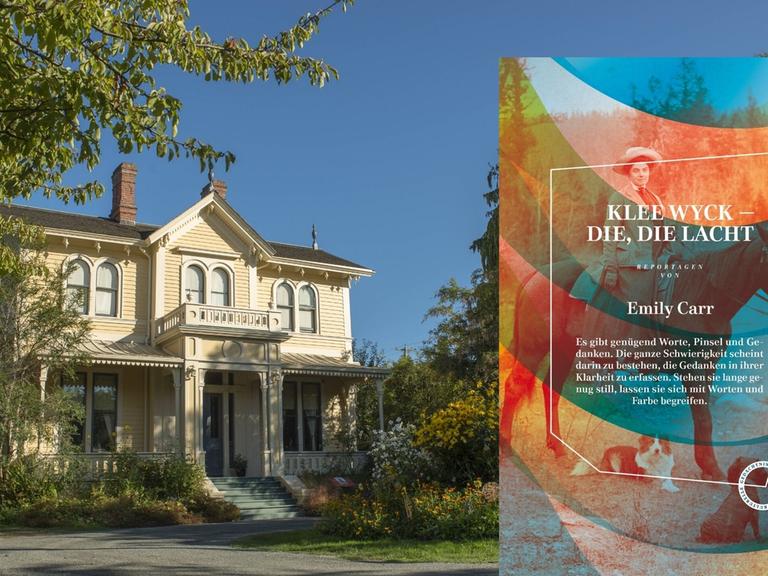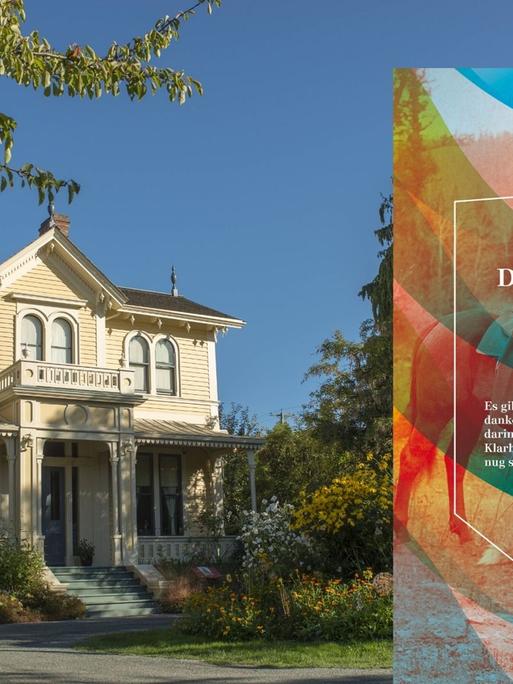Manuel Menrath: "Unter dem Nordlicht. Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land"
Galiani, Berlin 2020
480 Seiten, 26 Euro
Kanadas unerzählte dunkle Geschichte
05:30 Minuten

Manuel Menrath zeichnet in "Unter dem Nordlicht" ein bestechend detailliertes Bild des Lebens der indigenen Völker Kanadas. Es ist eine Geschichte von Tod, Entwurzelung und kulturellem Verlust. Dabei kommen die Ureinwohner selbst ausführlich zu Wort.
Die Cree und Ojibwe im hohen Norden, etwa 45.000 Menschen, haben sich 1973 zu einer politischen Organisation, der Nishnabe Aski Nation, zusammengeschlossen. Manuel Menrath nimmt für seine Forschung Kontakt zu deren Vertretern auf, wird in ihre Dörfer eingeladen, die nur mit Kleinflugzeugen oder im Winter über Eisstraßen zu erreichen sind, und lässt sich auf eine behutsame Reise in die Historie und Lebensrealität der kanadischen Ureinwohner ein.
Tod, Entwurzelung und kultureller Verlust
Es ist eine Geschichte, die von Tod, Entwurzelung und kulturellem Verlust erzählt. Lebten vor Beginn der europäischen Einwanderung etwa sieben bis 15 Millionen Indianer in Nordamerika, wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Kanada noch etwa 125.000 und in den USA noch 237.000 von ihnen gezählt. Eingeschleppte Krankheiten, Landverlust, Hungersnöte und gezielter Ethnozid waren dafür verantwortlich.
Die Indianer nahmen die Weißen auf, lehrten sie das Überleben in den unwirtlichen Regionen und trieben Handel mit ihnen. Doch damit begann – wie Aktivisten berichten – der Umbruch. Denn der Handel hatte bei den Cree und den Ojibwe einen anderen Stellenwert – man tauschte notwendige Dinge, aber nicht um einen Mehrwert zu erzielen. Auch kannten sie kein Eigentum an Land. Es wurde von allen genutzt.
Land gmeinschaftlich nutzen
Und so fußten auch die folgenden Verträge zwischen ihnen und den Europäern auf einem jeweils unterschiedlichen Rechtsverständnis. In Verträgen sagten die Indianer zwar zu, das Land zu teilen, meinten das aber im Sinne einer gemeinsamen Nutzung, nicht eines geteilten Eigentums. Die Verträge setzten die Weißen auf – in ihrer Sprache, unverständlich für die Indianer. Bis heute resultiert der Reichtum Kanadas aus den Bodenschätzen im ehemaligen Indianergebiet.
1876 zwang dann der Indian Act die kanadischen Ureinwohner in Reservate und diskriminierte sie per Gesetz. Sie sollten in der neuen, sich europäisch verstehenden Gesellschaft aufgehen. "Töte den Indianer, aber rette den Menschen" war das Motto des Ethnozids. Sie wurden zwangsweise umgetauft, die Kinder wurden ihnen entrissen und in sogenannte Residential Schools gebracht, wo sie ihrer Kultur entfremdet und oft seelischen und körperlichen Missbrauch erlitten.
Menrath hört und notiert erschütternde Schicksale: von Kindern, die sich selbst umbrachten, Kindern, die flüchteten und auf der Flucht starben, Kindern, die früh drogensüchtig wurden.
Eine andere Geschichte Kanadas
Manuel Menrath beschreibt das ungeschönt und nachvollziehbar, er erzählt eine andere Geschichte Kanadas, die die das Image eines landschaftlich wilden, schönen Landes mit netten Umgangsformen deutlich erweitert. Und er weiß auch zu berichten, dass auch die heutige Regierung Kanadas und die weiße Mehrheitsgesellschaft ihrer Verantwortung immer noch nicht gerecht wird.
Dabei spricht Menrath in seinem Buch, wenn er nicht die konkreten Völker benennt, durchgehend von "Indianern". Er ist sich der Problematik dessen durchaus bewusst, benennt aber Gründe: zur Unterscheidung der Cree und Ojibwe von den weiter nördlich lebenden Inuit und weil für ihn Indianer den geringsten kolonialen Beiklang hat. Nicht vergleichbar mit dem englischen Wort "indians", was ja letztlich Inder bedeutet.
"Native Americans" referiert auf einen Begriff, der von den Kolonialisten stamme (Amerika), und Bezeichnungen wie "first nations" oder "first people" würden zahlreiche indianische Menschen nicht akzeptieren, denn sie seien nicht zuerst, also vor den Weißen, gekommen, sondern in Nordamerika erschaffen worden, erklärt er.
Ein beeindruckendes Stück Geschichtsschreibung
Entstanden ist so ein erschütterndes Buch, das hilft eine nötige Lücke im Selbstverständnis der Kanadier zu schließen und das dank der mehr als 100 Interviews mit Cree und Ojibwe ein beeindruckendes Stück Geschichtsschreibung ist.
Oral History at ist best. Denn der Autor, den sie bald Wemistigosh, den Holzbootmenschen nennen, nimmt sich wohltuend zurück und lässt jede Erzählung für sich stehen. Ein gelungener Einstieg in die Geschichte des Landes, das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist, ist so entstanden.