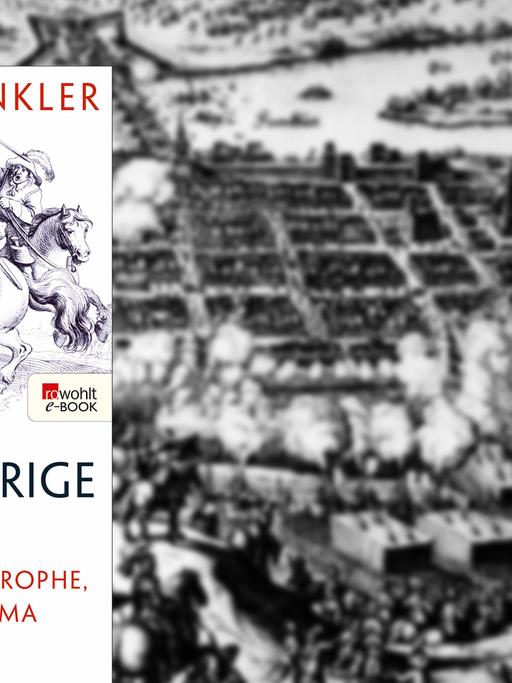Marina und Herfried Münkler: "Abschied von Abstieg – Eine Agenda für Deutschland"
Rowohlt Berlin, 2019
512 Seiten, 24 Euro
Alle reden vom Untergang – wir nicht!
18:34 Minuten

Marina und Herfried Münkler gehen in ihrem Buch "Abschied vom Abstieg" den derzeit kursierenden Erzählungen vom Niedergang der Gesellschaft auf den Grund. "Untergangserzählungen haben einen ästhetischen Zauber", sagen sie - und wollen dem Konstruktives entgegensetzen.
Christian Rabhansl: Haben Sie eine Erklärung bei der Recherche für das Buch dafür gefunden, warum sich so viele Menschen vor dem Abstieg fürchten, während sie gleichzeitig sagen, mir persönlich geht’s eigentlich besser?
Marina Münkler: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist, zumindest für Ostdeutschland, die reale Depravierungserfahrung, die viele im Osten gemacht haben, die erwartet haben, nach der Wende würde es nun für alle rasant nach oben gehen. Das hat sich nicht bewahrheitet, das ist einer der Gründe.
Der andere Grund ist sicher, dass das Fortschrittsnarrativ relativ empfänglich ist für Irritationen. Also immer, wenn es mal irgendwie stockt, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann gerät dieses Fortschrittsnarrativ in Gefahr, und dann kommt es eben zu solchen Abstiegsnarrativen. Das ist ein eher linkes Narrativ. Das rechte Narrativ ist eher das von Niedergang und Untergang, das im Prinzip das ganze Land eben untergehen sieht und nicht einzelne soziale Schichten.
Typisch linke, typisch rechte Ängste?
Rabhansl: Das sind ja sehr unterschiedliche Ängste. Die typisch linke Angst haben Sie eben geschildert. Haben Sie Beispiele für rechte Niedergangsängste?
Herfried Münkler: Bei der linken Angst ist typisch, dass man seinen Status nicht halten kann oder dass die Aussage 'Unseren Kindern wird’s besser gehen als uns', dass die vermutlich nicht mehr zu sagen ist, weil wir ja in eine Post-Wachstumsgesellschaft eingetreten sind. Das ist auch sicher so etwas wie ein realer Hintergrund.
Die rechte Erzählung ist: Es geht alles nach unten, wir sind kein Volk mehr – man muss das nicht im Detail wiederholen. Man bekommt es ja im Prinzip jeden Tag in irgendeiner Weise aufgetischt. Nun meinen wir aber, das sind Dramatisierungen von Erfahrungen, die sich verselbstständigt haben und die letzten Endes als große Abstiegsängste und auch als Niedergangsbefürchtungen kluges politisches Handeln verhindern.

Marina und Herfried Münkler nehmen sich die Bereiche Bildung, Demokratie und Europa vor und geben Perspektiven, welche Handlungsschritte jeweils notwendig sind.© Rowohlt Berlin
Rabhansl: Wenn wir auf die politische Wirkmächtigkeit schauen, bevor wir aufs Handeln kommen, habe ich den Eindruck, dass diese linken Abstiegsängste den linken Parteien, also der SPD oder der Linkspartei, nicht wirklich helfen, wohingegen die rechten Abstiegsängste der AfD momentan massiv Wählerstimmen zuspülen. Sind rechte Abstiegsängste wirkmächtiger?
Marina Münkler: Ja, weil sie eben keine Abstiegsängste sind, sondern Niedergangs- und Untergangsprophezeiungen, und deren Kraft hat sich ja letzten Endes in den 20er-Jahren bereits gezeigt. Da gibt es auch eine nicht unmittelbare Verbindung, aber eine Ähnlichkeit mit der Situation in den späten 20er-Jahren. Bei den linken Abstiegsängsten muss man sich diejenigen, die davon betroffen sind, zurechnen. Bei den rechten Niedergangserzählungen ist es eigentlich so, dass man sich selbst in die Position bringt, man habe schon verstanden, was nur die anderen noch nicht kapiert hätten, nämlich dass es wirklich, wenn wir so weitermachen würden, dazu kommen würde. Und im Hintergrund dessen findet sich dann die Erzählung von entweder – wie das bei Spengler war – Cäsarismus oder diese Vorstellungen von irgendwelchen großen Führern, die dann die große Umkehr bewirken. Von daher haben diese rechten Untergangsnarrative eine bestimmte Perspektive, die Leute anzieht.
Rabhansl: Sie haben den Namen Spengler genannt mit "Der Untergang des Abendlandes" vor ziemlich genau hundert Jahren. Und beim Lesen Ihres Buches entsteht der Eindruck, es ist ein sehr drängendes Buch über die Gegenwart. Aber solche Namen machen deutlich: Eigentlich neu ist das alles nicht, oder?
"Beschreibungen von Untergängen hat es immer gegeben"
Herfried Münkler: Solche Beschreibungen von Untergängen, Niedergängen gewissermaßen als Warnschilder hat es immer gegeben – vor Spengler das berühmte Buch von Edward Gibbon im späten 18. Jahrhundert über den Niedergang des Römischen Reichs, auch geschrieben natürlich aus der Sorge eines Engländers, wie das mit dem Imperium weitergeht, nachdem die Neuengland-Kolonien, also die nachmaligen USA, abgesprungen sind.
Und das ist eigentlich so etwas wie die Blaupause für relativ viele anschließende Niedergangserzählungen. Also: Der lange Frieden, der die Menschen verweichlicht, das Hereindrängen der Barbaren – also wenn ich mal großzügig bin, letzten Endes von unseren Vorfahren – in den Bereich des Römischen Reiches, Dekadenzerzählungen. Ich glaube, es war der frühere Außenminister Westerwelle, der auch mal den Begriff der spätrömischen Dekadenz in irgendeinem Zusammenhang gebraucht hat.
Das sind Erzählungen, in denen immer so ein Körnchen auch Wahrheit ist im Hinblick auf das, was an Vergangenheit erzählt wird und was an Gegenwart beobachtet wird, die aber im Prinzip ein großes Angebot darstellen, disparate Erfahrungen der Zeit so zusammenzufassen, dass man plötzlich weiß, wie alles werden wird. Und das ist dann eine Katastrophe.
Michel Houellebecq, Prototyp des Untergangsliteraten
Rabhansl: Was ich sehr schön an dem Buch finde, ist, dass sehr deutlich wird, dass Untergangsszenarien, egal wie überzogen sie sind, keine Sache für simple Gemüter sind. Sie haben jetzt gerade schon etliche Intellektuelle genannt, es gibt auch ein kleines Unterkapitel zu Michel Houellebecq. Ist er der Prototyp des Untergangsliteraten?
Marina Münkler: Na ja, er ist schon so eine Art von Untergangsprophet, denn seine Vorstellung – und die hat sehr viel mit Dekadenzvorstellungen zu tun – ist, dass die Westeuropäer im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage sind, miteinander wirklich zu kommunizieren. Das sind eigentlich alles scheiternde Beziehungen, wenn man überhaupt Beziehungen sieht, viele existieren ja gar nicht. Es ist eine große Vereinsamung, von der er erzählt, und er füttert das permanent an mit Gesellschaftsbeobachtungen.
Man könnte auch sagen, Houellebecq beschäftigt sich in seinen Erzählungen viel mit der Obsession des Sex in der europäischen Gesellschaft, aber das ist eigentlich ein Oberflächenphänomen. Das hat etwas damit zu tun, dass man nur noch auf gewisse Reize reagiert und ansonsten nicht mehr beziehungsfähig ist.
Und dieses Nicht-beziehungsfähig-Sein, das macht einen dann in Houellebecqs Erzählungen anfällig für Gemeinschaften und deren Herrschaftsambitionen, die beziehungsfähig sind und ein Ziel haben. Und das ist für ihn der Islam. Das wird deutlich, am deutlichsten sicherlich in seinem Buch "Unterwerfung" ("Soumission"), aber es kennzeichnet insgesamt sein Erzählen. Übrigens hat Houellebecq vor zwei oder drei Jahren den Spengler-Preis verliehen bekommen.
"Anfällig für Gemeinschaften und deren Herrschaftsambitionen"
Herfried Münkler: Bei Houellebecq liegt so etwas wie eine rechtskatholische Einstellung unten drunter. Im Prinzip äußert er gelegentlich die Hoffnung, eine rechtskatholische Wende könnte die Rettung sein, also gegen den Islamismus einen fanatischen Katholizismus zu setzen, und beschreibt dann in seinen Romanen, wie das scheitert, weil wir das nicht mehr inbrünstig glauben. Man könnte sagen, bei Houellebecq ist die Vorstellung eines Kampfes eigentlich im weiteren Sinne der Religionen – oder der Zivilisationen, hätte Huntington gesagt – im Hintergrund. Aber er traut es den Europäern nicht zu, und deswegen beschreibt er, wie alles scheitert und untergeht.
Rabhansl: Sie haben vorhin angedeutet, dass manche dieser Abstiegsängste, die Sie zwar für überzogen halten, dass die aber trotzdem irgendwie so ein Kern, so einen Anlass haben, der ja durchaus in der Realität besteht. Und Sie schreiben auch, Deutschland und Europa hätten Probleme, wirklich große Probleme. Sie haben aber nicht den Eindruck, dass Untergangsszenarien der nötige Tritt in den Hintern sind für Europa und Deutschland, diese Probleme anzugehen. Sondern Sie halten sie für gefährlich. Warum gefährlich?
Herfried Münkler: Ja, ich glaube, Untergangsszenarien und auch Abstiegsdramatisierungen sind gerade nicht der von Ihnen sogenannte Tritt in den Hintern, jedenfalls der Anstoß, etwas zu ändern. Sondern sie führen entweder dazu, dass man in Apathie verfällt, weil sowieso nichts zu machen ist. Oder aber dass man in Hektik verfällt und eine Betriebsamkeit an den Tag legt, die entweder viele politische Fehler macht, weil sie nicht durchdacht ist, oder aber sich starken politischen Führern – es können auch gerne Führerinnen sein – in die Hände wirft in der Erwartung, die werden das schon machen. Und das ist dann natürlich auch das Ende der politischen Ordnung, demokratisch, rechtsstaatlich, liberal, wie wir sie kannten.
Entwerfen Sie nicht auch ein eigenes Untergangsszenario?
Rabhansl: Damit zeichnen Sie die Gefahr schon sehr deutlich, Sie warnen also vor Untergangsszenarien, aber ehrlich gesagt, irgendwie entwerfen Sie doch selber eines.
Marina Münkler: Nein, das kann man so nicht sagen. Der entscheidende Punkt an solchen Untergangsnarrativen ist eigentlich zum einen ihr dramatisierendes Potenzial, dann aber auch, dass sie immer irgendwelche Gruppen dämonisieren, denen die Schuld zugewiesen wird für diesen Untergang. An so was beteiligen wir uns nun wahrlich nicht, sondern ganz im Gegenteil: Wir wollen aufzeigen, was passiert, wenn man solche Niedergangs- und Untergangsszenarien anhängt. Es entsteht daraus so etwas wie eine Fundamentalkritik, die nicht mehr eine Kritik an einzelnen Aspekten ist, wie wir das selbst machen, sondern eine Fundamentalkritik, die im Grunde genommen so etwas wie Umsturzfantasien auslöst. Und das ist das, was der rechte Diskurs auch tatsächlich propagiert.
Herfried Münkler: Ich würde es gern noch mal zuspitzen: Diese Untergangserzählungen haben ja einen ästhetischen Zauber. Houellebecq beispielsweise ist ja ein viel gelesener Autor, und Oswald Spengler hat es doch immerhin mit einem relativ schlechten Buch geschafft, nach wie vor in aller Munde zu sein. Also diesen Zauber des Niedergangs und des Untergangs, der Dekadenz auch aufzulösen, ist zunächst mal in den ersten beiden Kapiteln des Buches die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, und wir haben schon die Hoffnung, dass es klappt.
"Man kann nicht jeden Satz miteinander diskutieren"
Rabhansl: Dann kommen wir zum Zauber des Abschieds eben vom Abstieg, wie das Buch heißt. Sie entwerfen auch Lösungswege.
Herr Münkler, Sie sind Politikwissenschaftler, lange Jahre Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, Sie Frau Münkler sind Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Dresden. Wie haben Sie denn zusammengearbeitet?
Marina Münkler: Im Grundsatz kann man sagen: Einer schreibt ein Kapitel vor und der andere schreibt sich rein. Und das bedeutet dann, dass man relativ frustrationstolerant sein muss, also man muss dann mit Gelassenheit zugucken, wie der andere anfängt wegzustreichen und was anderes hinzuschreiben. So geht das aber dann ein paar Mal hin und her, und am Schluss hat man dann einen fertigen Text. Aber einer muss die Anfangsüberlegung machen, man kann nicht jeden Satz miteinander diskutieren und sagen, wollen wir das jetzt so schreiben oder wollen wir das so schreiben – da bräuchte man Jahrzehnte, bis man so ein Buch fertig hätte. Aber so kann man das ganz gut machen.
Herfried Münkler: Und zu dem Leben am Schreibtisch gehört auch noch der Spaziergang im Vorfeld. Wir gehen dann an der Havel entlang oder irgendwo im Wald spazieren, und da werden bestimmte Überlegungen gemeinsam ventiliert im Gespräch, sodass also derjenige, der vorschreibt, gewissermaßen das nicht aus seinem eigenen hohlen Bauch heraus tun muss, sondern sich beziehen kann auf Überlegungen, die hin und her geflogen sind. Und das sinnvollerweise nicht am Schreibtisch sitzend, da ist man zu starr und kann zu wenig aufeinander zugehen und Abstand nehmen und auch mit Gesichtern sozusagen viel ausdrücken.
Rabhansl: Sie sehen sich aber auch nicht nur am Schreibtisch und beim Spazierengehen, Sie sind auch verheiratet. Macht es das leichter oder schwerer, die Zusammenarbeit?
Herfried Münkler: Ach, wissen Sie, wenn man so lange verheiratet ist wie wir, dann gibt es sozusagen neben dem Spazierengehen und dem Schreibtisch vielleicht noch den Esstisch, sonst wüsste ich jetzt nicht viel.
Rabhansl: Dann wird da überall gearbeitet, ja.
Marina Münkler: Ja, im Grunde schon.
Fridays for Future als Augenblicksblase der Erregung?
Rabhansl: Das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist, ist eben diese "Agenda für Deutschland". Also was sollen wir tun, was steht auf dieser Agenda?
Marina Münkler: Wir haben uns zu drei Problemen geäußert. Das hätte sicher beispielsweise mit dem Klimawandel noch andere Probleme gegeben, die man hätte thematisieren können. Aber das, was uns besonders interessiert hat, weil es da auch besonders viele Abstiegs- und Niedergangsnarrative gibt, ist einmal der Bereich der Bildung, dann die Frage der Demokratie und von Europa. Das sind die drei Kapitel, in denen wir versuchen, so etwas wie eine Agenda zu entwickeln.
Rabhansl: In der Tat, Sie haben jetzt gerade schon den Klimawandel angesprochen, das hab ich mich nämlich gefragt: Warum diese drei und warum nicht zum Beispiel Klima, Jobs, Menschenrechte? Was eint die drei?
Herfried Münkler: Wir hatten im Hintergrund schon die Vorstellung, dass das, wo wir ansetzen, wirklich agenda-fähig sein muss. Und wenn man über Demokratie und Kapitalismus oder Globalisierung des Kapitalismus spricht, dann kann man viele kritische Sachen äußern, aber es kommt am Schluss im Hinblick auf wirkliches Handeln nicht viel raus. Wie lange das mit Greta Thunberg und "Fridays for Future" sein wird, muss man erst mal sehen. Da wollten wir ein bisschen Abstand halten gewissermaßen zu diesen Augenblicksblasen der Erregung, ohne dass konkret gesagt werden kann, was zu tun ist.
Rabhansl: Und Sie werden tatsächlich recht konkret. Also zum Beispiel beim Thema der Erneuerung der liberalen Demokratie, da wollen Sie ganz neue Teilhabe-, Partizipationsformen. Was ist Ihr Plan?
Marina Münkler: Unsere Idee ist, dass man repräsentative Demokratie vertiefen muss und dass man mehr Mitbestimmungsrechte, Mitwirkungsrechte schaffen muss und dass die Lösung nicht die plebiszitäre Demokratie ist. Das ist ja das, was von rechts jetzt – erstaunlicherweise, könnte man auf den ersten Blick sagen, aber dann eben doch nicht so erstaunlich – gespielt wird. Man bräuchte viel mehr Volksabstimmungen. Aber Volksabstimmungen sind tatsächlich eher dazu geeignet, auf Polarisierung zu setzen, und das können Sie jetzt am Brexit schön beobachten, was dabei rauskommt.
Rabhansl: Weil es immer nur ein Ja oder Nein gibt.
Marina Münkler: Es gibt nur ein Ja oder Nein. Und das, was wir eigentlich wollen, ist, dass Leute vor Ort, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene – denn deren Austrocknung begreifen wir als ein zentrales Problem für die Demokratie –, dass man auf der kommunalen Ebene mitarbeiten kann, dass man Projekte machen kann, dass Bürger kooperieren können, darin auch lernen, dass man Kompromisse machen muss, und dass sie aber tatsächlich auch Entscheidungskompetenzen und auch Gelder, über die sie verfügen können, zugewiesen bekommen sollen.
Rabhansl: In Bürgerkomitees, wie komme ich da rein?
Herfried Münkler: Ja, das ist sozusagen unsere Idee, nämlich durch das Los. Der große Aristoteles hat mal die Überlegung angestellt, die Wahl sei eigentlich ein aristokratisches Verfahren, weil sie ja in Ansehung der Person und ihrer Würdigkeit erfolge, wohingegen das Los, das im Hinblick auf den Gelosten blind ist, das eigentlich demokratisch egalitäre Verfahren ist. Nun, das ist eine lange angestellte Überlegung, der wir uns da auch bedienen, aber vor allen Dingen geht es darum, die Eckensteher und ewigen Herumschimpfer und Motzer aufzulösen. Und da haben wir gedacht, na gut, also wenn man lost, dann erwischt man in ganz anderer Weise einen Querschnitt der Bevölkerung und konfrontiert sie mit der Zumutung, Antworten geben zu müssen auf Fragen.
Rabhansl: Wir können jetzt das, was Sie da empfehlen und entwerfen, natürlich nur streifen. Aber wenn man jetzt vielleicht schon überrascht war, dass sie Bürgerkomitees auslosen wollen, dann ist man auch im zweiten Teil überrascht, wenn es um die Bildung geht, wo Sie nämlich ein Vorbild entdecken in einem Schulsystem, das vielen als ideologisch gilt und damit überhaupt nicht als Vorbild, nämlich im DDR-Schulsystem.
"Das eingliedrige Schulsystem der DDR wurde sehr schnell aufgelöst"
Marina Münkler: Ja, das ist nicht unser einziges Vorbild, aber …
Rabhansl: Nein, aber das überraschende.
Marina Münkler: Wir sind davon ausgegangen, dass man zunächst einmal nicht 2019 ein Buch über Bildungsprobleme in der Bundesrepublik schreiben kann oder ein Kapitel, in dem das Schulsystem der DDR nicht vorkommt. Denn eine interessante Sache, muss man doch sagen, gab es für das Bildungssystem der DDR: das einzige Schulsystem auf deutschem Boden, das es mit einer eingliedrigen Schule versucht hat, die so schlecht nicht funktioniert hat. Also grundsätzlich kann man sagen, und das konnte man schnell merken, wenn man in den 90er-Jahren unterrichtet hat an der Universität, dass es sich zeigte, dass die Schüler, die aus DDR-Schulen kamen, gut gebildet waren. Das waren keine ungebildeten Schüler, obwohl sie eine gemeinsame Beschulung hatten.
Das ist schon wert, dass man dieses Bildungssystem auch würdigt, auch unter dem Aspekt, was passiert ist mit der Wiedervereinigung, dass nämlich sehr schnell dieses eingliedrige Bildungssystem in der DDR aufgelöst worden ist und dass man das Gymnasium quasi null Komma nichts dorthin gebracht hat. Und das verhindert aber ein wenig den angemessenen Blick darauf, dass das Problem unseres Schulsystems nicht ganz oben ist. Also die Frage, ob humanistisches Gymnasium oder nicht, das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, das wir lösen müssen, ist, dass wir 14 Prozent funktionale Analphabeten aus den Schulen herausbringen, dass es Schulen gibt, in denen man meint, Schüler könnten überhaupt nichts lernen. Das kann nicht akzeptiert werden.
Rabhansl: Das sind jetzt zwei kleine Bausteinchen gewesen für die Agenda, einmal für die Demokratie, dann für die Bildung, für Europa haben wir jetzt schon gar keine Zeit mehr. Ganz am Ende schreiben Sie dann, der Abschied vom Abstieg, der gründet auf Zuversicht und Zukunftswillen, und beides seien wirklich knappe Ressourcen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass dieser Abschied trotzdem gelingt?
Herfried Münkler: Zuversichtlich.
Rabhansl: Sie sind zuversichtlich.
Herfried Münkler: Ja, beide, ja.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.