Mario Rausch: "Hermann de Carinthia – ein Leben für die Wissenschaft. Eine Biographie"
Wieser Verlag, Klagenfurt 2020
220 Seiten, 21 Euro
Mittelalterkitsch in fiktiven Gelehrtenbriefen
07:28 Minuten
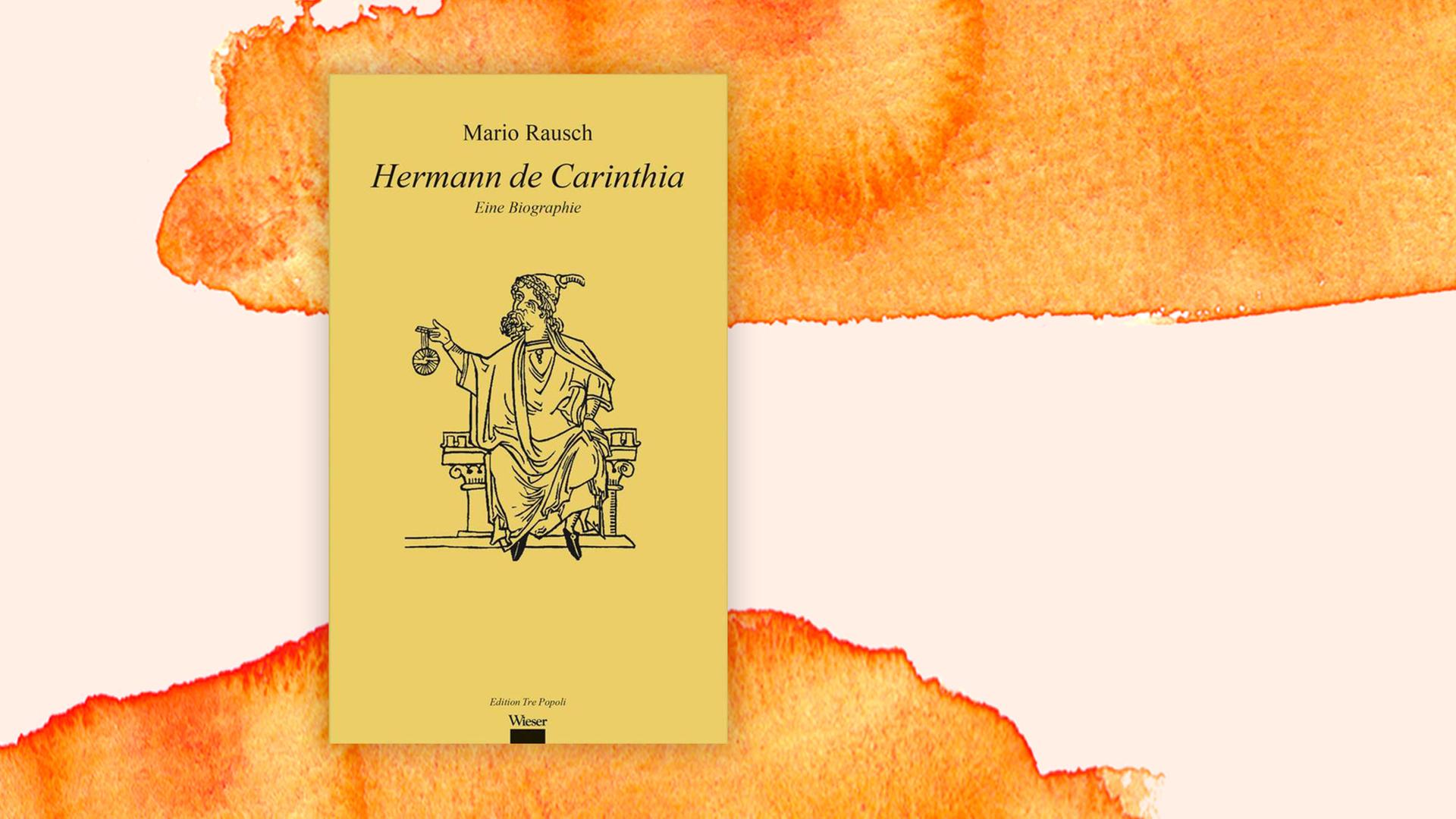
Hermann de Carinthia war ein Gelehrter des Mittelalters, der den Weg zur Renaissance mit ebnete. Ein Mensch, der Stoff für einen spannenden, vielschichtigen Roman geboten hätte. Mario Rausch hat diese Chance in seinem Briefroman nicht genutzt.
Um 1100 wurde Hermann de Carinthia im heutigen Kroatien geboren, beherrschte etliche Sprachen und bereitete durch seine Übersetzungen, unter anderem von Korantexten, die Renaissance mit vor. Soweit die etwas dürre Informationslage, die unsere Rezensentin Gesine Palmer zu einer Vermutung verleitet: "Machen Sie daraus einen Text, der die Jugend anspricht!"
Das scheint in etwa die Aufgabenstellung gewesen zu sein, die der Kärntener Club "Tre Popoli", der sich der Versöhnung des slawischen, romanischen und deutschen Kulturraums verschrieben hat, dem Autor Mario Rausch auftrug.
Herausgekommen ist ein Buch, das die erwachsene Leserin schon im Titel merkwürdig anweht: "Ein Leben für die Wissenschaft. Eine Biographie". Auf den Titel folgen zwei nicht wirklich authentifizierte Briefzitate und ein etwas hollywoodartiger "Prolog", der mit dem Satz endet: "Das Leben dieser Übersetzer, ihre wagemutigen Reisen zu den Wissenszentren Europas und des Orients und ihre eigenständigen Gedanken offenbaren sich nur durch ihre Schriften. Hermann war einer von ihnen, und dies ist seine Geschichte."
Biografie als fiktiver Briefroman
Und dann wird diese Geschichte in der sehr künstlich wirkenden Form eines Briefes an seinen Schüler Rudolph von "Hermann selbst" erzählt. Es handelt sich also um eine fiktionale Autobiografie in Anlehnung an das, was über eine historische Gestalt bekannt ist.
Anfänglich bereits dadurch verstimmt, dachte ich dann: "Na gut, kann man ja machen." Und dann habe ich das wirklich alles gelesen: 24 Kapitel auf 150 Seiten, dazu ein Schlusswort, einen Epilog und 113 teils ausführliche Anmerkungen. Das ist an sich nicht viel.
Aber man könnte mit dieser Textmenge einiges machen. Tatsächlich macht Rausch auch einiges. Das erste, was er macht, nachdem er sich einmal für die unglückliche Briefform entschieden hat, ist, dass er alle Reisen des Hermann nachvollzieht. Die Reiseziele sind also das nächste strukturierende Element des Stoffes. Das ist historiografisch sinnvoll und nötigt der Leserschaft Respekt ab – nicht nur für die Reiseleistung des Hermann, sondern auch für die städtebaulichen und kriegerischen und zivilisatorischen Errungenschaften des Mittelalters.
Fast war ich sogar mit der Genrebezeichnung "Biographie" versöhnt, als ich in den Anmerkungen immer wieder Sätze las, in denen der Verfasser freimütig bekennt, er habe sich die Freiheit genommen, beispielsweise Andrea dei Tomasi einfach 100 Jahre früher auftreten zu lassen. Die Idee, eine gut dokumentierte zeitnahe Figur illustrierend als Reisebekanntschaft auftreten zu lassen, passt jedenfalls ganz gut in das Bio-Pic-Verfahren, das hier sozusagen malerische "Butter bei die Fische" geben will. Solange das wenigstens in den Anmerkungen ordentlich klargestellt wird, will ich es sogar mit einer gewissen Sympathie durchgehen lassen.
Altertümelnde Prosa tarnt Patriarchatskitsch
Das täte ich freilich weitaus lieber, wenn dann das Textcorpus auch in sich eine überzeugende Gestalt hätte. Die hat es aber leider nicht. Schnell bekommt die Leserin das Gefühl, es solle ihr in der maßvoll altertümelnden Prosa etwas unter die Jacke gejubelt werden, was eher aus der Mottenkiste irgendeiner mittelmäßigen und definitiv vor allem in der Gegenwart beheimateten Gesinnungserziehung stammt und sich anscheinend das mittelalterliche Gewand nur zunutze macht.
Da ist zunächst und gleich zu Beginn auffällig etwas, das ich nur als Patriarchatskitsch bezeichnen kann. Hermann stellt sich als Produkt aus der Verbindung eines adeligen Herren und seiner Dienstmagd vor. Und er betont sofort fromm, wie echt die Zuneigung zwischen den Eltern gewesen sei, und wie sehr Hermann deswegen immer in der Nähe und unter der Protektion des verehrten und unerreichbaren Vaters gestanden habe. Die Botschaft? Geht doch! Nicht jeder Dienstmädchenmissbrauch hat schlimme Folgen, manchmal wird wenigstens der Sohn gut versorgt, und davon hat dann auch die Kindsmutter etwas.
Noch deutlicher wird die Sache, wenn Hermann wohlmeinend den besorgten vermuteten westeuropäischen Leserinnen und Leser ein paar Erklärungen zu den pädagogischen Gepflogenheiten in den mittelalterlichen Klöstern gibt: "Auch wenn die Stunden in der Regel abwechslungsreich und interessant gestaltet waren, gab es natürlich immer wieder Phasen, in denen uns Jungen die Aufmerksamkeit schwer wurde und wir uns den einen oder anderen Streich ausdachten. Wenn Frater Bruno dahinterkam und die Schuldigen erkannte, setzte es Schläge, die ihm aber in keiner Weise Freude bereiteten, sondern einfach zum Schulalltag gehörten."
Der Gelehrte braucht Prostituierte, keine Ehefrau
Ich bitt Sie! Und weiter geht es mit der Spiegelung des etwas prätentiös daherkommenden Jünglings in einem anderen, natürlich auch sehr edelsinnigen "echten" (also ehelich geborenen) Aristokraten. Der Männerfreundschaft zu Robert von Ketton, die dem Autor erlaubt, über weite Strecken in Wir-Form zu berichten, entspricht die brüllende Abwesenheit weiblicher Subjekte: Hermann gibt zu, dann und wann durch den Gebrauch von Prostituierten "die Bedürfnisse seines Fleisches" zu befriedigen, freut sich aber, dass sein "ungezügelter Wissensdurst und Hunger nach Gelehrsamkeit" ihm ein Leben in "bürgerlicher Zweisamkeit ersparen".
Wirklich. Das steht da. Und da ist eben nicht nur der Anachronismus bis zum Quietschen ausgereizt, da geht auch der Patriarchatskitsch nahtlos in Wissenschaftskitsch über.
Wandernde Männerbünde
Nun könnte man dennoch fragen: Wie soll man denn heutigen Menschen vermitteln, dass auch im "finsteren Mittelalter" nicht alles Hauen und Stechen und Verbrennen war, sondern dass es "echte Gelehrsamkeit" gab?
Vielleicht braucht es ein von modernen Mittelaltermärkten und entsprechenden Filmen vertrautes "Im Jahre des Herren", vielleicht braucht es wandernde Männerbünde mit verendenden Packpferden, unschuldige Knaben zwischen rauen Burschen, die sich mit Latein irgendwie über die Alpen schlagen und in Bronze gegossene nackte Frauen aus dem Urmutterbereich, in deren Leiber die Namen der Künstler eingeritzt sind. Immerhin scheint dieses halb vertrauliche, halb fremd bleibende Hermann-Ich das Interesse an der Gelehrtenwelt jener Epoche wecken zu können, in der Juden, Christen und Muslime stellenweise nebeneinander lebten und voneinander lernten, mochten sie sich an anderen Orten auch bekriegen.
Dennoch bleibt als vornehmlicher Leseindruck, dass es sich hier um eine Auftragsarbeit und eine falsche Perspektivwahl nach Art eines zweckgebundenen Story-Tellings handelt. So wird das, was man an Patriarchats- und Wissenschaftskult einem alten Text vielleicht noch verzeihen würde, bei einem halbherzig geschriebenen Gegenwartstext eben einfach zum Kitsch. Und das verzeihe ich nur ungern.






