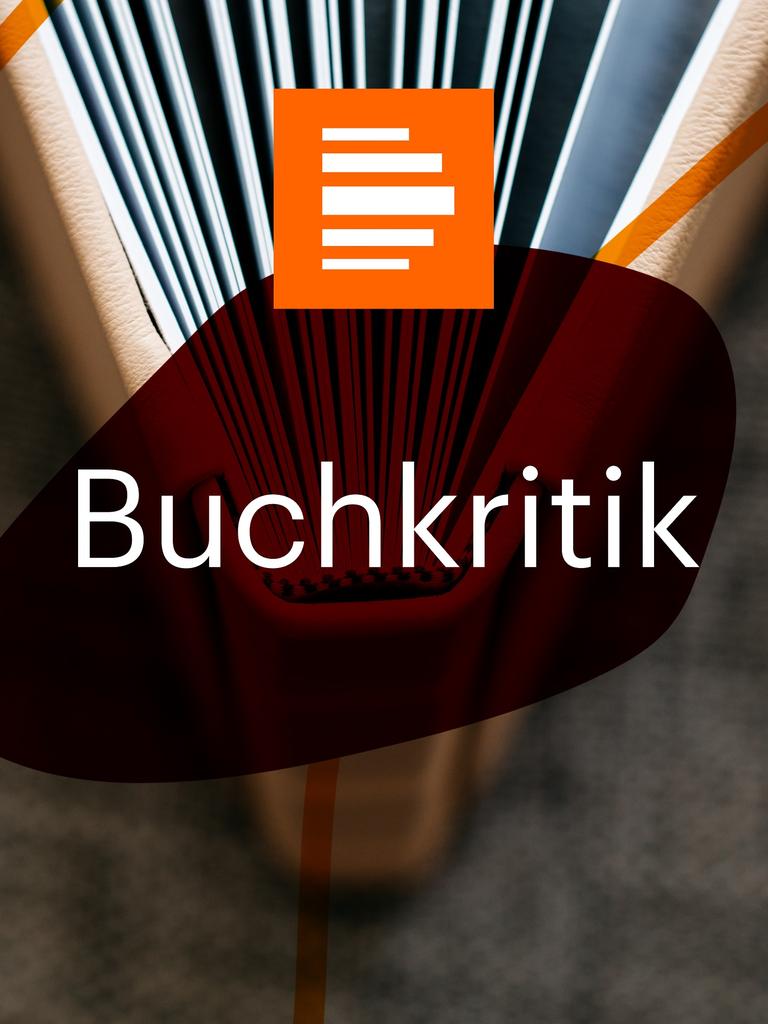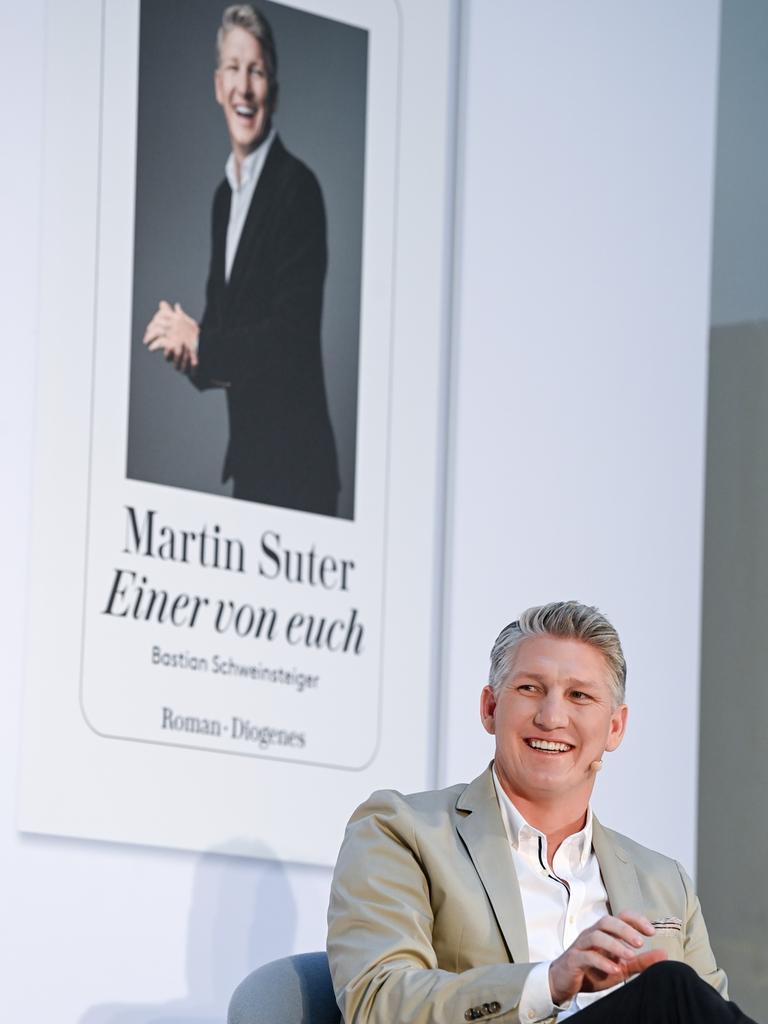„Ich suche mir einen mit Geld. Solange ich noch schön bin.
[...] Ich weiß, ich klinge wie eine Bitch. Und weißt du, warum? [...] Weil ich eine bin.“
Martin Suter: „Wut und Liebe“
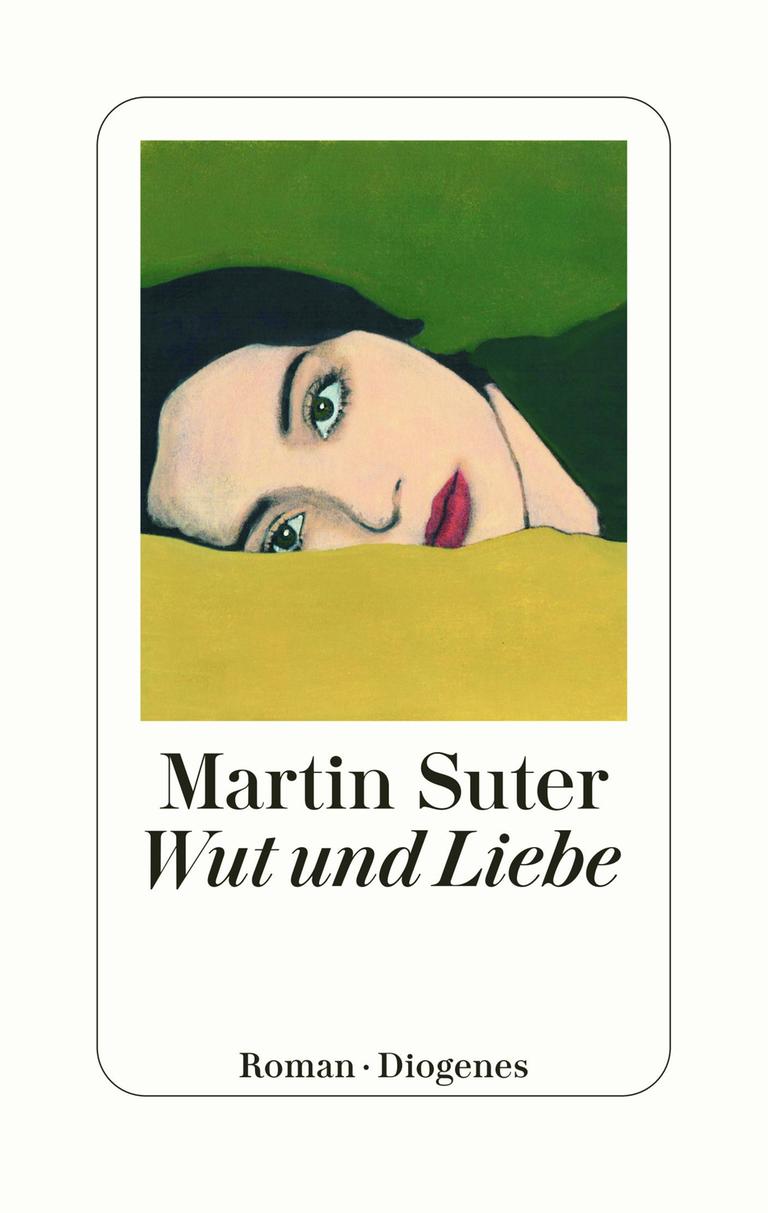
© Diogenes Verlag
Darauf einen Dujardin!
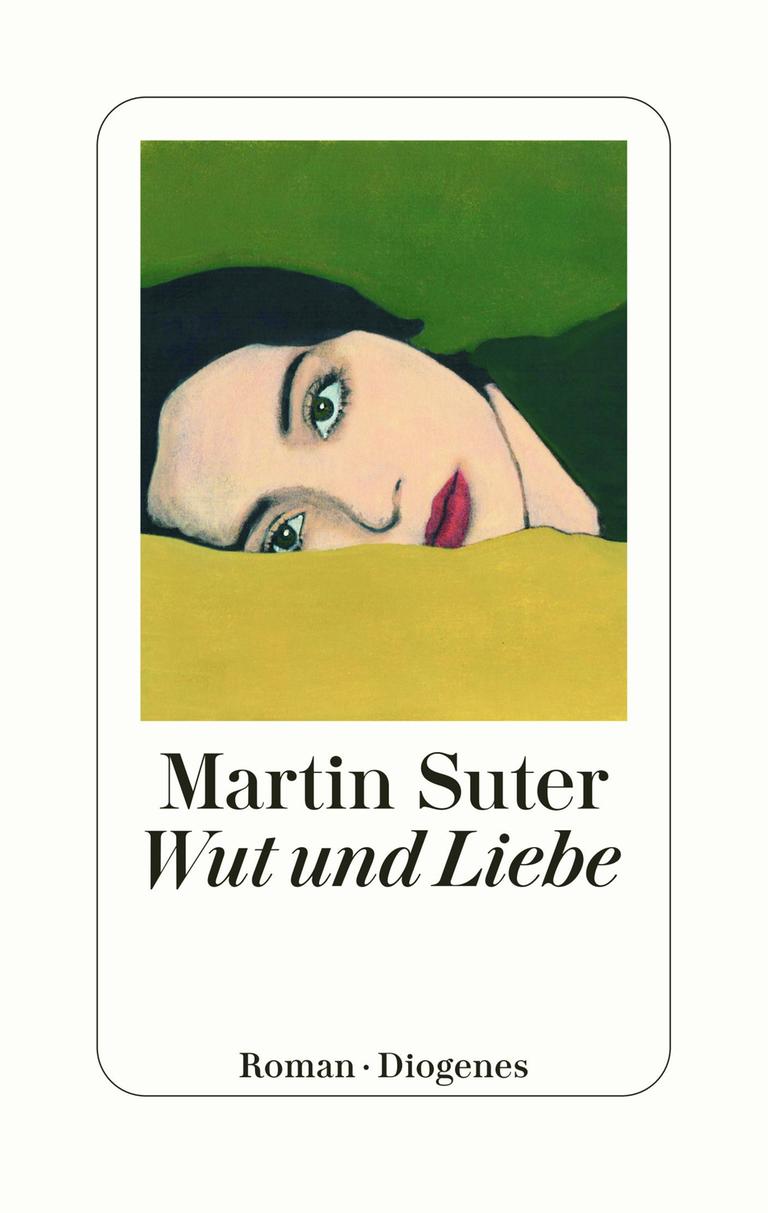
Martin Suter
Wut und LiebeDiogenes Verlag, Zürich 2025304 Seiten
26,00 Euro
Der junge Künstler Noah und die bittere Witwe Betty sind zwei der Hauptfiguren in Martin Suters neuem Roman „Wut und Liebe“. Noah kämpft um seine Liebe, Betty hat ihre längst verloren. Und dann gehen die beiden einen Pakt ein.
Dürfen wir Ihnen etwas zu trinken anbieten? Einen trockenen Weißwein, vielleicht, einen Aperol oder ein Glas Sekt? Wie, Sie hätten lieber Champagner? Willkommen in der Welt von Martin Suters neuem Roman „Wut und Liebe“. Hier werden Mojitos gereicht, eine halbe Flasche Schampus folgt auf die nächste, mitunter helfen Grappa, Ouzo oder eine kleine Flasche Bordeaux.
Das alles ist, wie stets bei Martin Suter, von einer ausgesuchten Qualität und einem feinen Blick für die Ausstattung jeder Bar. Trotz aller Distinktion gibt es nun „Wut und Liebe“. Wütend ist die betagte Witwe Betty Hasler, deren Mann sich erst krumm- und dann totgearbeitet hat. Verliebt ist hingegen der weitgehend erfolglose Künstler Noah Bach, der zu Beginn von seiner Freundin Camilla erfährt, dass sie ihn verlassen will. Warum? Sie liebt ihn zwar, nicht aber das dürftige Leben mit ihm. Den Bordeaux begehrt sie mehr als ihn. Zuhause sein möchte sie in der Welt des - Pardon - schwerreichen Martin Suter.
Dialoge und passende Orte
Dialoge bestimmen Suters „Wut und Liebe“, stellen ihn somit vor die Aufgabe, passende Orte für eben diese Dialoge zu suchen: Bars, Cafés und Restaurants. So wird sowohl gesoffen als auch auf das Feinste gekocht, gegessen, getafelt. Und zwar nicht nur daheim, sondern ebenso im Café Schmidlin, dem Arvenstübli, der Cafébar „Easy“, im Ristorante Azzuro, im Gourmetrestaurant Chez Vous, im gerade eröffneten Japaner „Meshiagare“ und so weiter und so fort.
Ein zentraler Platz ist das Lokal „Die blaue Tulpe“, in dem der gerade geschasste Noah die ältere Betty Hasler kennenlernt. Also die Witwe, deren Mann angeblich unter der Last seiner Arbeit verstorben ist:
„Die Geselligen kamen in Cliquen, die offensichtlich jeden Abend um diese Zeit hier den Tag ausklingen ließen. In der Überzahl Männer, die die Rückkehr ins Familienleben noch etwas hinauszögern mussten, um die Frustrationen des Tages loszuwerden. Die Einsamen waren über ihre Smartphones gebeugt und tranken systematischer als die Geselligen, aber nicht weniger. Betty und der junge Mann schienen die Einzigen zu sein, die einfach nur dasaßen und ihren Gedanken nachhingen. Bei Betty wurden die schönen immer mehr von den anderen verdrängt, den traurigen, den beängstigenden und den hasserfüllten. Die traurigen waren noch die besten.“
Widersprüchliche Gedanken
Noah Bach versucht also in der „Blauen Tulpe“, den Kummer über jene selbsternannte Bitch zu ertränken, die ihn gerade verlassen hat. Und die Witwe Betty Hasler, das wird man im Verlauf erfahren, hängt durchaus widersprüchlichen Gedanken nach. Unterm Strich trauert sie um ihren Ex-Mann Pat, der sich in der mit seinem Kompagnon Pete Zaugg gegründeten Unternehmensberatung mehr oder minder zu Tode gearbeitet hat. Denkt Betty. Und lobt eine Million für den Tod Zaugg aus. Warum dann Noah mitmacht – der Leser wundert sich.
Dass Kompagnon Zaugg gegen Ende des Romans auch ohne Fremdeinwirkung seinem Tod entgegenstrebt, hat weniger mit seiner unterstellten Bösartigkeit zu tun als mit dem Umstand, dass die Unternehmensberatung Dreck am Stecken hat. Stichwort Panama Papers. Und mit einer Liebschaft mit der früheren Chefbuchhalterin der Firma, Gerda Simon.
„Sie war eine dieser Frauen, die so älter wurden, wie Camilla das einst auch gerne würde. Sie war schlank, ihr Teint von der Sonne verschont, die halblangen Haare in einem Brünett, dem man nicht ansah, dass es gefärbt war, das Make-up sorgfältig, aber diskret, das Kostüm von klassischem Schnitt, und sie trug ein Parfum, das Camilla nicht kannte, aber gerne roch.“
Schicke Oberflächlichkeit
Auch wenn der Autor hier die Betrachtung der weiblichen Schönheit in den Mund der anderen weiblichen Schönheit Camilla legt – Martin Suter hat’s halt gerne nett. Und so sehr sich dieser Roman auch flott wegliest, ist das doch alles von einer schicken Oberflächlichkeit, die allerdings keine Tiefe verbirgt.
In „Wut und Liebe“ haben Noah und Camilla am Ende wenig gewonnen. Die Witwe Betty hat sich manches anders überlegt, was die junge Camilla zu folgendem Urteil und den Autor zu einem Schluss verführt, der auch dem großen Harmonie-Experten Erich Kästner hätte einfallen können.
„‚Miststück’, half Camilla.
Sie stützte sich auf und streichelte Noah lange über Stirn und Haar.
‚Ich habe auch eine Nachricht.’
Sie machte eine Pause.
‚Noch eine schlechte?’ Er wartete. ‚Sag schon.’“
Wir sagen es an dieser Stelle nicht. Es ist verzichtbar. So wie das komplette Buch keine zwingende Lektüre ist. Mal wieder also kein großer Roman des erfolgsverwöhnten Martin Suter. Vielleicht sollte er sich für das nächste Buch etwas mehr Zeit nehmen, so als geduldiger Schweizer? Wir würden glatt einen ausgeben. Vielleicht einen doppelten Dujardin.