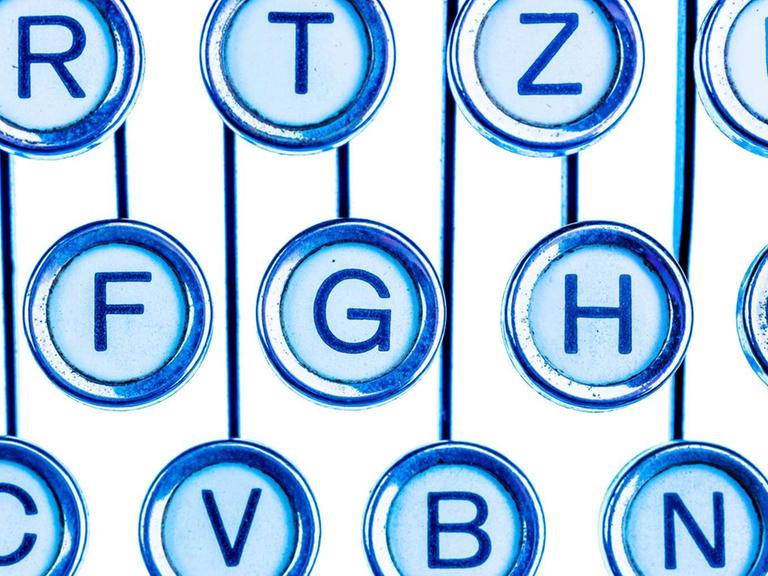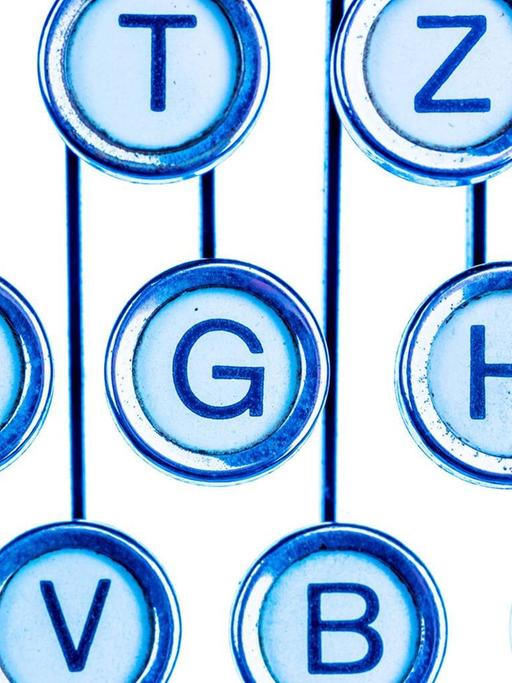"Die Erregungskultur, die wir erzeugt haben, ist toxisch"

Die Diskussionskultur im Internet ist an einem "Tipping-Point", sagt der Zukunftsforscher Matthias Horx. Prominente und Jüngere würden sich von der US-Plattform Facebook "entnervt" abwenden und andere Austauschformen suchen.
Die "digitale Revision" sei nötig, so der Publizist, Unternehmensberater und Gründer des "Zukunftsinstituts" in Frankfurt am Main, weil "viele Menschen durch Facebook und Twitter in einer Blasenwelt leben und sich permanent selbst bestätigen in ihrem Hass, in ihren Abneigungen". Das heißt auch, dass die Offenheit der Internetrevolution aus den Anfangsjahren vorbei sei. "Wenn ein Medium in solcher Weise für Hass zu missbrauchen ist, dann hat es auch als öffentliches Medium keine Zukunft, weil es die Gesellschaft zerstört."
Besserwisser und Hasstiraden hätten das Netz übernommen. Dadurch sinke das öffentliche Interesse und das Vertrauen. Das sei aber die Basis jeglicher menschlicher Kommunikation. "Ohne Vertrauen kann man sich nur gegenseitig anschreien." Dadurch drehe man sich letztlich im Kreis und werde auf Dauer nicht mehr gehört.
"Die narzisstischen Überzeichnungen sorgen dafür, dass sich das Netz von innen in die Luft sprengt und dann werden aus den Trümmern diejenigen, die eine achtsame Kommunikation miteinander betreiben, die wirklich etwas diskutieren möchten, das wieder aufbauen."
Das Interview im Wortlaut
Deutschlandradio Kultur: Unser Gast heute ist Matthias Horx. Er wird gemeinhin als Trendforscher beschrieben, weil er vor 18 Jahren in Frankfurt am Main das "Zukunftsinstitut" gegründet hat, eine Art Denkfabrik, die sich Gedanken über die künftigen Entwicklungen in vielen Gesellschaftsbereichen macht. Die gewonnenen Erkenntnisse referiert Matthias Horx regelmäßig gegenüber Verantwortlichen in Wirtschaft, Medien und Politik. Und nun wollen wir mit ihm über unsere digitale Zukunft sprechen. – Guten Tag, Herr Horx.
Matthias Horx: Guten Tag.
Deutschlandradio Kultur: Das Entstehungsdatum des Internets, wie wir es heute kennen, das wird gemeinhin mit dem britischen Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee und dem Jahr 1989 verknüpft. Entsprechend ist das Internet mittlerweile 27 Jahre alt. Man könnte sagen, es ist volljährig, aber noch nicht richtig erwachsen, wenn man sich einige Ausdrucksformen in diesem Netzwerk, speziell auch in der Flüchtlingskrise anschaut?
"Da sind wir in eine gewaltige Turbulenz geraten"
Matthias Horx: Ja natürlich. Das Internet ist in einer schweren postpubertären Krise und wird sich zusammenrütteln müssen. Man kann sagen, was wir alles erwartet haben vor 20 Jahren, ich kann mich noch erinnern an die digitale Euphorie, an die Befreiungshoffnungen, die auch damit gekoppelt waren, da sind wir heute in eine gewaltige Turbulenz geraten. Aber das passiert übrigens mit praktisch allen Technologien so, dass sie in eine Krise geraten und sich dann wieder neu regenerieren.
Deutschlandradio Kultur: Sie plädieren jetzt für einen Neustart der Netzwerkkultur. Warum brauchen wir den?
Matthias Horx: Die Versprechungen, die das Internet uns vor zehn, zwanzig, fünfundzwanzig Jahren gegeben hat, sind ja zum großen Teil nicht gehalten worden. Man kann sehen, dass gerade im Bereich der sogenannten "sozialen Medien" heute eher eine Katastrophe herrscht, also eine kognitive und eine kommunikative Katastrophe. Wenn Sie sich heute anschauen, was auf Kommentarseiten auch bei Facebook in der berühmten digitalen Wüste oder im digitalen Dschungel los ist, dann kommen Sie auf die Idee, dass das nicht nachhaltig ist, wie man so schön sagt.
Also, dort wird in einer unglaublichen Art und Weise narzisstisch überzeichnet. Es wird sich gegenseitig niedergemacht, angemacht. Jeder muss irgendwie mitreden. Das führt dazu, dass eigentlich die ganzen Diskurse, die Diskussionen, die man ja haben wollte auch durch das Internet zwischen Bürgern, um Themen, letztendlich zusammenbrechen. Es guckt auch keiner mehr in die Kommentarspalten so richtig rein. Diese Erregungskultur, die wir da erzeugt haben, ist – man kann sagen – toxisch.
Deutschlandradio Kultur: Sie sprechen Kommentare an wie "ab ins Gas" oder "die Schmarotzer sollen verrecken". Das wurde aber auch schon vor Jahrzehnten von Rechtsextremen gesagt im Familien- oder Bekanntenkreis. Was ist jetzt anders geworden durch die Sichtbarkeit im Netz?
Matthias Horx: Es hat eine ganz andere Resonanz. Die Erregungen, die durch die Gesellschaft gehen, sind ja gewissermaßen so wie Epidemien. Die flammen auf. Früher gab es radikale Gegenmeinungen, die letzten Endes dann aber natürlich auch abgekapselt blieben, die nicht so in der Art und Weise zu Wort kamen. Heute leben wir in einer Blasenwelt, in der Menschen sich auch unentwegt selbst bestätigen in ihrem Hass, in ihren Abneigungen.
Das heißt auch, dass die Offenheit, was ja das zentrale Motiv auch dieser Internetrevolution war, eigentlich vorbei ist, also, dass es genau ins Gegenteil gedreht ist. Und wenn ein Medium in der Art und Weise quasi auch für Erregung und für Hass zu missbrauchen ist, dann hat es auch als öffentliches Medium eigentlich keine Zukunft. Dann würde es die Gesellschaft zerstören, wenn man es quasi zum zentralen öffentlichen Schauplatz machen würde.
Das ist heute, glaube ich, der Fall. Wir sind an einem Tipping-Point, wo viele Prominente, wo viele User auch entnervt rausgehen. Wir sehen, dass bei Facebook die Nutzerzahlen besonders bei den Jugendlichen zurückgehen, dass Twitter auch an seinem Zenit angelangt ist. Das sind die typischen Anzeichen für das, was wir die digitale Revision nennen oder den "Digital Backlash".
Deutschlandradio Kultur: Darauf reagiert Facebook. Das US-Unternehmen hat extra für deutsche Hasskommentare jetzt ein paar Mitarbeiter anstellen lassen in Deutschland, die solche Kommentare überprüfen und auch ggf. löschen sollen. Ist das Löschen Teil des Neustarts dieser Netzwerkkultur?
"Vertrauen ist natürlich die Basis überhaupt"
Matthias Horx: Das bringt’s, glaube ich, nicht, weil, wenn man sich mal Ihre Formulierung anschaut, ein paar Mitarbeiter anstellt, das ist nicht die Art und Weise, wie verbindliche Kommunikation entstehen kann, indem wir quasi dann wieder neue Zensurinstanzen einstellen.
Ich glaube, dass der Neustart eher durch eine Katharsis ausgelöst wird, also auch durch ein sich Selbstaushungern. Man kann sagen, das ist ein System, was sich – ähnlich wie die Finanzmärkte übrigens – selbst in die Luft sprengt. Indem die Besserwisser und die Hasstiraden quasi das Netz übernommen haben, sinkt natürlich auch das öffentliche Interesse, sinkt das Vertrauen. Und Vertrauen ist natürlich die Basis überhaupt von menschlicher Kommunikation. Wenn man nicht vertraut, kann man sich eigentlich nur gegenseitig anschreien. Und damit werden auf Dauer diese Elemente von Gegenöffentlichkeit durch Hass langsam austrocknen. Das wird sich dann im Kreis drehen. Und letztendlich, wenn man dann nicht mehr gehört wird, ist es dann auch nicht mehr interessant.
Das Interessante am Internet, was es ja auch so gefährlich und giftig manchmal macht, ist diese ungeheure Nichttrennung, die man hat zwischen sich und der Öffentlichkeit. Also, man kann als einzelne Stimme sich in einer unglaublichen Art und Weise bemerkbar machen oder kann sich die Illusion machen, dass man sich bemerkbar macht. Das führt quasi zu einem narzisstischen Rausch und zu einer Übersteigerung, die das Netz von innen in die Luft sprengt. Dann werden letztendlich aus den Trümmern, aus den Ruinen diejenigen wieder, die eine achtsame Kommunikation miteinander treiben, die etwas wirklich diskutieren möchten, die es ja heute auch noch gibt, dann das – so hoffen wir jedenfalls – übernehmen und wieder aufbauen.
Deutschlandradio Kultur: Die sind auch die Mehrheit, wenn man sich die Zahlen anguckt. Sechs Prozent, das hat der Digitalverband Bitkom in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, aller Internetnutzer in Deutschland haben schon mal einen Hasskommentar verfasst. Und die Menschen, die das regelmäßig machen, sind sicherlich noch sehr viel weniger. Trotzdem hat diese winzige Minderheit sehr viel Gehör gefunden. Warum, glauben Sie, schafft dann die große Mehrheit es nicht, da eine Gegenkultur aufzubauen?
Matthias Horx: Sie können als Einzelner oder als kleine Gruppe, das wissen wir ja auch letzten Endes aus allen Formen von sozialer Revolte und sozialer Rebellion, unglaublich viel quasi in die Luft sprengen. Ich kann mich noch erinnern: In meiner Jugend in den 68er-Jahren konnten Sie mit einem kleinen Trupp einen Hörsaal, in dem ernsthaft diskutiert wurde, sabotieren. Und im Internet ist natürlich das Herdenverhalten noch viel größer. Das heißt, Sie können da relativ schnell irgendwo einbrechen in einen laufenden Diskurs. Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann ist es auf der Ebene von Kommunikation, die – wie gesagt – ja vertrauensbasiert ist, letzten Endes vorbei. Da nützt auch kein Widerstand, auch kein Gegenschreien, wie wir wissen. Es nützt eben auch keine Zensur, sondern das ist ein Fieber, was ausbrennt.
Aber man muss, glaube ich, auch noch die anderen Dimensionen beschreiben, die das Problem darstellen. Es ist ja nicht nur der Hasskommentar. Es ist auch so, dass wir eine narzisstische Überzeichnung haben, die dazu führt, dass Menschen, gerade junge Frauen, in einer extremen Form Selbstdarstellung dort betreiben und dann natürlich auch in die Gefahr des Mobbings geraten. Da gibt es in der letzten Zeit ja viele Fälle, wie diese Stars von Facebook, die dann Millionen von Followern haben, wie die auch öffentlich wieder aussteigen und bereuen und sagen: Das Internet hat an dem Punkt mein Leben kaputtgemacht. Da gab es mehrere Fälle jetzt, zum Beispiel auch bei den Prominenten ganz stark. Die haben früher das Internet auch zu Promotion-Zwecken benutzt, die haben auch die Nase voll.
Wenn die Meinungsführer rausgehen, dann ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass da eine Epoche zu Ende geht.
Deutschlandradio Kultur: Aber noch sind laut ARD/ ZDF-Onlinestudie 19 Millionen Menschen aktiv in Facebook beteiligt. – Also: Rechnen Sie damit wirklich zeitnah, dass da eine große Trendumkehr erfolgt?
"Das fängt an langsam abzuebben"
Matthias Horx: Das sind graduelle Prozesse, die aber manchmal dann sehr schnell passieren können. Wir haben ja auch Erfahrung mit anderen Technologien, die sich schnell entwickelt haben und ziemlich schnell zusammengebrochen sind.
Das zieht sich zeitlich vielleicht über Jahre. Es gibt ja auch viele Menschen, die das sehr vernünftig machen. Gerade die Älteren, die jetzt bei Facebook unterwegs sind, die nutzen dieses Instrument natürlich für sehr ausgewogene soziale Zwecke. Die verfolgen ihre Freundeskreise. Also, man kann mit diesen Instrumenten auch ganz andere Dinge tun.
Aber diese Extremformen, die darin eben aufgetaucht sind, die fangen an sich selbst zu isolieren. Das ist eben nicht mehr ein Strom von Zunahme, sondern das fängt an langsam abzuebben. Und das sieht man besonders bei den Jüngeren, dass die nach einer Weile des exzessiven Gebrauchs von sozialen Medien dann eher wieder andere, balanciertere Medienverhältnisse eingehen. Man kann das auch an den Zahlen sehen. Man kann sehen, dass besonders Facebook bei den Jüngeren bis ungefähr 25, 30 enorme Probleme hat, teilweise in den westlichen Ländern starke Verluste hat. In den Schwellenländern nimmt das noch zu und bei den Älteren und Mittelalten. Das ist, wenn man so will, auch eine Selbstbalancierung des Netzes.
Deutschlandradio Kultur: Bleiben wir noch ein wenig beim Austausch im Internet. Solche schriftlichen Dialoge waren Jahrhunderte der übliche Weg in Briefwechseln. Das war teilweise sehr kunstvoll, wenn sich da große Köpfe der Zeit unterhalten haben. Müssen wir dieses schriftliche Unterhalten nun auch wieder neu lernen, zum Beispiel im Deutschunterricht in der Schule?
Matthias Horx: Zum Beispiel. Das ist im Grunde genommen ja nicht so weit entfernt von klassischen Kulturtechniken, wie Sie richtig sagen. Der entscheidende Unterschied im Netz ist ja die Echtzeit, dass Sie quasi in Echtzeit antworten und dadurch das reflexive Element entfällt. Und wie man weiß, wer in seinem Leben mal verliebt war und Briefe geschrieben hat oder Postkarten, das lebt natürlich darum, dass man nachdenkt, dass man reflexiv an ein Gefühl herangeht oder an einen Sachverhalt. Argumentation ist immer zeitverzögert.
Ich bin momentan eher wieder ein Mailschreiber und nutze Mail eigentlich so, wie man früher Briefeschreiben verwendet hat. Ich antworte selten sofort, sondern meistens erst an einem Tag danach, aber dann eben in einer verbindlicheren und reflektiveren Form.
Ich glaube, dass es so auch anthropologische Konstanten menschlicher Kultur gibt, die sich am Ende wieder wie so ein großes Grundrauschen durchsetzen werden. Weil, wir sind natürlich auch in unserer ganzen Analogität, in unserer Menschlichkeit ein Stück weit begrenzt. Wir sind nicht wirklich digitale Wesen. Es wird ja immer gesagt, alles wird digitalisiert. Der Mensch wird digitalisiert. – Wir sehen das auch bei den Geschäftsmodellen heute, dass die radikalen Digitalisierungsvorhaben eher in Probleme geraten und eher Formen, die das Analoge mit dem digitalen in kluger Art und Weise verbinden, die sind sehr erfolgreich. Wir nennen das auch real-digital. Wo auch das wirkliche Leben, das reale Leben darin angesprochen wird, da hat es eine sinnvolle Ergänzung. Das werden letzten Endes die Erfolgsmodelle der Zukunft werden.
Deutschlandradio Kultur: Sind so eine sinnvolle Ergänzung auch die Emoticons? Schreiben Sie auch mit Emoticons, wenn Sie mehr E-Mails schreiben, also diese lachen oder weinenden Köpfe, um eben das auszudrücken, was man sonst mit der Mimik macht, aber eben im Schriftlichen zwischen den Zeilen oft schwer verraten kann?
"Menschen sind letzten Endes Dorfbewohner"
Matthias Horx: Da sehen Sie natürlich genau die Nachteile. Sie können natürlich mit einem menschlichen Gesicht unendlich mehr Zwischenformen und auch im zeitlichen Verlauf ganz andere Melodien machen als durch diese Emoticons. Sie sind natürlich extreme Vereinfachungen und sie führen eigentlich zu einer Rationalisierung von Kommunikation, die man schon machen kann, wenn man das will in bestimmten Phasen. Natürlich, zwischen 14 und 16 ist das super. Da kann man einfach schnell Gefühle raushauen und auf einfache Formen bringen. Aber dann, wenn es etwas differenzierter wird im Leben, wenn man merkt, ja, dass auch die Liebe, die Zuneigung, vielleicht sogar die Feindschaft oder das Nachdenken miteinander doch ein bisschen mehr Arbeit erfordert, dann ist das ein viel zu grobes Mittel. Dann greift man doch wieder zu dieser unglaublichen Bandbreite der menschlichen Kommunikation.
Sie sehen ja auch, dass viele Prophezeiungen mit dem Internet nicht eingetreten sind. Ich erinnere mich: Vor 15, 20 Jahren, ich bin ja selber Vortragsreisender, ich rede viel auf Konferenzen, da hat man gesagt: Na, das wird’s alles nicht mehr geben. Es wird nur noch Telepräsenz geben, es wird ein Mensch in einem Saal stehen und quasi gegen die Wand reden. Und die Menschen werden alle online zuschauen. Oder man kann die Pädagogik, das Lehren, das Lernen, die Schulen völlig digitalisieren. Wir sehen, wie stark da die Grenzen sind, nicht nur, weil die Lehrerschaft konservativ ist, sondern auch, weil das Zwischenmenschliche eben feine Töne auch bedingt. Das ist etwas, was wir immer wieder auch aus den anthropologischen Studien herauslesen können.
Menschen sind letzten Endes Dorfbewohner. Und wir versuchen mit dem Internet natürlich oft, eine Großstadt quasi im Dorf zu simulieren. Das kann nicht gut gehen.
Deutschlandradio Kultur: Nun sprechen Sie, auch wenn Sie bei diesen Vorträgen sind, eben vor ganz vielen Medienvertretern. Sie sprechen da in letzter Zeit oft von einem "Sensationismus" der Medien. Von welcher Angst sprechen Sie da?
Matthias Horx: Also, wir können feststellen, dass dieses große morphische Feld der Medien – und dabei ist jetzt das Internet natürlich nur ein Teil, das Internet hat ja auch die elektronischen Medien selbst, hat das Fernsehen zum Teil dekonstruiert, hat die Zeitungen in ganz andere Formen gebracht. Wenn Sie sich heute eine Website einer meinungsführenden Zeitung anschauen, dann ist das eine ganz andere Form als eine frühere Zeitung – ein Resonanzfeld bildet, was eben die gesellschaftlichen Diskussionen in Richtung Angst treibt, in Richtung Angst, Erregung und Übersteigerung.
Das führt dazu, dass wir regelrechte Panikwolken durch die Gesellschaft treiben sehen, die gefährlich sind, die ein starkes Problem letzten Endes für die Balance einer Gesellschaft darstellen. Das hat vor einigen Jahren auch auf die öffentlich-rechtlichen Medien übergegriffen. Ich erinnere Sie an die Griechenlanddebatte. Eine solche Meldung, dass ein Land überschuldet ist, wie Griechenland, hätte vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich einen kleinen Text in einer seriösen Wirtschaftszeitung gebracht. Da hatten wir plötzlich jeden Abend Talkshows auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern, die rein polemischen Charakter hatten – so im Sinne von: Lügen-Griechen! Wer zahlt die Zeche?
Diese Art, diese Sprache des Boulevards, der Empörung, der Hysterie, diese Erzählung hat stark auf die Gesellschaft übergegriffen. Das hat natürlich fatale Wirkungen zum Teil.
Beim Terrorismus ist es zum Beispiel so: Die beste Propagandaabteilung des IS sind die Medien. Wenn Sie heute einen Terroranschlag haben, das wird dermaßen wunderbar im Sinne des Terrorismus dokumentiert und mit Schrecken versehen. Das verstärkt das natürlich. Der Terrorismus lebt ja von der Aufmerksamkeit. Und alle anderen Debatten sind das auch.
Wenn man sich ein bisschen mit Zukunft, mit Trends, mit Veränderungen auseinandersetzt, dann merkt man, dass die Welt gar nicht schlechter wird, aber wir haben immer mehr gesellschaftlichen Angstpessimismus. Das wirkt wiederum auf die Zukunft. Und das hängt ganz stark auch mit diesem übersteigerten Resonanzsystem der Medien zusammen.
Deutschlandradio Kultur: Aber wie hängt das jetzt mit dem Internet zusammen? Bei uns zum Beispiel ist es auch so, dass eine gut recherchierte Auslandsreportage auf Facebook zum Beispiel, die keine provokante These hat, kaum Resonanz erzeugt – im Gegensatz zu einem Artikel, der viel Resonanz erzeugt von anderen Seiten mit einem Titel wie: "10 Dinge, mit denen Eltern ihre Kinder nachts zum Weinen bringen." Sowas erzeugt dann viele Klicks.
Wie soll da Medien in diesem Aufmerksamkeitsdilemma agieren und noch Journalismus betreiben?
"Diese Websites sehen ja alle gleich aus"
Matthias Horx: Auch das ist letzten Endes ein Phänomen, wo sich quasi das System in eine aussichtslose Position verändert. Das sogenannte Klickrating, was Sie genannt haben, ist ja genau die Tatsache, dass das, was Erregung produziert und Angst, also letzten Endes Adrenalin im Kopf oder Endorphine, von dieser Rückkopplung der Medien noch einmal selektiert wird. Und es wird immer alles nach oben gerankt, je blöder es ist.
Sie haben es schon richtig gesagt an dem Beispiel. Die Nachrichtenwebseiten haben in der Tat bald nur noch "3 Gründe weshalb Frauen ihren Orgasmus faken", also das Thema Sex, "7 Pläne von Putin für den nächsten atomaren Weltkrieg", also die Hysterisierung von Politik, und dazwischen sind Katzenbilder. Ich übersteigere das jetzt, aber genau in diese Richtung driftet das. Es ist für das einzelne Medium praktisch unmöglich, dem entgegenzusteuern. Die Öffentlichkeit selber oder die gesellschaftlichen Diskursstrukturen müssen sich ein Stück weit reorganisieren.
Das tun sie ja auch. Wir sehen ja auch, dass es unglaublich tolle Websites gibt oder auch ganz, ganz tolle Zeitungen und Medienprodukte, die dem widerstehen. Ich war lange Jahre Redakteur bei der ZEIT in Hamburg vor zwanzig Jahren. Da hieß es: Ein solches Blatt wird nie überleben mit diesen langen Texten, wo immer so viel nachgedacht wird. – Es ist genau das Gegenteil der Fall. Die gute alte ZEIT ist heute sehr, sehr vital. Es gibt ja ein großes Bedürfnis auch noch nach dieser "Bedächtigkeit". Das meine ich jetzt als positiven Begriff.
Da können Sie eben, glaube ich, auch die Logik von Trend und Gegentrend sehen. Diese Websites sehen ja alle gleich aus. Das heißt, letzten Endes sinken auch irgendwann die Klickraten, weil man gar nicht mehr weiß, wo man hinklicken soll. Dann wird sich das Ganze auch ökonomisch nicht mehr rechnen. Diese Rechnung wird auch eine Art Selbstzerstörung letzten Endes sein.
Aber wichtig ist: Das größte Problem, was wir momentan haben, ist, dass gesellschaftliche Hysterien freigesetzt werden, Gerüchte, Verschwörungstheorien. Die speisen natürlich all das, was wir heute an populistischen Tendenzen in der Politik haben.
Deutschlandradio Kultur: Ist eine Antwort darauf dann zum Beispiel der konstruktive Journalismus, also die Idee, dass man nicht mehr provokant und kontrovers schreibt, um eben viele Erregungen zu produzieren, sondern konstruktiv selber mitdenkt an Problemlösungen?
Konstruktiver Journalismus als neues Format
Matthias Horx: Das ist eine Lösung. Das ist ein Trend, den wir auch beobachten können. Es gibt ja eine erste deutsche Website, die auch Constructive Journalism, so der Fachausdruck, ganz bewusst betreibt. Die haben gerade ein Crowdfunding gemacht, was sehr erfolgreich war. Der Begriff stammt ursprünglich vom Intendanten des Dänischen Rundfunks Ulrik Hagerup, der vor Jahren schon gesagt hat: Auch die öffentlichen Medien treiben in diesen Erregungs- und Hysteriediskurs hinein. Und wir brauchen neue Formate.
Im dänischen Fernsehen werden zum Beispiel Format versucht, wie Talkshows, bei denen eine Lösung dabei herauskommen muss, wo quasi nach dem Beispiel Runder Tische, wie man es früher mal hatte, ergebnisorientiert diskutiert wird und nicht polarisiert orientiert, wie es in den deutschen Talkshows der Fall ist, wo man am Ende das Gefühl hat, es gibt keine Lösung, sondern alle schreien sich nur gegenseitig an.
In dieser Rahmenverschiebung kommen ganz interessante Effekte heraus. Wenn man quasi die gesellschaftlichen Gruppen an einen Tisch setzt und sagt, wir diskutieren hier so lange öffentlich, bis eine Lösung dabei entstanden ist, dann entsteht ein interessanter Druck und ein interessanter Zwang. Solche Portale und solche Medienprodukte werden in den nächsten Jahren öfter aufmachen, wo eben die Welt als ganzes System gezeichnet wird und nicht nur in ihren Phänomenologien des Schreckens, den ohne Zweifel nicht funktionierenden Dingen, sondern wo auch das geschildert wird, was funktioniert, wo auch die Erfolge anerkannt werden.
Es gelingt ja unheimlich viel, auch in unserer Gesellschaft, auch auf der Welt. Wenn Sie sich heute mal Globalisierung anschauen, dann ist das in vielen Köpfen eine Katastrophe geworden, aber in Wirklichkeit geht es vielen Menschen in der Welt besser. Die materiellen Levels steigen. Die bittere Armut nimmt ab. Solche Meldungen können Sie natürlich nicht in den Medien bringen, aber es ist wichtig, dass wir das ganze Bild erkennen. – Und dafür brauchen wir in der Tat auch neue Formen von Journalismus.
Deutschlandradio Kultur: Wir haben jetzt viel gesprochen über Änderungen unseres Verhaltens im digitalen Raum und wie Medien sich verändern können. Was ist denn, wenn das Digitale zunehmend unser Bild der Realität beeinflusst? Zum Beispiel durch Virtual-Reality-Brillen – sind die in zwanzig Jahren Standard?
Matthias Horx: Standard sicher nicht, Standard in manchen Bereichen. Das ist eine Technologie, die sich ja schon lange ankündigt. Virtual-Reality haben wir, glaube ich, schon in der Trendforschung formuliert und durchdacht oder versucht zu durchdenken vor zwanzig Jahren. Da gab es dann Versuche, die aber alle technisch noch unzureichend waren.
Heute ist das technisch reif geworden und es führt eben dazu, dass wir heute eine Immersion, also ein Gefühl von Ersatzrealität, von Zweitrealität haben können, die es in der Form noch nicht gab. Wenn man einmal mit einem von diesen Head-Sets eine Raumschlacht geflogen hat oder in virtuellen Welten unterwegs war, dann merkt man, dass sich das Hirn quasi völlig täuschen lässt, also dass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist.
Das ist einerseits sensationell, weil es natürlich einem tiefen menschlichen Wunsch nach Reise, nach Transformation, nach fernen Welten entspricht. Und auf der anderen Seite ist es erschreckend. Sie können eben sehen, dass Menschen, die das mögen, überwiegend Männer sind. Die haben immer mehr diesen Hang fortzugehen, woanders hin, wo keine sozialen Bindungen herrschen, dass Frauen das eher nicht mögen und dass es unheimlich polarisiert.
Technologien, die polarisieren, das ist ähnlich wie in der Genforschung oder wie in anderen Spitzentechniken, sind nicht einfach dann Standard, sondern sie werden bestimmte Anwendungen entwickeln, die Sie quasi mit der gesellschaftlichen Spannung versöhnen, die sie erzeugen. Und sie werden aber auch Exzesse erzeugen. Man kann heute schon absehen, eine der klassischen Motive in den Virtual Space zu gehen, wird zum Beispiel das sein, was auch das Internet vorangetrieben hat oder andere Medien, nämlich Pornographie. Sie können natürlich wirklich virtuelle Erotik da perfekt. Wenn Sie dann noch die Gefühlsebene mit abbilden, das ist ja nicht mehr lang, Teledildonik, also die operative Praxis von digitalen Geschlechtsorganen, dann haben Sie ein perfektes System der virtuellen Prostitution, wo Sie keine Prostitution mehr brauchen. Das werden Anwendungen sein, die sich wie Tunnel in die Gesellschaft hineinbohren, aber die natürlich extrem umstritten sind, weil, das ist natürlich Realitätsflucht. Und wir sind auch, wie gesagt, zutiefst soziale Wesen.
Es gibt aber auch andere Anwendungen – im Bereich der Pädagogik, der Kunst, der Simulation, die natürlich kostbar sind und die große Nischen, interessante Nischen, auch lukrative Nischen besetzen werden. Es ist ja heute schon so, dass ein Pilot ohne Flugsimulator eigentlich gar nicht mehr lernen kann.
Deutschlandradio Kultur: Ich meine noch andere Brillen. Das wäre jetzt das Kino quasi direkt vor dem Auge. Ich meine Augmented Reality, dass man eben die Realität, die man sieht, noch ergänzt, wenn man eine Brille trägt mit Zusatzinformationen. Da wird dann nicht nur gewusst, wo man ist, sondern auch noch genau, was man sieht, was das Auge sieht. – Was wird das verändern?
"Nicht alles, was erfunden wird, setzt sich durch"
Matthias Horx: Das wird gar nichts verändern, weil das ein Flop ist. Das haben wir schon vor Jahren gesagt, dass diese Technologien eher marginal bleiben werden. Auch da gilt: Das ist natürlich für Kampfpiloten wichtig oder im Operationssaal, aber "Google Glass" ist ja gescheitert am Markt. Wir konnten das vorher sehen, weil es einfach ein extremes Eindringen in die alltägliche Welt des anderen macht. Wenn jemand "Google Glass" auf hat und alle möglichen Informationen über mich einblendet, dann will ich mit dem nicht mehr kommunizieren. Deshalb hieß es gleich, als die ersten Brillen da auf den Markt kamen: "Glassholes". Das war schon das Schimpfwort in Amerika für die Träger dieser Brille und das Ding ist eigentlich vom Markt genommen worden. Also, man darf nicht denken, dass alles, was erfunden wird, sich auch durchsetzt, sondern die Gesellschaft ist natürlich auch ein Filter und es gibt manchmal einfach extreme Reizungen und Nervositäten, wo die Menschen sagen, nein, das machen wir nicht, da spielen wir nicht mit.
Zum Teil ist das natürlich wiedergekommen heute in den Wearables, also in dem, was es an Informationen über unsere eigenen Körperfunktionen gibt. Aber auch da sehen Sie Grenzen im Markt. Da sieht man deutlich Grenzen im Markt, weil, das ist für Sportfreaks und für Optimierer ihrer eigenen Leistungsfähigkeit interessant, aber für die breite Masse ist es eigentlich nicht so furchtbar wichtig. Ich selber habe auch Wearables getragen, als ich angefangen habe zu Joggen vor zehn Jahren, um zu wissen, wie ist mein Puls, wie ist meine Leistungsfähigkeit. Ich habe die nach einem Jahr wieder weggeschmissen, weil, irgendwann weiß man es, kennt man seinen Körper einfach.
Also, es gibt diesen sogenannten prothetischen Effekt, wie wir das nennen, also den Protheseeffekt von Technologien, dass sie einem quasi was wegnehmen an Fähigkeiten, die dann verkümmern. An dem Punkt wehren sich auch Menschen. Dann finden sie das auch nicht mehr so toll. Das ist immer so das Märchen, wenn was von oben kommt und uns technologisch verordnet wird, dass die Menschen das auch fressen. Das ist aber nicht der Fall. Die Menschen sind klüger als man denkt.
Deutschlandradio Kultur: Was glauben Sie denn, was bleiben wird – wenn man jetzt guckt auf das digitalisierte Auto, die Heizung, der Kühlschrank, der selber weiß, wann er aufgefüllt werden soll?
Matthias Horx: Haben Sie einen?
Deutschlandradio Kultur: Ich hab noch keinen.
"Jeder Journalist erzählt seit 27 Jahren vom intelligenten Kühlschrank"
Matthias Horx: Werden Sie so einen haben? Das ist eins der klassischen Mediengerüchte. Jeder Journalist erzählt seit 27 Jahren vom intelligenten Kühlschrank und es hat noch niemand einen gesehen, weil es natürlich Blödsinn ist, unter uns gesagt. Warum soll der Kühlschrank mit der Brotmaschine kommunizieren? Und warum soll er sich selber nachfüllen? Wir haben heute ganz andere Lebensrhythmen. Wir gehen viel mehr essen, wir bestellen uns Pizza. Das sind so technologische Mythen, die immer um die Medien herum kreisen, aber das ist einfach Bullshit-Technologie, wie wir das nennen. Das wird sich auch am Markt nie durchsetzen.
Deutschlandradio Kultur: Und welche Technologien, glauben Sie, werden sich dann durchsetzen, wenn man auch auf die Frage guckt, wie viele Daten möchte man abgeben und ins Netz einspeisen? Sie haben die Brillen erwähnt, die da nicht angenommen wurden, Ihren Impulsmesser, den Sie wieder zurückgegeben haben. All das speist ja dann Informationen in ein System ein. Wo, glauben Sie, ist da noch Bedarf?
Matthias Horx: Also, viel Bedarf ist ja da, wo wir es auch gar nicht sehen. Ich bin gerade mit einem Tesla, also diesem Elektroauto, mehrere tausend Kilometer durch Deutschland gefahren und habe das automatische Fahrsystem dort getestet. Das ist nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, die einen einzigen Zweck hat, nämlich zu definieren, was Straße ist und ob man fahren kann. Dabei werden natürlich Millionen von Daten generiert und auch hochgeladen in das System, was dann das GPS des Autos auch speist und wo die Karten immer genauer werden, auf denen es sich bewegt.
Das ist eine wunderbare Sache. Das ist etwas, was gewissermaßen hinter dem Erlebnishorizont liegt, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Weil, natürlich kann man jetzt sagen, okay, man könnte jetzt die Daten abfragen, wo bin ich da, und mir vielleicht irgendwie Werbung ins Auto schicken, aber ich glaube, das sind alles auch hysterische Befürchtungen, die besonders in Deutschland natürlich mit unserer Vergangenheit, das ist verständlich, immer sehr überzeichnet sind.
Die Datenwolken sind schon sinnvoll da, wo sie uns quasi auch ein Stück weit in Frieden lassen, so sie das tun, was sie gut können, nämlich auch intelligente Systeme speisen, aber nicht alles wird ja unbedingt zur Überwachung genutzt. Das ist ja auch so eine Vorstellung, dass da oben irgendwo so ein dunkler Mann mit Schlapphut sitzt und diese ganzen Daten verwaltet und dann das Böse will. Das ist auch so ein bisschen eine naive gesellschaftliche Vorstellung.
Nein, es gibt einzelne Anwendungsformen, in denen das sehr sinnvoll ist. Autofahren ist ja selbst ziemlich stupide. Und wenn man mal erlebt hat, dass man das quasi delegieren kann an eine Maschine, dann kommt man auf ganz neue Gedanken. Man fängt an, die Zeit auch ganz anders zu nutzen. Und das wird auch so weitergehen.
Aber man muss eben differenzieren: Was sind die wirklichen Bedürfnisse der Menschen? Und die wirklichen Bedürfnisse der Menschen sind in der Tat nicht, sich überwachen zu lassen, sondern Daten zu generieren, die für sie in irgendeiner Form sinnvoll sind. Da kann es in der Tat um Gesundheit gehen und Mobilität, um das, was uns letzten Endes Freude macht, was uns im Leben auch bereichert. Und die Technologie wird letzten Endes von Menschen selektiert als Kunden, die sie eben annehmen oder verwerfen.
Deutschlandradio Kultur: Das war Tacheles mit Matthias Horx, Publizist, Unternehmensberater und Leiter des privatwirtschaftlich organisierten "Zukunftsinstituts", mit Hauptwohnsitz in Frankfurt am Main. Vielen Dank.