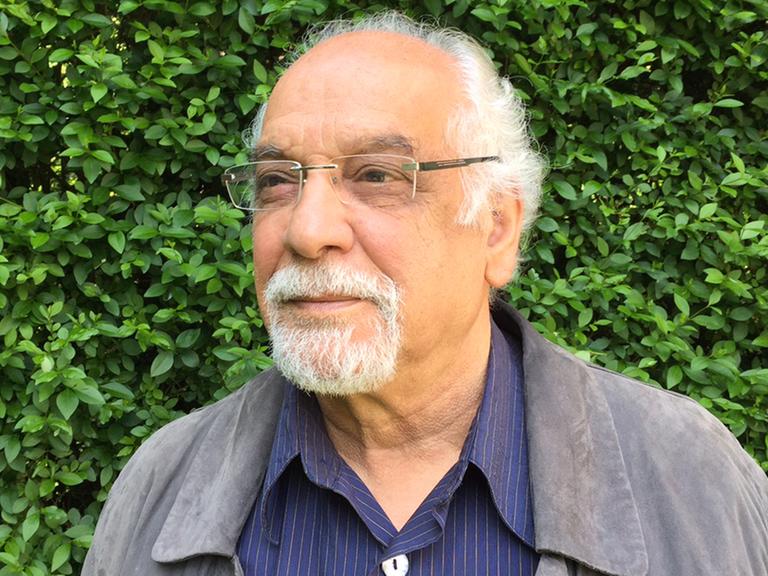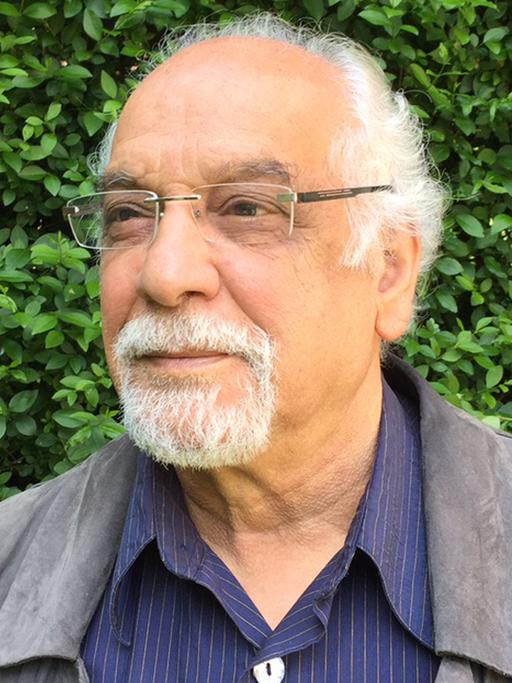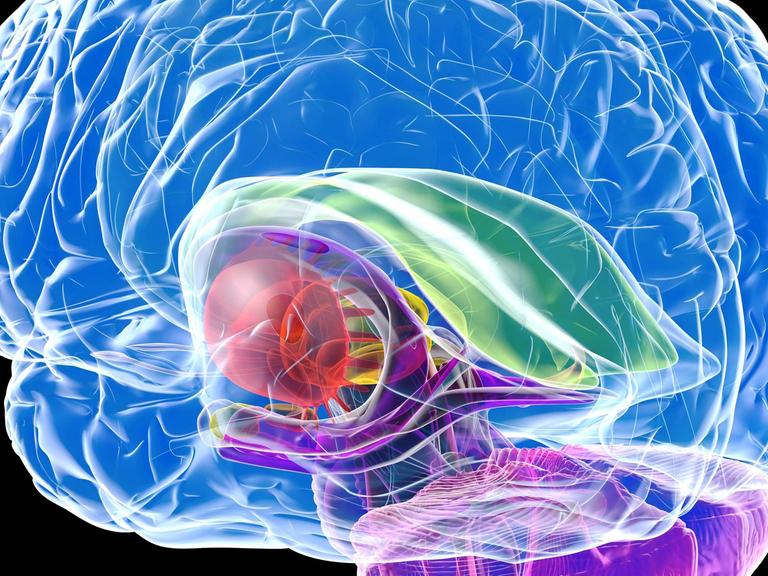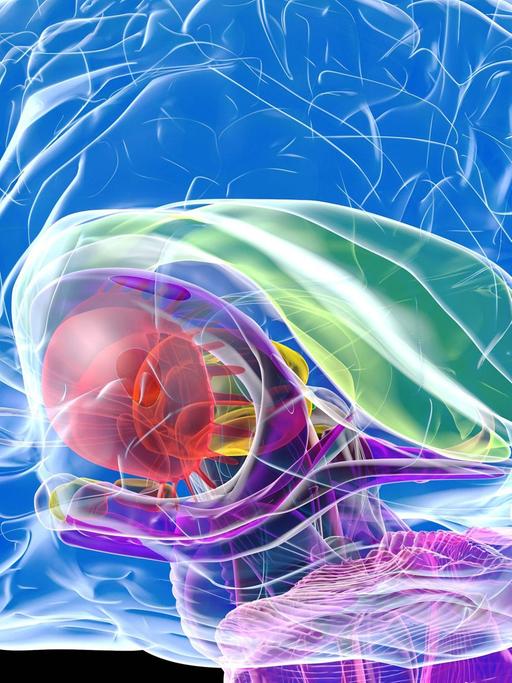Wie der Westen psychische Störungen exportiert

Der Westen exportiere nicht nur Produkte und Lebensstile, sondern auch das Geschäft mit Krankheitsbildern, kritisiert der Journalist und Psychologe Martin Tschechne. Dazu gehöre auch die Ansicht, was denn überhaupt eine psychische Störung ist.
Das Leben einer japanischen Prinzessin ist kein Rummelplatz. Jedenfalls nicht nach westlichen Maßstäben. Zu ertragen sind: der lastende Druck einer Ahnenreihe, die Jahrtausende zurückreicht, ein gottähnlicher Status, der jedes menschliche Bedürfnis diszipliniert, ein lähmendes Protokoll und die Aussicht, dem Käfig des Kaiserpalasts bis ans Lebensende nicht mehr zu entrinnen.
Kein Wunder, dass die künftige Kaiserin Masako vor ein paar Jahren Depressionen bekam. In den Vorstandsbüros der westlichen Gesundheitsindustrie mögen deshalb die Sektkorken geknallt haben: Endlich war diese Bastion fernöstlicher Moral gefallen, endlich das reiche Japan auch in dieser Hinsicht für den Markt erobert.
Depressionen und Magersucht in Japan und Hongkong
Depressionen sind seither im Mutterland von Selbstdisziplin und dem Zurücktreten des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft ein ruckartig verbreitetes Symptom. Und eine ordentliche Zahl von Therapeuten und Pharmazeuten lebt davon, sie zu bekämpfen.
Ganz ähnlich war es auch in Hongkong zu beobachten, wo der Tod eines magersüchtigen Mädchens und eine gut organisierte Betroffenheits-Kampagne durch Experten ganze Epidemien von anorexia nervosa auslösten: Plötzlich hatte sich die Zahl der jungen Frauen potenziert, die aus lauter Schlankheitswahn nichts mehr essen wollten. Als wäre die lebensbedrohliche Störung so etwas wie eine Mode.
Aber das ist nur die halbe Geschichte. Die westliche Kultur exportiert eben nicht nur Autos, Popmusik und pharmazeutische Produkte, sondern gleich das komplette Umfeld dazu: einen Lebensstil, Ideale, den Begriff des Individuums und seiner Bedürfnisse und nicht zuletzt die psychologischen Maßstäbe des Funktionierens und Nicht-Funktionierens.
Woher nehmen wir eigentlich diese dampfwalzenartige Selbstgewissheit?
Die andere Hälfte der Geschichte dreht sich um die Frage, welcher Segen in dem steckt, was westliche Wissenschaft als Aufklärung auf die Reise schickt. Welches Vertrauen Lösungen verdienen, die für die Probleme einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Kultur ersonnen wurden. Und wo die Grenzen dieses Vertrauens liegen.
Statt Therapien besser Baumaterial nach Sri Lanka
So wunderten sich Forscher aus Europa und den USA lange, warum etwa die Schizophrenie in anderen Kulturen oft weit weniger verheerende Folgen für den Kranken und sein Umfeld hat. Bis ihnen klar wurde, dass allein ihr Begriff von Krankheit dazu führt, einen Menschen auszusondern, wo gerade das Erlebnis von Gemeinschaft sein Problem lindern könnte.
Wenn nun westliche Wissenschaftler schon zugeben müssen, dass andere es besser machen, dann sollten sie auch von ihnen lernen.
"Vielen Dank!", sagten etwa die Menschen in Sri Lanka, nachdem vor einigen Jahren der Tsunami über ihre Küste gerollt war und eine zweite Welle von Helfern ins Land schwappte, um den Schock-Experten sprechen von posttraumatischer Belastungsstörung – in professionell geführten Gesprächen aufzuarbeiten. Danke, aber gebt uns lieber Baumaterial.
Hirnforschung als neuste Mode westlicher Wissenschaft
Das wäre zu verkraften, wenn nicht die westliche Wissenschaft immer wieder dazu neigte, die jeweils jüngste als die letzte, weltweit gültige Erkenntnis auszugeben. Zurzeit ist es die Hirnforschung, die einen immer größeren Anteil der Deutungsmacht für sich beansprucht.
Das Verlockende an ihr ist ihre naturwissenschaftliche Unbedingtheit. Denn es sind nicht Mythen oder Ideen, die da verhandelt werden, sondern chemische Reaktionen und elektrische Entladungen. Sie lassen sich messen und analysieren wie in einem Chemiebaukasten.
Ob das aber der richtige Weg ist, um die Identitätsprobleme magersüchtiger Mädchen zu lösen oder die Existenznot der vom Tsunami heimgesuchten Küstenbewohner in den Griff zu kriegen – das ist eine andere Frage.
Immerhin melden die Berichterstatter vom Hof des japanischen Kaisers, dass die traurige Prinzessin Masako inzwischen wieder lächeln kann.
Martin Tschechne ist Journalist und lebt in Hamburg. Als promovierter Psychologe weiß er, wie leicht sich Statistik missbrauchen lässt, um Ursachen vorzutäuschen oder tatsächliche Zusammenhänge zu verwischen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie zeichnete ihn kürzlich mit ihrem Preis für Wissenschaftspublizistik aus. Zuvor erschien seine Biografie des Begabungsforschers William Stern (Verlag Ellert & Richter, 2010).

Martin Tschechne© privat