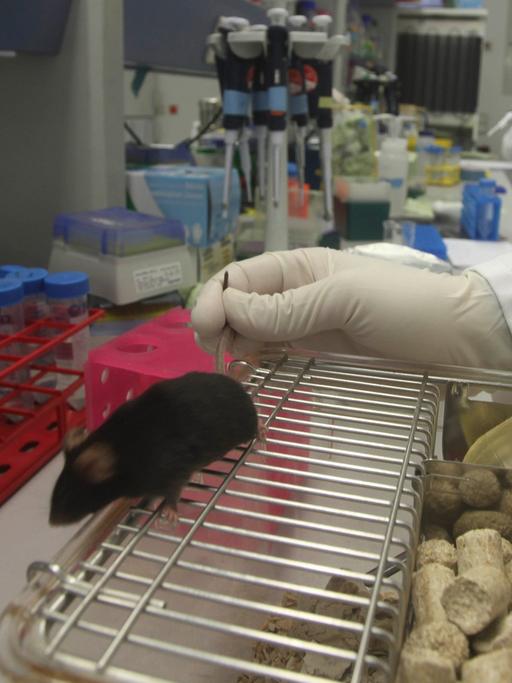Sind Tierversuche noch notwendig?

Viele medizinische Erkenntnisse gehen auf Tierversuche zurück. Wissenschaftler halten Experimente mit Tieren daher oft für unverzichtbar - obwohl es inzwischen auch Alternativmethoden gibt. Sie werden bloß nicht ausreichend anerkannt.
Die kriechende Kälte und der Schneeregen scheint die Rhesusaffen in einem Freigehege des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen nicht zu stören.
Das Deutsche Primatenzentrum, kurz DPZ, auf dem Universitätscampus im Norden Göttingens ist eine staatseigene GmbH. Sie ist auf Züchtung und auf Versuche mit Affen spezialisiert.
Die Rhesusäffchen mit ihren hellen Gesichtern hüpfen über die Gerüste und klettern den Maschendrahtzaun hoch. Ein Weibchen mit ihrem Baby auf dem Rücken balanciert im Hintergrund über ein Seil. Affen, die hier sind, weil das DPZ mit ihnen experimentiert. Affen, unsere nächsten Verwandten, von denen wir wissen, dass sie ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben, Werkzeuge benutzen, trauern. Susanne Diederich, die Pressesprecherin des DPZ, führt über das Gelände.
"Die Jungtiere der Weibchen, wenn die etwa drei Jahre alt sind, würden die Männchen normalerweise die Gruppe verlassen. Das können sie hier ja nicht, weil sie ja nicht abwandern können. Das heißt die Männchen, wenn die etwa so drei Jahre alt sind, werden aus der Gruppe genommen und werden dann Versuchstiere. Und die Weibchen bleiben aber immer in der Gruppe … die sehen halt auch aus wie alte Menschen. Ne? Die bleiben halt drin, auch wenn sie keine Jungtiere mehr kriegen, bis sie halt irgendwann sterben. Weil die für das Gruppengefüge so wichtig sind."
Immer wieder zeigt Diederich Besuchern das DPZ, auch Tierversuchskritikern. Transparenz und Diskurs sind dem DPZ wichtig.
"Es ist ja keiner für Tierversuche. Es ist ja so, was akzeptiere ich, was mit Tieren gemacht werden darf für welchen Zweck. Und diese Abwägung, die macht einfach jeder anders. Und wenn ich jetzt ein extremer Tierschützer und Veganer und überhaupt kein Tierleid zum Wohl des Menschen in irgendeiner Form, sei es Tiere essen, sei es Tiere nutzen, was weiß ich, sei es Reitsport oder sonst was akzeptiere, dann ist es meine Meinung, wenn ich aber sage, es gibt Grenzen, wo ich sage Forschung, wo es um Entwicklung von Therapien geht, das find ich akzeptabel, dass dafür Tiere verwendet werden, zum Wohl des Menschen, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, genauso, ob man ein Steak isst oder nicht."
2016 wurden in Deutschland 2,8 Millionen Tiere in Versuchen eingesetzt, davon gut 40 Prozent in der Grundlagenforschung. Mehr als 665 000 wurden für wissenschaftliche Zwecke, zum Beispiel Organentnahmen, getötet. An Mäusen, Ratten und Fischen wird besonders häufig geforscht. Versuche an Primaten sind seltener, 2016 waren es etwa 2 500. Die meisten Affen werden bei Giftigkeitstests eingesetzt. Aber sind Tierversuche noch notwendig?
Zwar haben Tierversuche einen großen Verdienst am Wissensstand unserer Medizin. Befürworter führen die Entwicklung von Antibiotika oder Techniken der Organtransplantation auf die Tierversuchsforschung zurück. Auch Impfstoffe gegen Krankheiten wie Polio oder Malaria wurden mithilfe von Tierversuchen entwickelt.
Tierversuche werden in der Wissenschaft zunehmend hinterfragt
Dennoch wird das "System Tierversuch" in der Wissenschaft zaghaft, aber zunehmend hinterfragt. An der Berliner Charité, dem größten Universitätsklinikum Europas, hat Dekan Axel-Radlach Pries das Umdenken zur Chefsache gemacht: Tierversuche seien nicht mehr unbedingt die beste Wahl für die Entwicklung neuer Therapien für den Menschen.
"Also der Tierversuch ist im Moment unverzichtbar und wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ethische Verpflichtung und auch eine inhaltliche Verpflichtung, alle Alternativen energisch zu untersuchen und zu fördern. Und zu untersuchen einerseits in der Richtung: Was kann ich damit sogar besser machen als mit dem Tierversuch – und wo kann ich den Tierversuch durch anderes ersetzen."
Pries erkennt ein Systemproblem: Alternativmethoden würden nicht so stark gefördert wie Tierversuche. Das liege nicht an einer Verweigerung Einzelner. Pries zieht einen Vergleich mit dem Strommarkt vor der Energiewende.
"Große Firmen haben große Kraftwerke und investieren Geld. Und sorgen dafür, dass das auch so bleibt. Genauso ist das in der Wissenschaft natürlich so, dass die Personen, die im Moment Drittmittelanträge begutachten, die im Moment Journals begutachten, sind überwiegend Menschen, die einen Hintergrund haben in hochwertigen Tierversuchen. Und selbstverständlich erzeugt das ohne jeden bösen Willen dahinter eine gewisse Priorisierung. Viele von diesen Leuten werden sagen: Ja, was du da vorhast, ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, Wirkung von Krebsmitteln, ähnlichem – aber du müsstest das doch mal in einem Tiermodell testen."
Im Dezember vergangenen Jahres hat die Charité ein interdisziplinäres Zentrum gegründet, das Alternativen zu Tierversuchen fördern will – und jene Wissenschaftler seines Hauses zusammenbringen will, die bislang unabhängig voneinander forschen. 2017 unterstützte das Land Berlin das Vorhaben im Rahmen des Hochschulvertrags mit 1,2 Millionen Euro, 2018 sind 1,7 Millionen zugesagt. Die Förderung wird bis 2022 sukzessive auf 2,0 Millionen Euro steigen.
Stefan Hippenstiel, an der Charité Professor für molekulare Infektiologie und Pneumologie, ist einer der Wissenschaftler, der an Alternativen zu Tierversuchen forscht – und dessen Arbeit durch das Zentrum eine neue Bedeutung erfahren könnte. Er steht am Bett einer schwer kranken Patientin, die nur noch von Maschinen am Leben gehalten wird. Sie wird bald sterben. In Fällen wie diesen, so hat er über die Jahre herausgefunden, ist die Erforschung von Therapien mit Hilfe von Tierversuchen nicht immer erfolgreich.
"Also zunächst einmal ist klar, dass Tierversuche sehr zu unserem heutigen Wissensstand von Krankheiten beigetragen haben. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass viele dieser Modelle uns auch in die Irre geführt haben beziehungsweise, dass sich die Ergebnisse aus den Laboren nicht an den Menschen übertragen ließen. Deswegen brauchen wir dringend neue, auf menschlichen Zellen und Geweben basierende Methoden, die es uns erlauben, näher an den echten Menschen und an diese komplizierte Krankheitssituation heranzurücken."
Hürden bei der Schaffung von Alternativmethoden
Aber: Das System "Tierversuch" zu durchbrechen, ist für Hippenstiel und seine Kollegen schwieriger als gedacht. Als Außenseiter mussten sie die Erfahrung machen, dass Fördergelder für Alternativmethoden schwieriger zu beantragen sind.
"Der Trick ist immer der gleiche. Sie treten nicht an, um eine Alternativmethode zu entwickeln, sondern sie treten mit einer hochwissenschaftlichen inhaltlichen Fragestellung an. Und in dieser Fragestellung verstecken sie dann, quasi, diese Anwendung, die sie eigentlich im Sinne haben. Das heißt, sie argumentieren, die Aufgabe ist es, ein menschliches Lungengewebe besser lebend mikroskopieren zu können, um diesen oder jenen Inhalt erforschen zu können. Und dafür müssen sie diesen lebenden Schwamm, möglichst ohne ihn zu zerstören, in 0,1 Millimeter dünne Scheiben schneiden. Das war die Herausforderung, vor der wir standen."
Mit Geschick erhielten die Wissenschaftler die Förderung für die Entwicklung jenes Gerätes, das Lungengewebe in die winzigen Scheiben schneidet.
Ein kleines Labor an der Charité. Stefan Hippenstiel steht vor der Wasserstrahl-Schneidemaschine, kaum größer als ein Staubsauger, aber teurer als ein Einfamilienhaus.
"Und hier ist nun ein Zylinder, der mit anderthalb Tonnen in einen Hochdruckzylinder hineindrückt, dort wird dann über eine Hochdruckleitung zu einem speziellen Schneidtisch der Wasserstrahl geleitet. Am Ende sitzt eine Saphirdüse, in die ein kleines Loch gebohrt wurde. Und durch diesen Saphir wird das Wasser mit 1500 Bar hindurchgedrückt und schneidet dann durch das Lungengewebe wie durch Butter. Und zwar in einer Qualität, wie es uns vorher nie möglich war."
Die Folge: Hippenstiel und sein Team haben bereits neue Therapien für Lungenentzündungen entwickelt und Erkenntnisse über das gefährliche Mers-Corona-Virus gewonnen.
Hätten er und sein Team nicht - auf eigene Faust und ohne Anfangsförderung - die neue Methode entwickelt, würde es diese neuen Therapiemöglichkeiten und Erkenntnisse wahrscheinlich heute nicht gegeben. Hippenstiel wünscht sich nach dieser Erfahrung ein Umdenken – auch bei den Fördergebern.
"Ich glaube, dass durch die Technologiesprünge nun erstmalig die Gelegenheit da ist, tatsächlich erstmalig entsprechende Alternativmethoden aufzubauen, die nicht nur in bestimmten Bereichen Tierversuche reduzieren oder ersetzen können, sondern die darüber hinaus einen echten Mehrwert ergeben, nämlich uns die Möglichkeit verschaffen, Dinge zu untersuchen, die wir bislang nicht untersuchen konnten. Da braucht man einfach auch Ressourcen."
Grundlagenforschung für medizinischen Erkenntnisgewinn
Deutsches Primatenzentrum. Stefan Treue, Direktor des DPZ und Professor für Kognitive Neurowissenschaften an der Universität Göttingen, bei einem Trainingsversuch mit einem Rhesusaffen.
Es fällt etwas Tageslicht in den Raum im Erdgeschoss. Was genau hinter dem dunklen Vorhang passiert, sieht man auf den Bildschirmen davor.
"Das ist quasi die Steuereinheit, die das Versuchsdesign steuert. Sie sehen hier die Kamerabilder, offensichtlich ein Mensch, Herr Möller, offensichtlich ein Affe, die beide hier hinter dem Vorhang sitzen, sich gegenüber. Und haben zwischen sich eine Scheibe, keine Glasscheibe, sondern das ist ein Computerbildschirm, auf dem von beiden Seiten etwas gesehen werden kann. Nur dasselbe, weil es ja ein durchsichtiger Bildschirm ist. Und hier sehen sie das Ganze in der Aufsicht. Also hier ist sozusagen seine Nase, dann sehen sie hier das Röhrchen, wo der Saft oder der Tee oder die Flüssigkeit als Belohnung kommt, das brauchen wir bei ihm nicht zu machen, er kriegt sozusagen wissenschaftliche Belohnung …"
Die Töne melden, ob Mensch und Tier richtig reagiert haben. Der hohe Ton ist für den Affen, der tiefe für den Wissenschaftler. Dem Affen signalisiert der Ton zugleich, dass er zur Belohnung mit Saft aus der Trinkdüse rechnen kann.
"… und in diesem speziellen Fall beginnt der Versuch damit, dass beide Hände auf so Sensoren ruhen, und dann passiert was auf dem Bildschirm, und dann greift er zum Bildschirm und berührt diesen Punkt auf dem Bildschirm, der leuchtet. Und bei ihm sieht das genauso aus, da kann man nur die Hände ein bisschen schlechter sehen, hier liegt die eine Hand, da sehen sie den Sensor für die andere Hand, und vor jedem Durchlauf müssen die Hände da liegen, dann erscheint was auf dem Bildschirm, hier sehen sie diese Punkte, und dann muss er ne Greifbewegung zu diesen Punkten durchführen."
Es ist eine Untersuchung am gesunden Gehirn. Besonders interessieren Treue und sein Team sich dafür, wie visuelle Informationen im Gehirn verarbeitet werden und wie der soziale Kontext die Entscheidungsfindung und Bewegungsplanung beeinflusst. Grundlagenforschung, die, so die Forscher, langfristigen medizinischen Erkenntnisgewinn bringt.
Bei dieser Prognose ist viel Hoffnung im Spiel. Was am Ende bei den Experimenten herauskommt und vor allem was sich tatsächlich auf den Menschen übertragen lässt, ist unklar. Tierversuchskritiker kritisieren Forschung mit Tieren deshalb als eine Art "Zufallsforschung".
Wichtige Behandlungsmethoden beruht auf Tierversuchen
Allerdings haben die Wissenschaftler auch bei der Primatenforschung bedeutende Erfolge vorzuweisen. Als Beispiel wird unter anderem die sogenannte "tiefe Hirnstimulation" genannt. Sie wird seit 1998 unter anderem zur Behandlung von Parkinson-Symptomen eingesetzt. Diese Behandlungsmethode kann Menschen unter anderem deshalb helfen, weil die Funktionsweise des Gehirns genauer aufgeklärt wurde – durch das Einführen von Elektroden in das Affengehirn. Auch die Methode des Implantierens der Elektroden ins Gehirn konnte vom Affen auf den Menschen übertragen werden.
Das Experiment, das wir am DPZ sehen, macht eher den Eindruck eines Computerspiels zwischen Mensch und Affe – der Affe wird für den eigentlichen Tierversuch noch angelernt. Um die Gehirn-Strömungen messen zu können, müssen die Affen operiert werden. Zwar gibt es auch nichtinvasive Verfahren. Aber die sind, so Treue nicht immer genau genug oder passend zur Versuchsfrage. Deshalb braucht es oft den Eingriff beim Versuchstier. So wird es auch diesem Affen ergehen.
"Die übliche Technik ist, dass sie ein kleines Stück des Knochens entfernen und ersetzen, ich sag mal ganz salopp durch einen Deckel. Damit das Tier ganz normal in seiner Gruppe leben kann und das hygienisch verschlossen ist. Und für die jeweilige Messung entfernen sie dann den Deckel, führen eine Elektrode rein, und nach der Messung nehmen sie die Elektrode wieder raus, setzen den Deckel wieder drauf und das Tier kann ganz normal zurück in seine Gruppe. Das ist die üblichste Methode."
Wir schauen hinter den Vorhang. Links sitzt der Wissenschaftler, rechts der Affe. Getrennt sind sie durch den durchsichtigen Computerbildschirm, der zugleich ein Touchscreen ist. Der Affe schaut kurz zu uns rüber, konzentriert sich dann wieder auf den Bildschirm. Immer wieder nuckelt er an einer kleinen Düse, der Trinkvorrichtung – nachdem "seine" Töne ihm die Belohnung angekündigt haben.
"Also. Können Sie ja mal gucken, so sieht das aus. Die beiden sitzen sich gegenüber, da sitzt das Tier, sie sehen ja auch diese Plexiglasbox, die nach vorne offen ist, damit das Tier rausgreifen kann und den Touchscreen berühren kann. Und oben, wo er den Kopf rausstreckt, guckt er natürlich auch nicht durch die Plexiglasbox, sondern hat den freien Blick auf den Monitor."
"Wie lange sie im Versuch mitarbeiten, entscheiden die Affen"
Das DPZ will ausschließen, dass die Affen unter Angst oder Schmerzen leiden. Nach Operationen werden Schmerzmittel gegeben. Immer wieder wird ihnen Blut abgenommen, um ihnen unter anderem den Cortisol-Wert zu messen - um das Stresslevel der Primaten zu überprüfen.
An Versuchstagen haben die Affen keinen freien Zugang zu Flüssigkeit. Die bekommen sie erst im Versuch – je besser sie die Aufgabe lösen, desto mehr. Wie lange sie im Versuch mitarbeiten, entscheiden die Affen, sagt Treue. Manche arbeiteten eine halbe Stunde mit, andere vier. Eine Versorgung mit der individuell benötigten Flüssigkeit wird am DPZ immer sichergestellt. Außerdem arbeitet das DPZ mit Belohnungen für erwünschtes Verhalten. Zum Beispiel, wenn die Affen in die Plexiglasbox hineinklettern sollen.
"Aha, wenn ich da reinklettere, gibt es ne Belohnung und es passiert nichts Schlimmes. Und wenn sie das weit genug trainiert haben, dann können sie das Tier in der Box transportieren, dann merkt er: Oh, ich werd hier zwar rumgefahren, aber es passiert mir nichts, und so können sie schrittweise, wie auch bei den Verhaltensaufgaben das Tier dran gewöhnen."
Stefan Treue ist für seine Arbeit mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgesellschaft ausgezeichnet worden. Der Preis gilt als der wichtigste deutsche Wissenschaftspreis. Die Ergebnisse zur Aufmerksamkeitsforschung hätten einen starken Einfluss auf große Teile der Hirnforschung und seien auch für die Neurologie, Psychiatrie und Psychologie von großem Interesse, so die Begründung.
Treue bezeichnet die Versuche an Affen als unerlässlich. Mit Alternativmethoden wie bildgebenden Verfahren oder mit Zellmodellen werde an seinem Institut allerdings auch gearbeitet. Seit März 2017 ist das DPZ in einem Forschungsverbund, der Tierversuche reduzieren und ersetzen will.
"Und deswegen werden Tierversuche ja auch nur dann durchgeführt, wenn es keine Alternativmethoden gibt. Aber: Jede moderne Forschung ist immer ein Methodenmix: Also egal ob sie Forscher sind, die hauptsächlich Tierversuche machen, machen sie auch Alternativmethoden. Wenn sie Alternativmethoden entwickeln, machen sie auch Tierversuche."
Treue hält das Projekt der Berliner Charité deshalb für wichtig und sehr unterstützenswert. Er sieht jedoch - anders als deren Dekan Pries - kein Förderproblem bei Alternativmethoden.
"Ich glaube auch nicht, dass das Kernproblem ist, dass zu wenig Geld in die Entwicklung von Alternativmethoden gesteckt wird. So funktioniert das System ja auch nicht. Ich beantrage ja auch nicht Geld, um Affenversuche weiterzuentwickeln. Sondern im Rahmen der Forschung werden Methoden weiterentwickelt. Das ist der typische Fall."
So sieht es auch Brigitte Vollmar, Vorsitzende der Ständigen Senatskommission für tierexperimentelle Forschung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG.
"Also es ist nicht der Fall, dass Tierversuche eher gefördert werden. Nochmal: Die Priorität liegt immer an der Originalität der Fragestellung, an der Adäquatheit der Methodik, an der Performance auch des Antragstellers. Und das ist ein Konglomerat an Kriterien, die herangezogen werden in der Begutachtung von Projektvorhaben, und es ist sicherlich nicht ein grundlegendes Kriterium, ist es eine Alternativmethode: Ja, nein."
Ausschlaggebend sei für die DFG die Qualität der Forschung. Alternativen müssten sich dabei immer am Tierversuch messen: Dieser sei nach wie vor der Maßstab in der biomedizinischen Forschung.
"Jedem, der an Alternativmethoden arbeitet, muss bewusst sein, dass ein Kriterium die hohe wissenschaftliche Qualität ist und dass diese Alternativmethoden diese Qualität erreichen müssen, und da ist natürlich der Goldstandard das Tierexperiment. Um einfach die Validität dessen, was geforscht wird, zu gewährleisten. Und dann natürlich auch den Transfer der Erkenntnisse in die Klinik, wo wir eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Patienten haben."
Kritiker finden Kontrolle von Tierversuchen unzureichend
Nördlich von Berlin. Am Waldrand wohnt die Tierschützerin und Tierversuchsexpertin Melanie Scheel. Und mit ihr dutzende Tiere, die ohne ihr Engagement wohl getötet worden wären. Es sind ehemalige Versuchstiere, denen Melanie Scheel ein neues Zuhause vermittelt. Es riecht etwas streng. An der Wand: Die Käfige der Ratten.
"Das sind ehemalige Laborratten, also Ratten, die wir nach Tierversuchen übernommen haben. Die werden an privat vermittelt, wenn es eine adäquate Stelle gibt."
Scheel hat mit Mitstreitern einen Verein gegründet: "Hilfe für Labortiere e.V." Der Verein übernimmt Versuchstiere, die sonst nach den Versuchen getötet würden und vermittelt sie an private Halter. Nicht nur Ratten, sondern auch Hamster, Schweine, Schafe, Vögel, Katzen und sogar Kühe.
Die Kontakte zu den Versuchsleitern und Behörden hat Scheel auch deshalb, weil sie in Berlin in der Tierversuchskommission sitzt. Die berät die zuständigen Behörden bei der Zulassung von Tierversuchen.
Nur ein Teil der Versuche ist überhaupt genehmigungspflichtig. Versuche zum Nachweis von toxischen Wirkungen und Routinetests sind meist nur anzeigepflichtig – es muss lediglich ein Formular ausgefüllt werden. Aber auch das Genehmigungsverfahren ist nicht mehr als eine bürokratische Hürde. Die Behörden werden zwar durch "Tierversuchskommissionen" beraten, in der auch Vertreter von Tierschutzorganisationen sitzen – diese sind aber in der Minderheit. Die chronisch überlasteten Behörden müssen sich auch nicht an deren Votum halten.
Tierversuchskritiker bezeichnen die Kontrolle von Tierversuchen deshalb als unzureichend. Eine genaue Prüfung und ethische Abwägung von Tierleid gegen den Nutzen für den Menschen finde nicht ausreichend statt.
Als Grundlage im Umgang mit Tierversuchen werden oftmals die so genannten "Drei Rs" genannt: Reduction, Refinement und Replacement: Wenn man schon auf Tierversuche nicht verzichten kann oder will, dann soll die Anzahl der Tiere möglichst reduziert und die Leiden der Tiere möglichst gering gehalten werden. Und wo es möglich ist, soll die Alternativmethode Vorrang haben.
Melanie Scheel gehen die ersten beiden "R"s" – Verringerung der Tierzahlen und Linderung des Leides – nicht weit genug. Aus ihrer Sicht sind Tierversuche unzulässige Gewalt. Sie lehnt sie deshalb grundsätzlich ab.
"Der Tierversuch ist Gewalt als Methode. Kein Tier geht freiwillig in den Tierversuch. Kein Tier wird sich freiwillig spritzen lassen. Kein Tier wird sich freiwillig vergiften lassen."
Bedeuten Tierversuche nicht nur Leid für das Tier, sondern verhindern sie gar die Forschung zum Wohle des Menschen? Immer wieder müssen bereits zugelassene, breit an Tieren getestete Medikamente vom Markt genommen werden, weil Nebenwirkungen nicht aufgefallen waren – oder in den Tierversuchen gar nicht vorkamen.
Sind Textergebnisse auf den Menschen übertragbar?
Melanie Scheel bezweifelt grundsätzlich die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen. Und damit den Nutzen.
"Wenn wir das hier jetzt mal als Ergebnis nehmen, dass viele Substanzen, Medikamente, auch OP-Techniken rausgezogen wurden, dann ist die Frage: Verhindern Tierversuche medizinische Forschung? Wenn es nämlich im Tier nicht funktioniert, wird es nicht weiterentwickelt. Würde aber vielleicht für den Menschen ne gute Möglichkeit bedeutet haben, weil es beim Menschen vielleicht funktioniert hätte."
Davon, den Goldstandard Tierversuch in Frage zu stellen, scheint die Wissenschaft in jedem Fall noch weit entfernt zu sein.
"Sie müssen die anderen überzeugen, dass ihre Methoden mindestens gleichwertig, wenn nicht besser sind. Das kann dazu führen, dass ein Gutachter sie dazu zwingt, etwas, dass sie in menschlichem Gewebe erforscht haben, an der Maus wiederum zu zeigen. Also sie müssen gegen die Maus eben ihre Daten verteidigen. Nicht gegen den Menschen, um den es uns eigentlich geht. Und das erschwert uns die Arbeit natürlich sehr."
Und nicht nur das, es ist ein Karriere-Risiko.
"Wir hatten vor kurzem eine Publikation in einem sehr hochwertigen Journal, die Studie war rein an menschlichem Material erfolgt. Und zwei der drei Gutachter wollten unbedingt, dass diese Sachen in der Maus nachvollzogen werden, sie zweifelten unsere Ergebnisse nicht an, aber sie wollten gezeigt haben, dass es auch in der Maus funktioniert. Und das haben wir dann nicht gemacht und nicht gewollt. Und deswegen konnten wir in diesem Journal auch nicht publizieren."
Autorin: "Wieso haben sie das nicht gemacht?"
"Warum sollen wir etwas gegen das Tier validieren, wenn wir am Menschen interessiert sind? Zumal wir in diesem Fall Bakterien hätten einsetzen müssen, in diesen Versuchen, die rein menschpathogen sind. Sie gibt es im Tier einfach nicht. Wo ist dann der Nutzen?"
Hippenstiel erklärt dies an einem Beispiel aus seiner eigenen Forschung.
"Nehmen sie mal dieses Mers-Virus, dieses Mers-Corona-Virus. Das wird übertragen auf den Menschen von Kamelen. Und dem beliebtesten Modell bei Tieren in der Wissenschaft, dem Kleinnager, fehlt das Oberflächenmolekül, das das Anhaften des Virus überhaupt ermöglicht. Das heißt, die Maus wird überhaupt nicht krank. Sie können das in der Maus überhaupt nicht testen. Und das Frettchen wird auch nicht krank."
Manche Wissenschaftler sind strikt gegen Tierversuche
Hippenstiels Kollege und Mitstreiter Andreas Hocke, an der Berliner Charité wie Hippenstiel Professor für Infektiologie und Pneumologie, hat sich grundlegend und konsequent gegen Tierversuche entschieden, nachdem er Mäuse, die einen Tierversuch überlebten, töten musste.
"Diese Aufgabe, die delegiert man dann natürlich auch nicht unbedingt weiter, sondern der habe ich mich eben auch gestellt, und mir wurde dabei in dieser Unmittelbarkeit, Leben in den Händen zu halten und es zu beenden, einfach klar, dass das nicht in Ordnung ist. Und das hat mich zutiefst berührt und das hat auch dazu geführt, dass ich innerlich nicht nur eine Schranke aufgebaut habe, sondern eine Entscheidung getroffen habe, dass das für mich keine Option ist, so mein Leben zu verbringen …"
… obgleich er anerkennt, dass Tierversuche wesentlich zum Wissensstand der Medizin beigetragen haben.
"Ich hab mich dann wissenschaftlich auch erheblich umorientiert. und habe dann viele neue Methoden kennengelernt, Zellkultursignaltransduktionsprozesse, wie untersucht man Proteine, RNA, und so weiter, und hatte dadurch sicherlich auch zwei, drei, vier Berufsjahre in meiner Karriere, die ich verloren habe. Und eigentlich wieder von vorne begann."
Hocke entschied sich, ein zu diesem Zeitpunkt noch nahezu unetabliertes Modell mit menschlichem Lungengewebe aufzubauen.
"Dann begann ich in 2005, 2006, vielleicht auch noch ein Jahr später, langsam mit menschlichen Lungen, und das ist gar nicht so leicht, die zu bekommen. Von Patienten, aus dem Operationssaal, die müssen alle einwilligen, das ist auch wieder eine eigene ethische Frage. Und dann kam tatsächlich ein Mediziner aus einer anderen Klinik auf uns zu und fragte, ob wir nicht mit diesen Lungen arbeiten wollen. Und das war dann eigentlich der erste kleine Durchbruch, wo wir dann über Jahre mit den klinischen Partnern, mit den Chirurgen hier in Berlin, über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut haben. Dass Patienten aufgeklärt werden, dass wir gefragt werden, dass wir das Lungengewebe bekommen, dass es aus dem OP direkt zu uns geliefert wird und so weiter."
Andreas Hocke glaubt, dass die Alternativmethoden in einigen Bereichen dem "Goldstandard Tierversuch" den Rang ablaufen werden.
"Dass man das Organ in einen Kontext bringt, wo es mit anderen Organen und mit einem Immunsystem kommunizieren kann. Ich denke, je näher wir an eine solche Situation rankommen, desto größer wird der Erkenntnisgewinn, desto leichter wird der Übertrag, desto mehr Interesse wecken wir auch in der Pharmaindustrie für die Testung von Substanzen, die ja viel in Tieren auch scheitern. Und das ist ja ein großes Problem, warum auch die Wissenschaftsgemeinde zunehmend eine Lücke erkennt und den Bedarf sieht, dass wir neue und auch humane Modelle für die Wissenschaft brauchen."
Auf absehbare Zeit Tierversuche ganz abzuschaffen, hält Hocke jedoch für wenig realistisch. Er hat eine persönliche Entscheidung gegen Tierversuche getroffen – wohlwissend, dass viele Erkenntnisse der modernen Medizin auf Tierversuchen beruhten und er viele Kollegen, die Tierexperimente durchführten, schätzt, wie er sagt. Und dennoch: Alternativen könnten und müssten energischer gefördert werden.
"Allein die Argumentation, zu sagen, das Tier hat ein komplettes, funktionierendes Immunsystem, es wird beatmet, es interagiert mit anderen Organen, das trägt immer auch als Argument, zu sagen, der Erkenntnisgewinn in diesem Teil des Tieres wird immer höher sein. Und zu beweisen, dass die Aussagen, die wir generieren, an einem Zellkultur- oder Gewebemodell zum Teil höherwertig sind und das rechtfertigt dann, den Tierversuch zu ersetzen, das ist glaube ich auch ne Frage, mit der sich der Gesetzgeber im Detail noch gar nicht so auseinandergesetzt hat, und wo es auch einen sehr großen Spielraum in der Wissenschaftsgemeinde gibt."
Berlin gilt als Hauptstadt der Tierversuche
Berlin gilt als die Hauptstadt der Tierversuche. Zugleich hat sich der rot-rot-grüne Senat zum Ziel gesetzt, dass Berlin Hauptstadt der Alternativmethoden wird. Zu dieser Entscheidung zu kommen, hat lange gedauert. Jahre hat die Landespolitikerin Claudia Hämmerling im Abgeordnetenhaus dafür geworben, jahrelang hat sie sich mit Tierversuchen beschäftigt, Labore besucht, Studien gelesen, kritische Nachfragen gestellt.
"Naja, im Wissenschaftsbereich ist dann höfliches Nicken und dann war das das Gespräch, und man kriegt mit, dass man nicht für ernst genommen wird, dass die Leute dann glauben, man gehört zu diesen durchgeknallten Tierschutztussis … damit muss man dann halt leben. Wenn man davon überzeugt ist, macht man das aber auch …"
Selbst in ihrer eigenen Partei, bei Bündnis90/Die Grünen, stieß Hämmerling lange auf Desinteresse. Wenn es wenigstens Widerspruch gewesen wäre – dann hätte man drüber streiten können.
"Durchaus so, dass die sich angehört haben, was ich zu sagen hatte, die Kolleginnen und Kollegen, aber es gab überhaupt keine Erwiderung. Also sie kommen sich vor als wären sie irgendwie in so einem Watteraum und alles, was sie sagen, stößt an eine Wand, reflektiert nicht, ist weg."
Ende 2017: Claudia Hämmerling, die mittlerweile aus der aktiven Landespolitik ausgestiegen ist, erhält den Ehrenpreis für Tierschutz des Berliner Senats.
Es ist eine Würdigung für Claudia Hämmerling – die sich mit ihrem Einsatz lange Zeit sich zur Außenseiterin machte. Mittlerweile ist es nicht mehr nur eine "durchgeknallte Tierschutz-Tussi", die den Systemwechsel fordert, sondern auch der Dekan der Berliner Charité, eine der größten Universitätskliniken Europas.
Wann wird der Systemwechsel kommen? Nur dann, wenn die Qualität der Alternativen besser für den Menschen ist. Wieviel Leid dürfen wir fühlenden, unserer Macht unterworfenen Wesen antun? Kann man den Nutzen für den Menschen und das Leid der Tiere überhaupt gegenüber abwiegen? Und wird das am Ende eine Rolle in Wissenschaft und Politik spielen? Hat das Mitleid für andere Spezies überhaupt Platz, wenn es um unser Leid, um Krankheit und Tod geht? Wo Tierversuche Potential haben, werden sie deshalb bleiben. Oder werden wir das Privileg aufgeben, alle Mittel und Wesen zu unserem eigenen Vorteil zu nutzen, so wir es können?