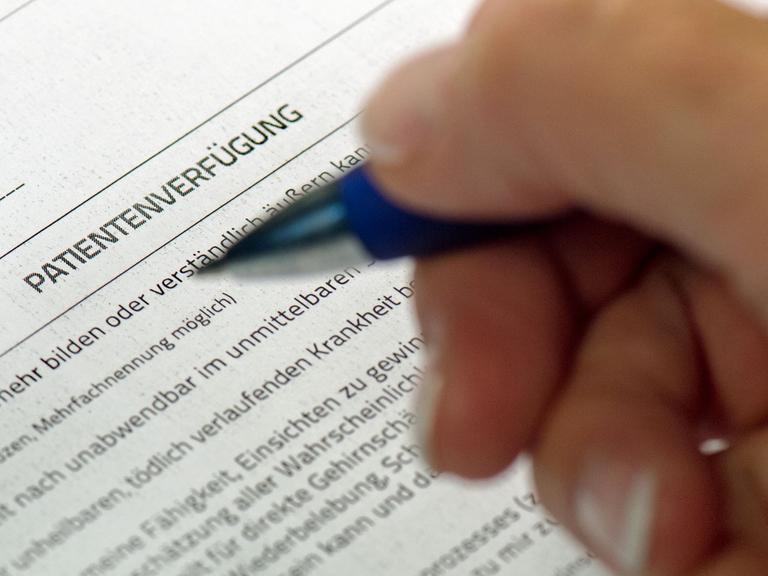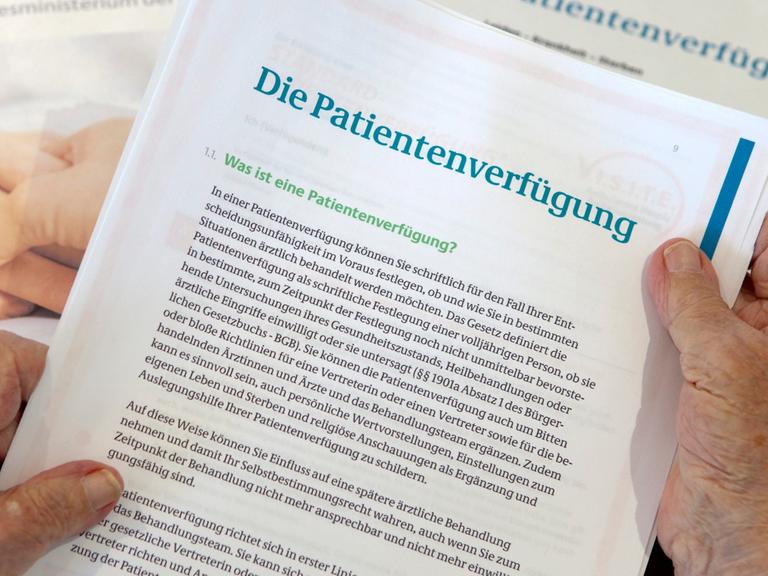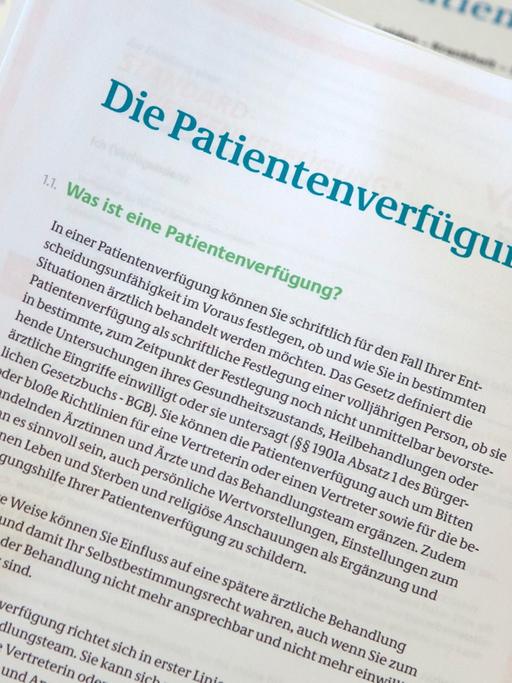Nur jede 50. Patientenverfügung greift im Notfall
29:02 Minuten

"Man soll mich in Ruhe sterben lassen." Gegen sinnlose medizinische Behandlungen am Lebensende wappnen sich viele Menschen mit einer Patientenverfügung. Doch damit, einfach nur den entsprechenden Fragebogen im Internet auszufüllen, ist es oft nicht getan.
Die moderne Hightech-Medizin macht vielen Menschen gerade zum Ende ihres Lebens hin Angst. Millionen Menschen wappnen sich daher mit einer Patientenverfügung und hoffen so, sinnlose Therapien zu verhindern.
"Ich will keine künstlichen Maßnahmen zur Lebensverlängerung, wenn ganz offensichtlich die Situation eingetreten ist, dass das Ende bevorsteht", sagt ein Berliner Heimbewohner. "Man soll mich in Ruhe sterben lassen. Und ich will nicht lange noch gequält werden. Wenn man sieht, da ist normalerweise nichts mehr zu machen, dann soll man nicht eingreifen und das irgendwie erzwingen wollen."
Vor vielen Jahren hat der Mann, der seinen Namen nicht im Radio nennen will, deshalb eine entsprechende Verfügung verfasst. Damals war noch unklar, wie verbindlich so ein Schriftstück überhaupt ist. Erst nach langem Zögern, hat sich die Politik schließlich auf dieses Thema eingelassen.
Im Juni 2009 verabschiedet der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Patientenverfügung. Durchgesetzt hat sich der Entwurf des SPD-Abgeordneten Joachim Stünker: Seither kann jeder verbindlich festlegen, wann Medizin für ihn sinnlos wird. Und das völlig unkompliziert, ohne zeitliche Begrenzung, ohne Beratungspflicht und ohne notarielle Beglaubigung.
Doch jetzt, zehn Jahre später, kommt Skepsis auf. Viele Patientenverfügungen sind in der Praxis unwirksam, weil sie zu kurz greifen, sagen Experten. Zusätzlich erklärte der Bundesgerichtshof 2018 den Großteil der Verfügungen für ungültig. Typische Formulierungen wie "lebenserhaltende Maßnahmen" und "keine künstliche Ernährung" seien zu ungenau, so die Richter. Seitdem haben Beratungsstellen Hochkonjunktur. Der Humanistische Verband Deutschlands, kurz HVD, unterhält in Berlin ein solches Beratungszentrum. Pro Jahr kommen an die 1000 Ratsuchenden hierher. Und es zeigt sich immer wieder: Beratung ist bitter nötig.
Es gibt keine Wiederbelebungsmaßnahmen mit Erfolgsgarantie
Eine familiäre Tragödie hat dieser jungen Berlinerin zugesetzt. Nach einer langen, vielleicht zu langen Reanimation liegt ihr Onkel im Wachkoma. So möchte sie niemals enden. Jetzt will sie verfügen, dass sie im Fall der Fälle selbst nicht zu lange reanimiert wird.
"Und dann würde ich vielleicht noch fünf Minuten wiederbelebt werden und wäre schwer geistig behindert und meine Familie müsste mich pflegen", sagt sie. "Das finde ich schlimmer, als jetzt zu sagen: Na gut, dann ist es halt so, dann bin ich halt tot."
Doch eine Wiederbelebung mit Erfolgsgarantie gibt es nicht. Da hilft auch keine Patientenverfügung, betont Elke Rasche, die die Berliner Beratungsstelle des HVD leitet.
"Die denken aber, wenn ich jetzt reinschreibe: maximal fünf Minuten, danach möchte ich nicht mehr wiederbelebt werden nach Herzkreislaufstillstand, dass das dann tatsächlich so gemacht wird. Das ist ein Trugschluss."

Eben mal schnell ein Formular ausfüllen - damit ist es bei der Patientenverfügung nicht getan. Jedenfalls nicht, wenn sie wirken soll.© picture alliance / dpa / Arno Burgi
Wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier verfügt auch Elke Rasche über profundes medizinisches Hintergrundwissen. Das hilft, Wunsch und Wirklichkeit bei der Abfassung einer Verfügung auseinanderzuhalten.
"Wenn Sie im öffentlichen Raum einen Herzkreislaufstillstand haben, setzt die ganze Rettungsmaschinerie ein. Da kann man gar nichts gegen machen. Das passiert, weil kein Notarzt mit der Stoppuhr dasteht. Das funktioniert nicht."
Argumente, die schließlich auch der Klientin einleuchten. Sie hat ihre Verfügung entsprechend geändert. Gut, dass sie sich nicht, wie die meisten Verfasser einer solchen Verfügung, mit einem Internetformular begnügt hat.
"Ich persönlich finde es zum Beispiel schwierig, reine Internetfragebögen auszufüllen", sagt Rasche. "Damit habe ich das schnell erledigt. Manche Menschen möchten das Thema schnell hinter sich haben. Was ich auch verstehen kann. Wer setzt sich schon gerne mit diesen Fragen zum eigenen Sterben und Tod auseinander? Aber genau darum kann ich das nicht im Internet machen. Ich brauche ein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen kann. Es geht um Wertvorstellungen. Es geht um Ethik. Es geht um Religionen. Es geht um Lebensqualität. Das muss besprochen werden."
Die formulierte Bedingung muss exakt zutreffen
Patientenverfügungen haben einen typischen Aufbau. Vernünftigerweise knüpft man den Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen immer an Bedingungen. Häufig findet man Formulierungen wie diese:
"Wenn bei mir eine schwere Hirnschädigung eingetreten ist und zwei Fachärzte unabhängig voneinander feststellen, dass ich nie mehr das Bewusstsein erlangen werde, dann möchte ich, dass die Ernährung über eine Sonde eingestellt wird."
Für den Arzt ist so eine Aussage verbindlich. Das Dokument ist vergleichbar mit einem Vertragstext. Interpretationen sind nicht möglich. Und so darf die Therapie also nur dann abgebrochen werden, wenn die formulierte Bedingung exakt zutrifft.
"Und das verstehen Angehörigen nicht, weil sie im guten Glauben waren, dass der Vater, die Mutter, die Schwester, ein Papier geschrieben hat, das jetzt irgendeine Problemsituation lösen soll", sagt Kristjan Diehl von der Stiftung Patientenschutz. "Deshalb entstehen so viele Missverständnisse."
Diehl leitet in München eine Schiedsstelle, die bei der Umsetzung der Patientenverfügung vermittelt. Nach seiner Erfahrung ist es immer wieder das gleiche Missverständnis, das zu Konflikten führt: Die Angehörigen gehen von falschen Gewissheiten aus.
"Nur die Patientensituationen, die dann eintreten zum Beispiel nach einem Schlaganfall, sind in den ersten Anfangstagen der Erkrankung der Behandlung noch sehr, sehr weit weg von diesen möglichen irreversiblen Behandlungssituationen", erklärt er. "Das heißt, es entsteht ein Vakuum über Tage, Wochen, gar Monate, in denen die Zukunft eines Patienten noch nicht gewiss sein kann. Die Angehörigen glauben aber, dass die Patientenverfügung bereits greifen würde. Sie meinen, diese Behandlung müsse abgebrochen werden."
Die Politik hat falsche Erwartungen geweckt
Doch hatte die Politik mit der Einführung der Patientenverfügung nicht genau das versprochen? Selbstbestimmung gerade im Notfall, gerade wenn auf der Intensivstation die lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet werden? Patientenverfügungen dürfen aber nicht willkürlich interpretiert werden. Das Problem sind die falschen Erwartungen, die von der Politik geweckt wurden. Kein Wunder also, wenn Angehörige sich von den Ärzten übergangen fühlen. Und nicht selten verhärten sich die Fronten. Viel Arbeit für das Team der Münchner Schlichtungsstelle:
"Das Erste ist, dass wir den Menschen, die sich aufgewühlt an uns wenden, Zeit geben, die Situation zu besprechen. Um dann zu beschreiben, was ist passiert? Wenn die Patientenverfügung doch anwendbar sein sollte, dann unterstützen wir die Menschen argumentativ für das nächste Gespräch mit den Ärzten", so Diehl. "Und sollte diese Kommunikation, die dadurch entsteht, nicht zu einem guten Ziel für alle Beteiligte führen, dann sind wir auch diejenigen, die selbstverständlich zum Telefonhörer greifen, um die Sicht der Ärztinnen und Ärzte zu erfragen. Und so geht es manchmal hin und her, bis die Informationen alle auf dem Tisch liegen. Und dann entsteht Vermittlung, entsteht Klarheit, entsteht Durchsetzung von Patientenwillen."
Doch Schlichtungsstellen sind rar gesät. Und ohne entsprechende Moderation, drohen solche Konflikte schnell aus dem Ruder zu laufen. Ärzte fühlen sich durch aufgebrachte Angehörige in ihrer Arbeit behindert. Vormundschaftsgerichte werden eingeschaltet. Nicht selten vergehen Wochen, bis eine Einigung erzielt wird. Kein Wunder also, dass einige Kliniken Gegenstrategien entwickeln, um den störenden Zwist mit den Angehörigen im Keim zu ersticken. Doch damit hebeln sie oft auch die Patientenverfügungen gleich ganz mit aus.

Im Notfall müssen Ärzte helfen.© picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg
"Am 10. 7. ist meine Mutter in der Einfahrt beim Blumengießen umgekippt und mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht worden", berichtet eine Angehörige, die anonym bleiben möchte. Der Notarzt brachte ihre Mutter daraufhin in die neurochirurgische Abteilung eines Klinikums im Ruhrgebiet.
"Bis ich im Krankenhaus war, war meine Mutter schon längst im OP und wurde operiert."
Eine massive Hirnblutung war die Ursache. Es musste sofort gehandelt werden. Im Notfall geht das natürlich auch ohne Rücksprache.
"Die Patientenverfügung habe ich dann am Nachmittag im Krankenhaus vorgelegt und habe mit dem Stationsarzt direkt darüber gesprochen, dass meine Mutter eine Patientenverfügung hat, ich vorsorgebevollmächtigt bin und wir im März des gleichen Jahres noch darüber gesprochen hatten und die Patientenverfügung neu erstellt hatten."
"Es lag nur noch eine Hülle da"
Bei dieser Gelegenheit hatten Tochter und Mutter genau die Situation durchgesprochen, die nun eingetreten war. Eine massive Hirnschädigung, die die Mutter mit großer Wahrscheinlichkeit zur Komapatientin gemacht hätte. Genau das wollte sie auf keinen Fall. In so einer Situation sollte die Tochter darauf drängen, dass die Intensivtherapie abgebrochen wird. Aber die Ärzte stellten sich stur:
"Es gab da überhaupt kein Miteinander", beklagt die Tochter. "Es war einfach nur immer ein Kampf gegeneinander. Sie gehen weiter ihren Weg, weil sie davon überzeugt sind, dass meine Mutter wieder laufend das Krankenhaus verlässt, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken. Und meine Mutter war vom ersten bis zum letzten Tag komatös, also nicht mehr ansprechbar, nicht mehr reaktionsfähig, nicht mehr in der Lage, auf Reize zu reagieren, nicht auf Berührung. Also, es lag nur noch eine Hülle da."
Doch obwohl die Not-OP offenbar gescheitert war, wurde weiter nach Schema F behandelt.
"Das spitzte sich ja dann immer mehr zu. Also, es wurde immer mehr gemacht. Es wurde dann eine PEG gelegt, es wurde eine Tracheotomie gemacht und all die Dinge, die nicht gemacht werden durften. Und ich bin ja wie gesagt Vorsorgebevollmächtigte gewesen. Und all diese Dinge sind ja unterschriftspflichtig. Und, ja, ich habe keine Unterschrift geleistet für die ganzen Sachen. Und es wurde auch nichts protokolliert, in den Krankenhausakten. Aber es wurde fröhlich weitergemacht."
Luftröhrenschnitt und Magensonde durch die Bauchdecke, all das war für die Ärzte die logische Fortführung der Notoperation bei Aufnahme. Nach der man keine Einwilligung braucht. Juristisch bewegten sich Ärzte damit aber auf dünnem Eis, meint der Münchner Patientenanwalt Wolfgang Putz:
"Also, man kann nicht sagen: Solange ein Notfall von uns Ärzten als Notfall bezeichnet wird, brauche ich die Zustimmung der Vertreter nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn der rechtliche Vertreter beim Notfall zugegen ist, muss man dessen Zustimmung einholen. Natürlich muss der dann akzeptieren: Es ist ein Notfall und es wird jetzt erst mal was gemacht. Aber er muss ja zustimmen."
Viele Angehörige knicken gegenüber den Ärzten ein
Im Konfliktfall ist ein Vorsorgegericht zuständig. Doch bis die aktiv werden, kann es dauern. Das teure Intensivbett wird aus Sicht des Krankenhauses unkalkulierbar lange blockiert. Normalerweise ist in solchen Fällen die zügige Verlegung in die Reha längst geplant. Und sich auf einen verlängerten Notfall zu berufen, kommt da sehr gelegen. Für die meisten Angehörigen eine schwierige, kaum auszuhaltende Situation, viele knicken den Ärzten gegenüber dann oft auch ein. Doch die Tochter, eine erfahrene Krankenschwester, hat genau richtig gehandelt, meint der Münchner Anwalt Putz:
"Dann muss man halt gegen diese Ärzte vorgehen. Erstens kann man immer den Arzt wechseln, als Betreuer oder Bevollmächtigter. Zweitens kann man den Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegen. Es gibt kein Leibeigentum an den Patienten. Also, eine Klinik kann nicht sagen: Bei uns wird so behandelt, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Die kann sagen: Wir machen das und das nicht. Aber dann müssen sie den Patienten 'freigeben'. Sie müssen eben dulden, dass der Patient verlegt wird. Und das, was man dann als Anwalt organisiert, ist die sofortige Übernahme durch einen vernünftigen Arzt. Es ist aber immer schwierig, eine Behandlung juristisch in die richtigen Wege zu leiten. Es ist viel einfacher, eine Behandlung in die richtigen Hände zu geben."
Ein Palliativmediziner bestätigte schließlich die Einschätzung der Tochter und nahm sich der Mutter an. Mehrere Wochen sinnloser Intensivbehandlung endeten mit ihrer Verlegung direkt auf eine Palliativabteilung.
"Ich bin sehr glücklich, dass meine Mutter dann so friedlich gehen durfte. Es war sehr schön, im ganzen Kreise unserer ganzen Familie und den Hunden meiner Mutter, die waren auch dabei. Die letzten Tage des Gehens waren sehr, sehr friedlich und mit Liebe umhüllt und behütet und ohne Schmerzen, und das war ein ganz tolles Erlebnis."
Die meisten Ärzte wollen im Sinne des Patienten handeln
Der Wille des Patienten als Störfaktor im betriebswirtschaftlich optimierten Ablauf einer Klinik? Clevere Ärzte, die eine Patientenverfügung einfach umgehen? Daran hatte sicher niemand gedacht, als das Gesetz zur Patientenverfügung konzipiert wurde. Und dennoch sind solche Fälle mittlerweile Realität.
"Wenn man genau weiß, was seine Mutter möchte und was sie nicht möchte und wenn es auch noch schriftlich festgehalten ist. Und dann keiner da ist, der dem Weg folgt oder auch nur ein Ohr dafür hat. Ich hätte nie gedacht, auch aufgrund meiner fachlichen Ausbildung, dass mir das passieren könnte. Aber die Maschinerie ist mächtig. Und ja, uns ist das auch passiert."
Noch sind solche Vorfälle auch die Ausnahme. Die allermeisten Ärzte nehmen die Herausforderung an, Medizin im Sinne des Patienten zu betreiben. Aber selbst unter diesen Bedingungen versagt die Patientenverfügung viel zu oft. Etwa wenn eine Heimbewohnerin oder ein Heimbewohner bewusstlos als Notfall in eine Rettungsstelle gebracht wird. Denn auch wenn viele ältere Menschen genau für diesen Fall eine Patientenverfügung verfasst haben, hilft sie dem Arzt in der Notaufnahme aber wirklich, um die richtigen therapeutischen Entscheidungen zu treffen? Genau diese Frage hat der Intensivmediziner Steffen Grautoff zusammen mit seinen Kollegen am Beispiel der Rettungsstelle in Herford untersucht.
"Es wird immer unter Medizinern gesagt, dass Patientenverfügungen eigentlich wenig Wert haben", sagt Grautoff. "Dann hab ich aber mal geschaut in der Literatur. Und da gab es jetzt keine Studien, die diese Behauptung bislang objektiviert haben. Und dann habe ich gedacht: Hat noch keiner untersucht. Dann müssen wir das wohl tun."
Der Großteil der Heimbewohner, die als Notfall bewusstlos in die Herforder Notaufnahme eingeliefert wurden, hatte eine Patientenverfügung, die auch vorlag.
"Falls das der Fall war, haben wir geschaut, ob diese Patientenverfügung auch von den behandelnden Ärzten benutzt werden kann, um zu schauen: Wollen diese Patienten in dieser Konstellation, auf die Intensivstation? Wollen die noch Dialyse? Wollen sie beatmet werden? Oder kann man das anhand von den Angaben in den Patientenverfügungen gar nicht erkennen?"
Die Auswertung dieser Daten verblüffte die Experten dann doch:
"Die Zahlen waren überraschend schlecht, muss man sagen", so Grautoff. "Es war nur in einem einzigen Fall so, dass man sich ausschließlich auf die Patientenverfügung verlassen hat. Es gab durchaus Fälle, wo man die Patientenverfügung mitbewertet hat, aber auch dann den mutmaßlichen Willen mit einbezogen hat. Und in den allermeisten Fällen war es tatsächlich der mutmaßliche Wille alleine, der gezählt hat."
Trotz Verfügung muss über den Willen spekuliert werden
Wie die Untersuchung der Herforder Notfallmediziner gezeigt hat, gelingt es nur jedem 50. Patienten, seine Verfügung so zu formulieren, dass sie im Notfall gültig wird. In den meisten Fällen muss deshalb über den mutmaßlichen Willen spekuliert werden.
"Man muss dann wie so ein Mosaikstück ganz viele Informationen zusammen sammeln. Eben von Angehörigen, vom Hausarzt, von Freunden, um die Einstellung des Patienten einordnen zu können."
Oft gelingt es so nicht, diesen mutmaßlichen Willen mit hinreichender Sicherheit zu rekonstruieren.
"Wenn ich diese Informationen nicht herausfinden kann... Das heißt, es ist Freitagabend, der Hausarzt ist nicht erreichbar, die Angehörigen sind vielleicht auf der Anfahrt. Aber es zeigt sich jetzt hier ein lebensbedrohliches Bild und den Patienten selber kann ich gar nicht befragen, dann würde ich natürlich erstmal eine Maximaltherapie machen", sagt Grautoff.
Dann geschieht genau das, was viele der Betroffenen verhindern wollten: Weil ihre Patientenverfügung keine eindeutigen Aussagen zulässt, kommen sie eben doch auf die Intensivstation. Die Patientenverfügung als Instrument der Selbstbestimmung im Notfall: Ausgerechnet dieses zentrale Versprechen scheitert offenbar an der Realität. Das merken die meisten Angehörigen aber erst, wenn es zu spät ist. Wenn Vater oder Mutter schon auf der Intensivstation liegen, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollten. Doch spätestens dort, auf der Intensivstation, sollte die Patientenverfügung eigentlich wirksam werden. Die Berliner Versorgungsforscherin Christiane Hartog hat genau das im Rahmen einer klinischen Studie auf einer großen Intensivstation überprüft.
"Vom gesunden Menschenverstand würde man ja annehmen, dass Menschen, die in Patientenverfügungen sagen: Sie möchten bestimmte Therapien nicht, dann am Ende ihres Lebens auch mit weniger Therapien behandelt werden", sagt sie. "Das hat sich aber in den Daten nicht niedergeschlagen, als wir rückwirkend geschaut haben."
Das Problem liegt in der Struktur der Patientenverfügung
477 intensivmedizinische Behandlungsfälle haben Christiane Hartog und ihr Team ausgewertet. Das Ergebnis verblüfft: Auf einer typischen Intensivstation hat das Vorhandensein einer Patientenverfügung keinerlei Einfluss darauf, ob und wie lange Organersatzverfahren eingesetzt werden oder wie lange die Intensivtherapie dauert. Anlass für die Forscherin, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Und es zeigte sich: Das Problem liegt in der Struktur der konventionellen Patientenverfügung.
"Der Knackpunkt ist die Beschreibung der klinischen Situation, in der das gültig sein soll", betont Hartog. "Also, ich möchte keine Dialyse im Falle - wenn ich das mal hier zitieren soll aus Patientenverfügungen - einer schweren Dauerschädigung des Gehirns oder im unabwendbaren Sterbeprozess. Der unabwendbare Sterbeprozess… Kein Mensch weiß, wann der einsetzt. Wie lange dauert das? Jeder interpretiert das anders. Und das ist das ganz große Problem, weil die Angehörigen gesagt haben: Sie kennen den Patientenwillen gut und sie haben hier schwarz auf weiß und unterschrieben, was gemacht werden soll. Und nun, liebe Ärzte, macht das doch bitte! Und dann das große Erstaunen, dass die Ärzte sagen: Wir können das gar nicht klar sagen aufgrund der Formulierungen."
Damit hat die Studie genau das Problem wissenschaftlich beschrieben, mit dem sich die Schiedsstelle der Stiftung Patientenschutz schon seit Jahren herumschlägt. Für die Berliner Forscherin Christiane Hartog ist es also höchste Zeit, Konsequenzen zu ziehen:
"Herkömmliche Patientenverfügungen kann man nicht verbessern, weil sie falsch aufgebaut sind. Der Aufbau, dass man klinische Szenarien beschreibt, die in der Zukunft stattfinden können, ist ein Irrweg. Ich fände es sinnvoller, wenn Patienten festlegen oder einen Hinweis geben, welchen Preis sie bereit sind zu bezahlen mit einer lebensverlängernden Therapie. Wie viel Folgeschäden würden sie akzeptieren? Wie groß darf das Risiko sein für schwerste Pflegebedürftigkeit? Ich glaube, in diese Richtung kommen wir hier weiter."
Für sich selbst zieht die Forscherin aus ihren Untersuchungen eine klare Konsequenz:
"Ich selbst habe keine Patientenverfügung, sondern ich habe mich mit meinem Mann ausführlich darüber unterhalten und der weiß, wie ich denke. Und ich vertraue darauf, dass er sozusagen meinen Willen umsetzt in meinem Sinne. Und ich vertraue darauf, dass ich auf Ärzte stoße, die klinisch, ethisch soweit fit sind, dass sie meine spezielle Situation berücksichtigen. Weil, auf ein Stück Papier lege ich meine Hoffnung nicht."
Schnelle Verfügbarkeit ist nicht das entscheidende Problem
Entgegen der landläufigen Meinung ist das entscheidende Problem der Patientenverfügung also nicht die schnelle Verfügbarkeit der Papiere. Sondern dass die Verfügung im Notfall gar nicht greift. Stattdessen muss dann doch wieder über den Patientenwillen spekuliert werden, Patientenverfügung hin oder her.
Das hat in der Zwischenzeit auch die Bundesregierung eingesehen: Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, hat sie 2015 die "Patientenverfügung 2.0" auf den Weg gebracht. "Behandlung im Voraus planen" nennt sich die in den USA bereits sehr erfolgreiche Idee. Ausgebildete Beratungskräfte helfen älteren Menschen dabei, ihren Willen so zu formulieren, dass er tatsächlich greift. In einem Modellprojekt sammelt der Caritasverband der "Erzdiözese München und Freising" erste Erfahrungen mit dieser Idee. Im Pflegeheim des Kreszentia-Stifts wird seitdem niemand mehr am Lebensende gegen seinen Willen auf eine Intensivstation gebracht. Patientenberaterin Gabriele Port führt das Erstgespräch mit einer neuen Heimbewohnerin. Die 85-jährige Münchnerin hat zwar schon eine Verfügung. Aber die ist ihr zu unsicher:
"Also, auf jeden Fall möchte ich nicht die Herz-Lungen-Massage, Wiederbelebung - das möchte ich nicht haben. Dann sollen sie mich dann lassen. Auch wenn ich Lungenentzündung hab, möchte ich auch nicht ins Krankenhaus, sondern mir hier die Medikamente, was es halt so gibt, was man noch machen kann, und mich in Ruhe sterben lassen."
"Behandlung im Voraus planen" ist nicht einfach nur eine besser formulierte Patientenverfügung, sondern es geht zuallererst darum, mit allen Betroffenen einen Kommunikationsprozess in Gang zu setzen.
"Die Hauptrolle ist letztendlich die Führung dieser Gespräche mit dem betreffenden Gegenüber, also mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hier bei uns", sagt Patientenberaterin Gabriele Port. "Dazu kommen noch die Kontaktaufnahme und die Gesprächsorganisation mit Angehörigen, wie auch mit dem Hausarzt. Sodass alle Beteiligten letztendlich darüber informiert sind, was der Wille des Bewohners ist und dass die auch davon Kenntnis haben und es auch eventuell sogar schriftlich in der Hand haben."

Es geht darum, mit den Heimbewohnern einen Kommunikationsprozess in Gang zu setzen, sagt die Caritas-Beraterin.© imago / allOver-MEV
Entscheidend ist aber auch, dass für die konkrete Notsituation vorab geplant wurde. Nur so verhindert man unsinnige Klinikeinweisungen.
"Wir sind jedoch in der glücklichen Lage, dass die Hausärzte hier so gut eingebunden sind, dass sie sich auch gegenseitig sehr gut vertreten. Auch für nachts haben viele ihre Telefonnummer da gelassen", so Port.
Unnötige Hektik am Lebensende gibt es im Kreszentia-Stift deshalb nicht. Aus Unsicherheit ruft hier niemand nach dem Notarzt.
Da wird natürlich immer geguckt, jemand geholt, aber in erster Linie der Hausarzt. Wenn es beschlossen ist, dass er nicht mehr ins Krankenhaus will, dann wird der Angehörige noch angerufen. Das heißt, es werden alle informiert. Aber letztendlich wird der Willen, dass er nicht mehr ins Krankenhaus will, dann schon respektiert."
Tod und Sterben - in vielen Familien ein Tabuthema
Hausarzt oder Palliativmediziner begleiten die Heimbewohner vor Ort auf ihrem letzten Weg. Was hier selbstverständlich ist, ist leider immer noch eine Ausnahme. Sterben und Tod sind in vielen Familien ein Tabuthema. Beim Konzept des "Im Voraus Planen" versucht man, genau das aufzubrechen. Sabine Petri vom Caritasverband in München begleitet das Modellprojekt wissenschaftlich:
"Wir erleben das häufig, dass zum Beispiel die Tochter denkt: Oh je, der Mutter geht es immer schlechter. Was machen wir bloß, wenn … Wenn jetzt die nächste Krise wieder kommt? Traut sich aber vielleicht nicht, die Mutter anzusprechen, weil sie Sorge hat, dass die Mutter dann denkt: Sie will sie loswerden oder so was. Und umgekehrt: Die Mutter macht sich Sorgen, was bei der nächsten Krise passiert, mag aber die Tochter nicht ansprechen, weil sie sie nicht bekümmern will. Und da ist es denn oft sehr hilfreich, wenn ein Gesprächsbegleiter das Thema einfach mal strukturiert auf den Tisch bringt. Und das führt nach unserer Erfahrung sehr häufig zu einer ganz, ganz großen Entlastung in den Familien. Weil einfach klarer ist, wo der Weg hingehen soll, wenn noch mal eine gesundheitliche Verschlechterung eintritt."
Dazu sind intensive Gespräche notwendig. Schließlich müssen alle Beteiligten die Beweggründe verstehen und akzeptieren.
"Es ist klar geworden, dass es eine aufwendige Angelegenheit ist", sagt Petri. "Dass man wirklich, bis der Wille zum ersten Mal klar herausgearbeitet ist, dass es durchaus drei Stunden dauert oder länger. Dass es auf jeden Fall mindestens zwei bis drei Gespräche braucht, damit das Gegenüber gut nachdenken kann, was ihm wichtig ist."
Muss die Krankenkasse die Beratung zahlen?
Ausführliche und professionelle Beratung ist aber ist teuer. Noch hält genau das viele ab. Denn nach neuen gesetzlichen Regelungen sind die Krankenkassen zwar verpflichtet, diese Beratungsleistungen angemessen zu finanzieren. Vorerst gilt das allerdings nur für Menschen, die bereits in einem Altersheim leben.
"Das ist vor allem europaweit, ich glaube sogar weltweit neu, dass die gesetzlichen Kassen so ein Angebot unterstützen", sagt Petri. "Die Kassen finanzieren eine Vollzeitstelle für diese Gespräche für 400 Bewohner. Der gesetzliche Anspruch - oder besser gesagt: die gesetzliche Refinanzierungsmöglichkeit - besteht in ganz Deutschland. Und es entstehen jetzt auch zunehmend mehr Projekte, in denen das umgesetzt wird."
Gut so. Denn auch wenn für Deutschland noch keine Daten vorliegen, zeigen Untersuchungen aus den USA, wo "Advance Care Planning" schon seit Jahrzehnten etabliert ist, dass es den notfall- und intensivmedizinischen Aufwand am Lebensende nachweislich reduziert. Bleibt also zu hoffen, dass sich das Konzept "Behandlung im Voraus planen" trotz der teuren Beratungskosten auch hierzulande flächendeckend durchsetzt und die Patientenverfügung einlösen lässt, was sie verspricht: Den Willen der Menschen, was am Lebensende mit ihnen passiert, verbindlich festzuhalten. Auch damit es allen geht wie dieser Heimbewohnerin:
"Ich bin beruhigt, weil ich weiß, wenn es soweit ist, werde ich nicht wieder zurückgeholt, sondern kann dann mich in Frieden dahin schon vorbereiten."