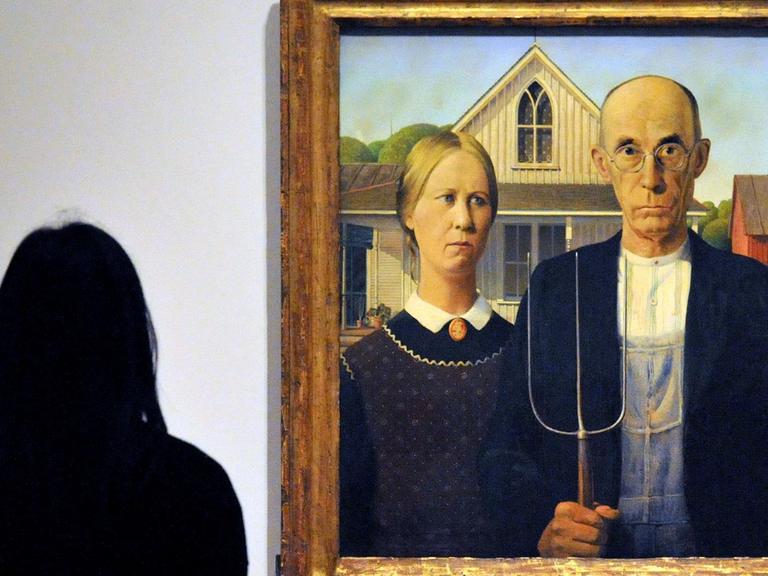Seit Monaten sind viele Museen geschlossen – Warum die unendlich scheinende "Kunstpause" nicht nutzen, um mal zu träumen? Deshalb haben wir DirektorInnen und KuratorInnen gebeten, ein paar Utopien zu formulieren: Welche Ausstellung sie gern gestalten würden, wenn sie frei von allen Zwängen wären. Die Antworten präsentieren wir in unserer Reihe "Imagine – Was ich unbedingt einmal ausstellen möchte".
Das Freundschaftsbändchen des 19. Jahrhunderts
06:03 Minuten

In unserer Reihe „Imagine – Was ich unbedingt einmal ausstellen möchte“ fragen wir Kuratorinnen und Kuratoren, was sie gerne zeigen würden, wenn sie frei wären von sämtlichen Zwängen. Miriam Szwast würde am liebsten Memorial-Schmuck präsentieren.
Wenn Miriam Szwast könnte, wie sie wollte, würde sie gerne Memorial-Schmuck aus dem 19. Jahrhundert ausstellen. Die Kuratorin der Fotografischen Sammlung am Museum Ludwig in Köln lässt das Thema nicht mehr los, seit sie im Museumsdepot auf Schmuckstücke gestoßen ist, in die kleine Fotografien eingearbeitet waren. Dabei handelt es sich um Halsketten, Anhänger, Ringe, Ohrringe, Hutnadeln und Armreifen, also "Andenkensschmuck, der von Personen getragen wurde, die irgendeine Beziehung zu der Person hatten, die man auf dem eingearbeiteten Foto sieht", wie Szwast erklärt.
Doch so kleine Objekte auszustellen ist herausfordernd: "Die sehen in einer Vitrine meines Erachtens ziemlich verloren aus", meint Szwast. Außerdem handelt es sich bei den eingearbeiteten Fotos um sogenannte Daguerreotypien. Gemeint ist das erste, seit 1839 kommerziell nutzbare Fotografieverfahren. Bei dieser Technik werden die Fotografien auf versilberte Kupferplättchen abgezogen. "Das ist fast wie ein Spiegel, das heißt: Man erkennt die Porträts wirklich nur in einem guten Winkel. Das macht das Ganze ziemlich unsexy zum Ausstellen in der Vitrine", erklärt Szwast.
Intimität versinnbildlichen
Solchen Schmuck anfertigen zu lassen, sei im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen, erklärt die Kuratorin: "Das Ganze hat eine Tradition, die bis in die Zeit um 1800 zurück reicht, in der Freundschaften und Liebe in so einer Art kultiviert wurden, dass man quasi eine Reliquie der anderen Personen bei sich hatte."
Das seien aber nicht nur Fotos gewesen, oft habe es sich auch um Haare der geliebten Person gehandelt, die man bei sich haben wollte – vor allem vor Etablierung der Daguerreotypie.
Manche Armbänder waren demnach aus Haaren von Freunden geflochten, oder es waren Haare in Ringe und Broschen eingelassen. Man wollte also etwas von dem liebgewonnenen Menschen am Körper tragen, wie Szwast erklärt, "diese Intimität der Beziehung zu einer Person auch wirklich versinnbildlichen durch diese Nähe der Haare beziehungsweise dann eben ab 1839 der Fotografien".
Eine Möglichkeit, diesen Memorial-Schmuck so auszustellen, dass er auch wirklich zur Geltung kommt, wäre, diesen in der Ausstellung von Models tragen zu lassen. "Diese Schmuckstücke waren körperwarm, die wurden auf der Haut getragen. So war es gedacht. Das fände ich reizvoll, wenn man das machen könnte." Eine Vorstellung, die aus konservatorischen Gründen jedoch unmöglich ist, wie Szwast sagt und die Idee wieder ad acta legt.
(ckr)