Mephistos Moderne
Reisend, suchend, nie innehaltend - Fausts rastloses Streben scheint Vorlage für unsere moderne Zivilisation, die durch Begriffe wie Mobilität und Schnelllebigkeit gekennzeichnet ist. In seinem Essay "Global Player Faust" zieht Michael Jaeger Parallelen zwischen Goethes Drama und der heutigen Gesellschaft - und zeigt, wie der Versuch, die Gegenwart durch ständige Erneuerung zu überwinden, letztendlich scheitern muss.
"Das verfluchte Hier!",
ruft Faust kurz vor seinem Ende. So rufen alle, die am sausenden Webstuhl der Zeit rastlos tätig sind, um mit ununterbrochenen Innovationen und Kreationen die Zukunft zu gestalten. Der Kapitalist, immer neuer Dinge begierig, kennt kein Lob des Kairos, des glückhaften, erfüllten Augenblickes, in dem Vergängliches und Ewigkeit während einem Wimpernschlag wunderbar verschmelzen. Das Bedürfnis nach der Überholung der jeweiligen Neuzeit zur allerneusten Neuzeit jagt ihn über die ganze Erdkugel, überall muss er sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Er hat keine Zeit und stattdessen nur Termine.
Trotz neuer Marken für neugierige Kunden auf immer neuen Märkten entzieht sich die Zukunft dennoch seinem planenden Zugriff und weicht wieder und wieder in weitere Fernen zurück. So bleibt er unbefriedigt von jedem Augenblick. Dem weltweit ausgreifenden Aktivisten geht es wie Goethes Dr. Heinrich Faust. Dieser ehemalige Wissenschaftler, Unternehmer, Reeder, Großhändler, Landgewinner und Immobilienmakler, hat nur begehrt und nur vollbracht, um weiter zu wünschen und zu schaffen und im rastlosen Tätigsein Qual und Glück zu finden. Wer wagt gewinnt und dem Tüchtigen als schöpferischem Zerstörer ist diese Welt nicht stumm, die er vielmehr nach seinen Plänen verändert. Wird sie dadurch schon nicht gut, so wird sie wenigstens besser als die unzulängliche Gegenwart, auf jeden Fall aber anders.
Faust wettete mit Mephisto:
"Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst Du mich mit Genuss betrügen,
Das sei für mich der letzte Tag"
Nur auf den morgigen Tag ausgerichtet, entzieht sich ihm endlich die Wirklichkeit. Darin liegt das Dilemma der Zeitlosen, ohne Gestern und Heute, und der Ortlosen, die ubiquitär sind, wie das Geld, hinter dem sie her jagen, und das sie über den Erdkreis treibt. Goethes Antiheld, der nicht frei ist, sondern der Magie des dynamischen Papiergelds, des Goldes und andere Werte erliegt, die Mephisto ihm herbeischafft, ist für den Berliner Germanist Michael Jaeger in seinem Essay "Global Player Faust oder Das Verschwinden der Gegenwart" der Prototyp des modernen Kapitalisten, der die Welt in einen progressiven Produktionsprozess ohne Ziel verändert.
Er weiß zwar nicht, wohin er will, aber dafür ist er umso schneller da, immer höhere Gewinne einheimsend und immer weiter wirkend. Goethe nannte diese besinnungslose Beschleunigung veloziferisch, Luzifer, die böse Kraft, mit der Velocitas, der Mobilität um ihrer selbst willen verbindend. Goethe erschrak davor, wie man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeise und den Tag im Tag vertue. Erscheinungen, die der schwärmerische Sozialingenieur Graf Claude Henri Saint-Simon in ein System brachte, das Goethe kannte, während er die letzten Akte seiner Tragödie entwarf. Saint-Simon begriff die Moderne als Verpflichtung zur unablässigen Modernisierung und Dynamisierung.
"Es ist ausschließlich die Zukunft, auf die der Mensch bedingungslos seine Aufmerksamkeit zu richten hat."
Kapitalisten verstanden um 1900 diese Mahnung unbedingt als "faustisch" und sich selbst als Ausdruck der "faustischen Seele", wie Oswald Spengler sie ihnen später einprägsam umschrieb.
Das Projekt der Moderne begriff Saint-Simon als einen langen Prozess, sich mit Hilfe von Industrie und Wissenschaft von der Natur und der Geschichte zu emanzipieren, sich also aus der Abhängigkeit von physischen wie historischen Bedingungen zu befreien. Die unbefriedigenden Gegenwarten müssen liquidiert werden, um ins künftige Reich der sich unendlich fortproduzierenden Freiheit zu gelangen. Dies Reich ist eine neue, eine zweite Schöpfung, hergestellt vom planenden Menschen und von ihm in Bewegung gehalten durch unbedingte Tätigkeit.
"Industrie, Produktion, Arbeit und Wissenschaft bilden das Gesamtsystem der gesellschaftlichen Praxis. Arbeit ist in der neuen Welt der Industrie Organisationsinstrument und zugleich einziger Lebenssinn, weil nur die Arbeitsgesellschaft das Projekt der absoluten Perfektibilität vorantreibt."
In ihr gibt es keinen Müßiggang, keine Kontemplation, keinen Daseinsgenuss, sich und anderen in Fröhlichkeit anzugehören. Goethe, den untätigen Menschen verdrießlich stimmten, warnte allerdings auch davor, dass unbedingte Tätigkeit bankrott mache.
Faust ist dafür sein eindringlichstes Beispiel. Bis zu seinem Tode blieb Faust unzufrieden mit dem jeweils Erreichten. Den Augenblick, zu dem er sagen dürfte "verweile doch, du bist so schön", erwartete er erst in der fernen Zukunft, wenn alle in der einen Welt wimmelnd tätig sind und als Freiheit missverstehen, in Produktionsprozessen für einander da zu sein, ohne überhaupt ein Dasein im sittlichen und schönen Sinne zu kennen. Die Zukunft, die sich der erblindende und der Wirklichkeit entzogene Faust vorstellt, ist eine Welt völliger Entfremdung und Unfreiheit, in dem Funktionselemente dafür sorgen, dass der Progress-Prozess nie ins Stocken gerate. Daraus gewinnen sie ihr kollektives Heil, "faustischen" Wandlern der Welt zuarbeiten zu dürfen und mit ihnen, von ihnen bewegt, immer in Bewegung zu bleiben.
In der viel geschäftigen Betriebsamkeit witterten Christen schon früh eine Trägheit des Herzens, sich mit der sittlichen Bestimmung des Menschen und seiner Stellung in der Welt als möglichem Reich der Sittlichkeit, des Angemessenen und des ihm verschwisterten Schönen zu beschäftigen. Faust begegnete Helena, dem Schönen, dem Ideal, wie es in der Geschichte vergeht, doch in Renaissancen durch die schönen Künste zur immer neuer, immer vorübergehender Gegenwart findet.
Der flüchtige, schöne Augenblick, erfüllt vom Schein der Kunst, hilft doch hinüber ins Sein, zur Freude am Dasein.
"Dasein ist Pflicht, und wärs ein Augenblick",
rät der begeisterte Faust der schönen Helena. Denn in diesem Augenblick, jenseits von Arbeitsethos und den Erwägungen von Nützlichkeit und Erfolg, kommt es zu dem Genießen in Fröhlichkeit mit anderen. Faust und Helena sind sich einig:
"Nun schaut der Geist nicht vorwärts nicht zurück,
die Gegenwart allein -
Ist unser Glück."
Faust ließ sich von der Schönheit, und wie sie in der Geschichte wirkt, nicht verwandeln und beruhigen. Der schöpferische Zerstörer in Mephistos Hand folgte dessen Devise, dass alles was besteht, verdient zu Grunde zu gehen, vergessen zu werden um dem ewig Leeren Platz zu machen. Dessen Leere wird im hektischen Taumel von Faust und seinesgleichen durch überraschende Innovationen und Zaubereien überspielt. Der Horror Vacui, das Erschrecken vor der Leere und Sinnlosigkeit, ist der Motor, der den Zerstörern der Gegenwart keine Ruhe lässt, die letzten Reste trostloser Vergangenheiten zu tilgen.
"Faust einmal in den Sog von dieser Missachtung des Seins geraten, sieht vor dem Hintergrund des 'Ewig-Leeren’ nur noch die eine moderne Perspektive, der in die Vergänglichkeit geworfenen Existenz die pathetische Bedeutung einer heroischen Geste zu geben: dauerndes Streben ins Zukünftige."
Das brachte die dem Dasein glücklich Verhafteten wie Philemon und Baucis um ihr Dasein. Wo Leben sich des Lebens freute, trat der Unternehmer Faust als Entmieter mit sozialverträglichen Angeboten dazwischen. Nebenfolgen seiner Tätigkeit waren Tod, Brand, Verwüstung, Versumpfung, Untergang. Die Gegenwart ward zum Opfer des Zukunftsgestalters, der ein Ruinenbaumeister ist. Goethes symbolische Bilder reden von den Kosten ununterbrochener Modernisierungen. Davon handelt dieser brillante Essay.
Michael Jaeger: Global Player Faust.
Das Verschwinden der Gegenwart - Zur Aktualität Goethes
WJS Verlag, Berlin 2008
ruft Faust kurz vor seinem Ende. So rufen alle, die am sausenden Webstuhl der Zeit rastlos tätig sind, um mit ununterbrochenen Innovationen und Kreationen die Zukunft zu gestalten. Der Kapitalist, immer neuer Dinge begierig, kennt kein Lob des Kairos, des glückhaften, erfüllten Augenblickes, in dem Vergängliches und Ewigkeit während einem Wimpernschlag wunderbar verschmelzen. Das Bedürfnis nach der Überholung der jeweiligen Neuzeit zur allerneusten Neuzeit jagt ihn über die ganze Erdkugel, überall muss er sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Er hat keine Zeit und stattdessen nur Termine.
Trotz neuer Marken für neugierige Kunden auf immer neuen Märkten entzieht sich die Zukunft dennoch seinem planenden Zugriff und weicht wieder und wieder in weitere Fernen zurück. So bleibt er unbefriedigt von jedem Augenblick. Dem weltweit ausgreifenden Aktivisten geht es wie Goethes Dr. Heinrich Faust. Dieser ehemalige Wissenschaftler, Unternehmer, Reeder, Großhändler, Landgewinner und Immobilienmakler, hat nur begehrt und nur vollbracht, um weiter zu wünschen und zu schaffen und im rastlosen Tätigsein Qual und Glück zu finden. Wer wagt gewinnt und dem Tüchtigen als schöpferischem Zerstörer ist diese Welt nicht stumm, die er vielmehr nach seinen Plänen verändert. Wird sie dadurch schon nicht gut, so wird sie wenigstens besser als die unzulängliche Gegenwart, auf jeden Fall aber anders.
Faust wettete mit Mephisto:
"Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
So sei es gleich um mich getan!
Kannst Du mich mit Genuss betrügen,
Das sei für mich der letzte Tag"
Nur auf den morgigen Tag ausgerichtet, entzieht sich ihm endlich die Wirklichkeit. Darin liegt das Dilemma der Zeitlosen, ohne Gestern und Heute, und der Ortlosen, die ubiquitär sind, wie das Geld, hinter dem sie her jagen, und das sie über den Erdkreis treibt. Goethes Antiheld, der nicht frei ist, sondern der Magie des dynamischen Papiergelds, des Goldes und andere Werte erliegt, die Mephisto ihm herbeischafft, ist für den Berliner Germanist Michael Jaeger in seinem Essay "Global Player Faust oder Das Verschwinden der Gegenwart" der Prototyp des modernen Kapitalisten, der die Welt in einen progressiven Produktionsprozess ohne Ziel verändert.
Er weiß zwar nicht, wohin er will, aber dafür ist er umso schneller da, immer höhere Gewinne einheimsend und immer weiter wirkend. Goethe nannte diese besinnungslose Beschleunigung veloziferisch, Luzifer, die böse Kraft, mit der Velocitas, der Mobilität um ihrer selbst willen verbindend. Goethe erschrak davor, wie man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeise und den Tag im Tag vertue. Erscheinungen, die der schwärmerische Sozialingenieur Graf Claude Henri Saint-Simon in ein System brachte, das Goethe kannte, während er die letzten Akte seiner Tragödie entwarf. Saint-Simon begriff die Moderne als Verpflichtung zur unablässigen Modernisierung und Dynamisierung.
"Es ist ausschließlich die Zukunft, auf die der Mensch bedingungslos seine Aufmerksamkeit zu richten hat."
Kapitalisten verstanden um 1900 diese Mahnung unbedingt als "faustisch" und sich selbst als Ausdruck der "faustischen Seele", wie Oswald Spengler sie ihnen später einprägsam umschrieb.
Das Projekt der Moderne begriff Saint-Simon als einen langen Prozess, sich mit Hilfe von Industrie und Wissenschaft von der Natur und der Geschichte zu emanzipieren, sich also aus der Abhängigkeit von physischen wie historischen Bedingungen zu befreien. Die unbefriedigenden Gegenwarten müssen liquidiert werden, um ins künftige Reich der sich unendlich fortproduzierenden Freiheit zu gelangen. Dies Reich ist eine neue, eine zweite Schöpfung, hergestellt vom planenden Menschen und von ihm in Bewegung gehalten durch unbedingte Tätigkeit.
"Industrie, Produktion, Arbeit und Wissenschaft bilden das Gesamtsystem der gesellschaftlichen Praxis. Arbeit ist in der neuen Welt der Industrie Organisationsinstrument und zugleich einziger Lebenssinn, weil nur die Arbeitsgesellschaft das Projekt der absoluten Perfektibilität vorantreibt."
In ihr gibt es keinen Müßiggang, keine Kontemplation, keinen Daseinsgenuss, sich und anderen in Fröhlichkeit anzugehören. Goethe, den untätigen Menschen verdrießlich stimmten, warnte allerdings auch davor, dass unbedingte Tätigkeit bankrott mache.
Faust ist dafür sein eindringlichstes Beispiel. Bis zu seinem Tode blieb Faust unzufrieden mit dem jeweils Erreichten. Den Augenblick, zu dem er sagen dürfte "verweile doch, du bist so schön", erwartete er erst in der fernen Zukunft, wenn alle in der einen Welt wimmelnd tätig sind und als Freiheit missverstehen, in Produktionsprozessen für einander da zu sein, ohne überhaupt ein Dasein im sittlichen und schönen Sinne zu kennen. Die Zukunft, die sich der erblindende und der Wirklichkeit entzogene Faust vorstellt, ist eine Welt völliger Entfremdung und Unfreiheit, in dem Funktionselemente dafür sorgen, dass der Progress-Prozess nie ins Stocken gerate. Daraus gewinnen sie ihr kollektives Heil, "faustischen" Wandlern der Welt zuarbeiten zu dürfen und mit ihnen, von ihnen bewegt, immer in Bewegung zu bleiben.
In der viel geschäftigen Betriebsamkeit witterten Christen schon früh eine Trägheit des Herzens, sich mit der sittlichen Bestimmung des Menschen und seiner Stellung in der Welt als möglichem Reich der Sittlichkeit, des Angemessenen und des ihm verschwisterten Schönen zu beschäftigen. Faust begegnete Helena, dem Schönen, dem Ideal, wie es in der Geschichte vergeht, doch in Renaissancen durch die schönen Künste zur immer neuer, immer vorübergehender Gegenwart findet.
Der flüchtige, schöne Augenblick, erfüllt vom Schein der Kunst, hilft doch hinüber ins Sein, zur Freude am Dasein.
"Dasein ist Pflicht, und wärs ein Augenblick",
rät der begeisterte Faust der schönen Helena. Denn in diesem Augenblick, jenseits von Arbeitsethos und den Erwägungen von Nützlichkeit und Erfolg, kommt es zu dem Genießen in Fröhlichkeit mit anderen. Faust und Helena sind sich einig:
"Nun schaut der Geist nicht vorwärts nicht zurück,
die Gegenwart allein -
Ist unser Glück."
Faust ließ sich von der Schönheit, und wie sie in der Geschichte wirkt, nicht verwandeln und beruhigen. Der schöpferische Zerstörer in Mephistos Hand folgte dessen Devise, dass alles was besteht, verdient zu Grunde zu gehen, vergessen zu werden um dem ewig Leeren Platz zu machen. Dessen Leere wird im hektischen Taumel von Faust und seinesgleichen durch überraschende Innovationen und Zaubereien überspielt. Der Horror Vacui, das Erschrecken vor der Leere und Sinnlosigkeit, ist der Motor, der den Zerstörern der Gegenwart keine Ruhe lässt, die letzten Reste trostloser Vergangenheiten zu tilgen.
"Faust einmal in den Sog von dieser Missachtung des Seins geraten, sieht vor dem Hintergrund des 'Ewig-Leeren’ nur noch die eine moderne Perspektive, der in die Vergänglichkeit geworfenen Existenz die pathetische Bedeutung einer heroischen Geste zu geben: dauerndes Streben ins Zukünftige."
Das brachte die dem Dasein glücklich Verhafteten wie Philemon und Baucis um ihr Dasein. Wo Leben sich des Lebens freute, trat der Unternehmer Faust als Entmieter mit sozialverträglichen Angeboten dazwischen. Nebenfolgen seiner Tätigkeit waren Tod, Brand, Verwüstung, Versumpfung, Untergang. Die Gegenwart ward zum Opfer des Zukunftsgestalters, der ein Ruinenbaumeister ist. Goethes symbolische Bilder reden von den Kosten ununterbrochener Modernisierungen. Davon handelt dieser brillante Essay.
Michael Jaeger: Global Player Faust.
Das Verschwinden der Gegenwart - Zur Aktualität Goethes
WJS Verlag, Berlin 2008
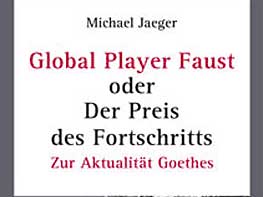
Michael Jaeger: Global Player Faust.© WJS Verlag
