Metaphern sind Glücksache
Immer mal wieder ist es an der Zeit, die Sprache der aktuellen Politik zu bedenken. Wir wissen, die Demokratie, und zumal die unsere, lebt von einer medial beförderten Geschwätzigkeit bei sich verflüchtigenden Inhalten. Doch wir wollen hier keine Einzelpersonen herausstellen bei etwas, an dem sich die gesamte politische Klasse beteiligt, mehr oder weniger, von der Kanzlerin bis zum letzten Hinterbänkler in einem von 16 Landtagen.
Von der Kanzlerin gerne benutzt wird die Wendung von der Politik der kleinen Schritte. Sie benennt damit das Tempo der von ihr angeführten Koalitionsregierung. Was ihr da so alert von den Lippen geht, meint in Wahrheit eine Politik in kleinen Schritten. Politik der kleinen Schritte wäre etwas anderes, nämlich die Manier, wie diese kleinen Schritte gesetzt werden sollen. Sprachlich ist es die Fortsetzung jener Politik der ruhigen Hand, die ihr Vorgänger Gerhard Schröder betrieb und bei der, was die Logik betrifft, die Dinge vergleichbar standen.
Metaphern sind Glückssache. Wer sich keinerlei Gedanken macht, was sie beinhalten oder was mit ihnen ausgedrückt werden will, offenbart die Inhaltslosigkeit seiner Aussage alleine dadurch. Eine gegenwärtige Vorzugsmetapher ist die Schnittmenge. Sie steht als Synonym für Gemeinsamkeit. Das hört sich etwa so an: Wir müssen prüfen, welche Schnittmengen wir mit denen haben.
Der Ursprung des Begriffes ist in der Agrartechnik zu suchen. Beim Abernten eines Feldes per Werkzeug oder Maschine entsteht eine bestimmte Menge an gemähtem Korn oder Gras. Was die Benutzer der metaphorischen Schnittmenge anlangt, so meinen sie: gemeinsame Schnittmenge, was sie aber meistens nicht sagen. Jedenfalls wollen sie die partielle inhaltliche Übereinstimmung mit einem politischen Gegenüber ausdrücken.
Auch die gemeinsame Schnittmenge ist in der Landwirtschaft zu suchen. Zwei Parten, das wären zwei Besitzer, ernten zusammen eine einzige Fläche mit Feldfrüchten ab. Warum eigentlich sollten sie das tun? Sie kämen einander bloß in die Quere. Ernten wird deshalb bloß einer von beiden, und hinterher wird die Ernte geteilt. Oder sollen wir die Metapher in der Polygraphie orten? Wo beim Beschneiden von Buchblocks eine Menge von Schnitzeln anfällt, die reine Wegwerfware sind? Sagen wir es rundheraus: Die Verwendung der Metapher Schnittmenge ist nichts als verbaler Schrott.
Werden Bücher beschnitten, entsteht eine Kante. Auch die ist derzeit eine beliebte Metapher. Der erste Kantenmann hieß Hans Eichel und war in der rot-grünen Regierung Finanzminister. Bei der Vorstellung seiner Haushalte pflegte er mitzuteilen, dieselben seien auf Kante genäht. Der Begriff kommt aus dem Schneiderhandwerk. Zwei Stoffteile werden so eng aneinander befestigt, dass Schnittfläche an Schnittfläche stößt, sich also nichts mehr an Stoff, so der Terminus, "herauslassen", das ist: erweitern oder verlängern lässt. Wenn Hans Eichel damit den Zustand der von ihm verantworteten Finanzhaushalte bezeichneten wollte, war die Wendung recht glücklich gewählt.
Inzwischen geht es den Finanzministern in unserem Land besser, dank guter Wirtschaftskonjunktur und einem Mehraufkommen von Steuern, bei denen gerne behauptet wird, sie sprudelten: als handle es sich um ein mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser. Die Kante ist uns geblieben. Neuerdings wird sie gezeigt. Behauptet wird so, dass man eine Meinung vertrete, die sich polemisch abgrenze gegen eine oder mehrere andere. Warum dafür die Kante herhalten muss, bleibt rätselhaft. Weil vielleicht der Begriff Handkante mitschwingt? Weil sich mit der Handkante schmerzhafte, womöglich tödliche Schläge austeilen lassen? Beliebt ist zudem die Mitteilung, dass man klare Kante zeige. Es gibt gerade, krumme, scharfe und stumpfe Kanten, wie aber, bitte sehr, soll eine Kante beschaffen sein, die klar ist?
Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Man schwatzt so dahin und bezeugt damit seine Inhaltslosigkeit.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Aufbau in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
Metaphern sind Glückssache. Wer sich keinerlei Gedanken macht, was sie beinhalten oder was mit ihnen ausgedrückt werden will, offenbart die Inhaltslosigkeit seiner Aussage alleine dadurch. Eine gegenwärtige Vorzugsmetapher ist die Schnittmenge. Sie steht als Synonym für Gemeinsamkeit. Das hört sich etwa so an: Wir müssen prüfen, welche Schnittmengen wir mit denen haben.
Der Ursprung des Begriffes ist in der Agrartechnik zu suchen. Beim Abernten eines Feldes per Werkzeug oder Maschine entsteht eine bestimmte Menge an gemähtem Korn oder Gras. Was die Benutzer der metaphorischen Schnittmenge anlangt, so meinen sie: gemeinsame Schnittmenge, was sie aber meistens nicht sagen. Jedenfalls wollen sie die partielle inhaltliche Übereinstimmung mit einem politischen Gegenüber ausdrücken.
Auch die gemeinsame Schnittmenge ist in der Landwirtschaft zu suchen. Zwei Parten, das wären zwei Besitzer, ernten zusammen eine einzige Fläche mit Feldfrüchten ab. Warum eigentlich sollten sie das tun? Sie kämen einander bloß in die Quere. Ernten wird deshalb bloß einer von beiden, und hinterher wird die Ernte geteilt. Oder sollen wir die Metapher in der Polygraphie orten? Wo beim Beschneiden von Buchblocks eine Menge von Schnitzeln anfällt, die reine Wegwerfware sind? Sagen wir es rundheraus: Die Verwendung der Metapher Schnittmenge ist nichts als verbaler Schrott.
Werden Bücher beschnitten, entsteht eine Kante. Auch die ist derzeit eine beliebte Metapher. Der erste Kantenmann hieß Hans Eichel und war in der rot-grünen Regierung Finanzminister. Bei der Vorstellung seiner Haushalte pflegte er mitzuteilen, dieselben seien auf Kante genäht. Der Begriff kommt aus dem Schneiderhandwerk. Zwei Stoffteile werden so eng aneinander befestigt, dass Schnittfläche an Schnittfläche stößt, sich also nichts mehr an Stoff, so der Terminus, "herauslassen", das ist: erweitern oder verlängern lässt. Wenn Hans Eichel damit den Zustand der von ihm verantworteten Finanzhaushalte bezeichneten wollte, war die Wendung recht glücklich gewählt.
Inzwischen geht es den Finanzministern in unserem Land besser, dank guter Wirtschaftskonjunktur und einem Mehraufkommen von Steuern, bei denen gerne behauptet wird, sie sprudelten: als handle es sich um ein mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser. Die Kante ist uns geblieben. Neuerdings wird sie gezeigt. Behauptet wird so, dass man eine Meinung vertrete, die sich polemisch abgrenze gegen eine oder mehrere andere. Warum dafür die Kante herhalten muss, bleibt rätselhaft. Weil vielleicht der Begriff Handkante mitschwingt? Weil sich mit der Handkante schmerzhafte, womöglich tödliche Schläge austeilen lassen? Beliebt ist zudem die Mitteilung, dass man klare Kante zeige. Es gibt gerade, krumme, scharfe und stumpfe Kanten, wie aber, bitte sehr, soll eine Kante beschaffen sein, die klar ist?
Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Man schwatzt so dahin und bezeugt damit seine Inhaltslosigkeit.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift Aufbau in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u.a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
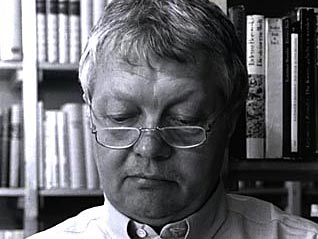
Rolf Schneider© Therese Schneider