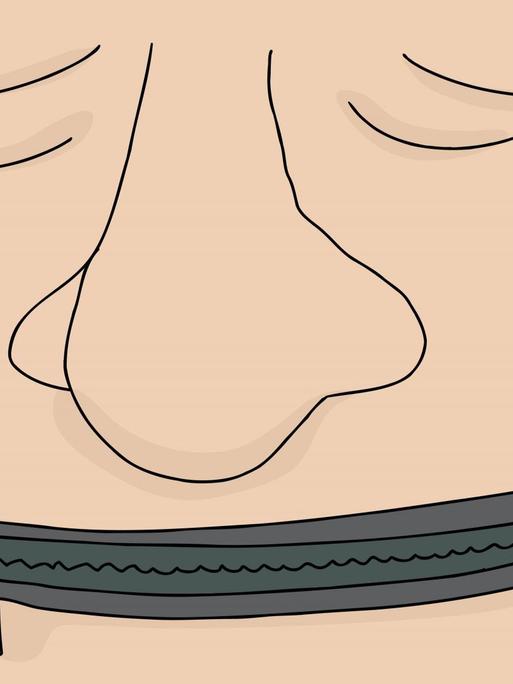Michel Friedman: „Streiten? Unbedingt. Ein persönliches Plädoyer“
Duden-Sachbuch, 2021
64 Seiten, 8 Euro
„Streiten heißt lebendig sein“
07:32 Minuten

Gefühlt wird in Deutschland ständig über irgendetwas heftig diskutiert. Dem Publizisten Michel Friedman ist das nicht genug: Deutschland sei zu sehr Konsensgesellschaft und brauche deutlich mehr Streit, „aber auf dem Boden der Tatsachen“.
Gendersternchen, Benzinpreise, Coronamaßnahmen: In Deutschland ging es in den letzten Wochen und Monaten hoch her bei diesen Themen. Dennoch: Es wird nicht genug gestritten, findet der Publizist und Talkshow-Moderator Michel Friedman.
Deutschland ist für ihn noch immer zu sehr „Konsensgesellschaft“ und bis heute davon geprägt, dass nach 1945 „das Schweigemäntelchen“ ausgebreitet worden sei und die Generation der heute 60- bis 70-Jährigen das Streiten nicht gelernt habe.

Der Publizist und Moderator Michel Friedmann hat ein Buch über Streitkultur veröffentlicht.© imago / Volker Danzer / HMB Mediax
„Was wir heute als Streiten bezeichnen, ist eine Anzahl von Monologisierungen, aber der Streit ist ein Dialog, und ein Dialog setzt voraus, dass man zuhört und dass man in der Lage ist, über Argumente zu sprechen, über Tatsachen, das heißt, man muss Wissen entwickeln.“
Bei der Streitkultur sei also „noch viel Luft nach oben“, findet Friedman, der das in seinem neuen Buch „Streiten? Unbedingt“ darlegt.
Sachstreit sei wichtig: „Und dennoch beobachten wir, dass circa 20 Prozent unserer Gesellschaft – Querdenker, Pegida-Leute, Verschwörungstheoretiker, AfD – sich an dem Streit nicht mehr beteiligen, sondern nur noch mit sich selbst beschäftigt sind. Und wenn wir ins Internet gehen, sehen wir, wie gefährlich das ist.“
Eines der wichtigsten Wörter überhaupt sei „Warum?“, so der Autor. Daraus ergäbe sich im Idealfall ein Dialog, aus dem sich ein „Weil“ entwickle. Streit sei die Auseinandersetzung mit anderen und deren Meinungen. „Streiten bedeutet lernen.“ Und: „Streiten bedeutet, lebendig zu sein.“
Ja, in Deutschland werde gestritten, betont Friedman. „Doch wie wir das tun – darüber sollten wir uns streiten.“
(mkn)