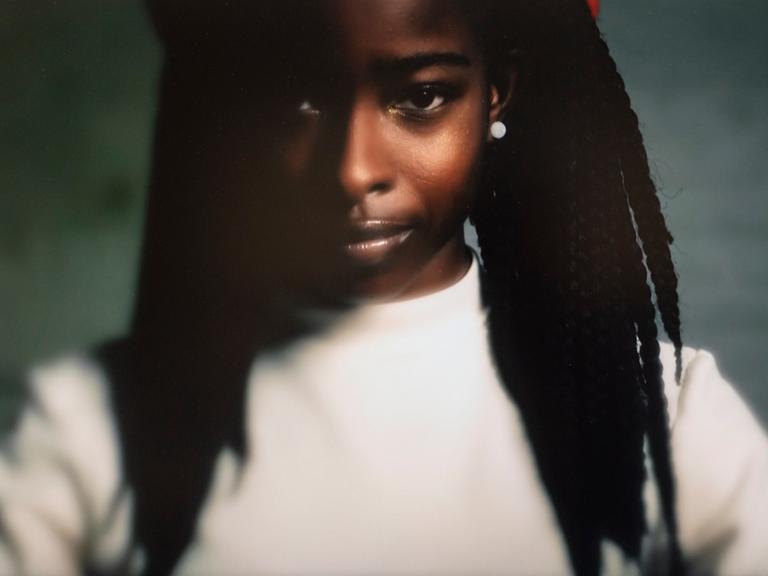Mohsin Hamid: „Der letzte weiße Mann“
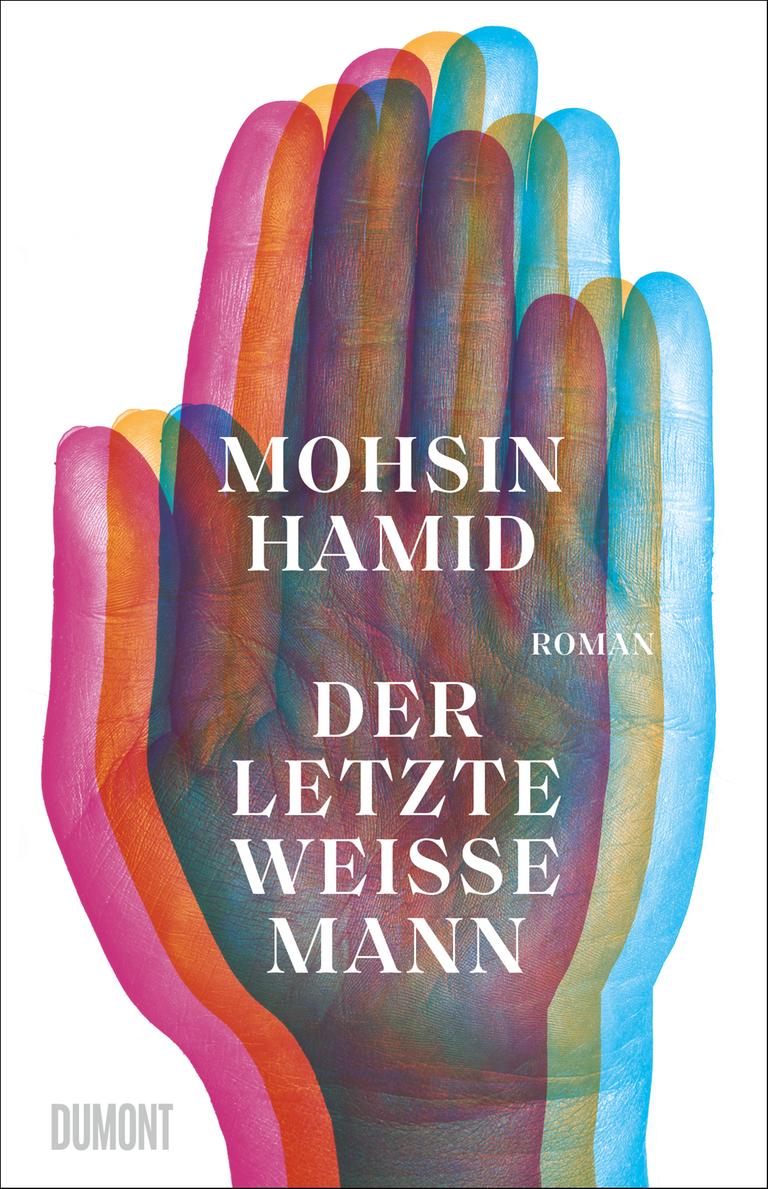
© Du Mont
Wundersame Verwandlung
07:10 Minuten
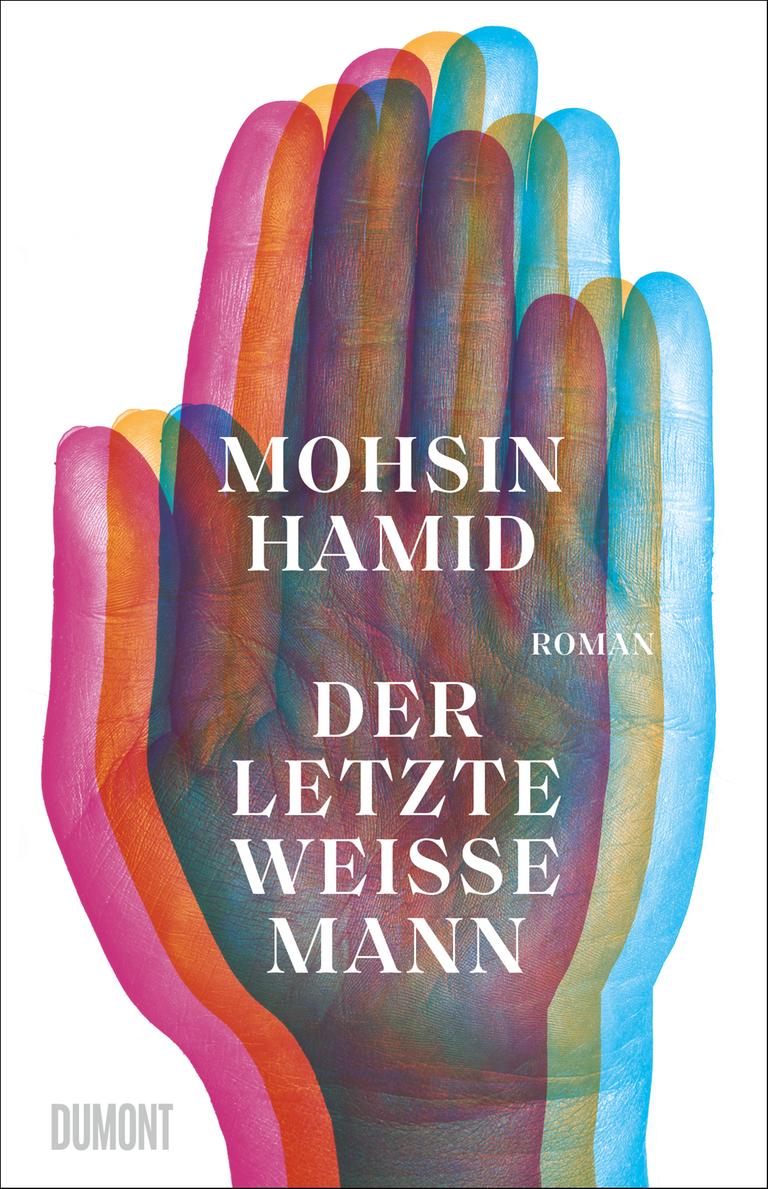
Mohsin Hamid
übersetzt von Nicolai von Schweder-Schreiner
Der letzte weiße MannDuMont , Köln 2022158 Seiten
22,00 Euro
Über Nacht werden alle Weißen dunkelhäutig. Das erzeugt Ängste, Chaos und Gewalt brechen aus. Mohsin Hamid ist mit seinem Roman "Der letzte weiße Mann" ist eine kafkaeske Parabel über Rassismus gelungen.
Der erste Satz in Mohsin Hamids „Der letzte weiße Mann“ erinnert an eine bekannte Erzählung Franz Kafkas: „Eines Morgens wachte Anders, ein weißer Mann, auf und stellte fest, dass seine Haut sich unleugbar tiefbraun gefärbt hatte.“ Anders meldet sich krank und bleibt wie Gregor Samsa zu Hause.
Als er seine Wohnung verlassen muss, um nicht mehr nur Proteinmehl zu sich zu nehmen, verbirgt er seine dunkle Haut hinter Hoodie und Sonnenbrille. Niemand erkennt den Angestellten eines Fitnessstudios. Die meisten weichen ihm aus, so wie er ihnen ausweicht. Anders wird – das lässt an den Titel des Romans von Ralph Ellison denken – ein unsichtbarer Mann. Zugleich ist er sehr sichtbar – nicht als Individuum, sondern als Bedrohung.
Ein weißer Mob wütet
Vorsichtig offenbart sich Anders seinem Vater und Oona, einer Affäre. Die Yogalehrerin, die mit ihrer internetsüchtigen Mutter in einer kleinen Wohnung lebt und nach dem Vater auch den Zwillingsbruder verloren hat, findet den ihr halb unbekannten Mann faszinierender als zuvor.
Anders' schwer kranker Vater ist anfangs geschockt, lässt sich aber vom Augenschein nicht irritieren und gibt Anders ein Gewehr. Denn in der Stadt mehren sich die Verwandlungen, Weiße ziehen gewalttätig durch die Straßen.
Hamid konzentriert sich auf vier Menschen in einer namenlosen Stadt der westlichen Hemisphäre, was an Albert Camus' „Pest“ erinnert, dem dritten literarischen Ahnherrn nach Kafka und Ellison. Wie bei Camus zerfällt die Gesellschaft, Anarchie und Chaos brechen aus.
Anders' Vater stirbt als „letzter weißer Mann“. Oonas Mutter glaubt, dass Weiße sich zu Recht verteidigen, Separierung eine gute Sache sei und die Morde von der anderen Seite begangen würden, um die eigenen Leute „schlecht dastehen zu lassen“.
Gesellschaft verändert sich
Der in London lebende Pakistaner Mohsin Hamid, Jahrgang 1971, wurde vielfach ausgezeichnet für seine mit Witz und Esprit erzählten Bestseller „So wirst du stinkreich im boomenden Asien“ oder „Der Fundamentalist, der keiner sein wollte“.
In „Der letzte weiße Mann“ meidet er die Extreme. Alle Protagonisten neigen zu rassistischen Vorbehalten. Bei den Jüngeren sind sie durch Gleichgültigkeit, großstädtische Toleranz und ästhetische Faszination gemildert, bei Anders' Vater durch Klassensolidarität. Oonas radikale Mutter mäßigt sich nach der eigenen Verwandlung.
Auch Anders bemerkt, wie das neue dunkelhäutige Außen sein Innen verändert: Erstmals sucht er Kontakt zum Putzmann im Fitnessstudio. Der schon immer dunkelhäutige Mann will allerdings von Gemeinschaft nichts wissen, dafür eine Gehaltserhöhung.
Kitschfreie Utopie
„Der letzte weiße Mann“ tendiert zur Parabel. Nach einem konventionellen Anfang erzählt Hamid in Absätzen, die aus einem einzigen langen Satz bestehen. Mit vielen Kommata folgen die Satzteile, von Nicolai von Schweder-Schreiner trocken und mit Rhythmusgefühl übersetzt, den vorsichtig abwägenden Gedanken und Beobachtungen jeweils eines existenziell herausgeforderten Menschen. Hamid stellt in prägnanten Momentaufnahmen suggestive Nähe her.
Warum die Welt dunkelhäutig wird, kümmert ihn nicht. Der Verzicht auf Motive und Kausalitäten sowie die Nähe zu den Protagonisten lassen an den Nobelpreisträger John Maxwell Coetzee denken. Mohsin Hamid hat mit „Der letzte weiße Mann“ einen Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Am Ende gelingt es ihm sogar, kitschfrei die Utopie einer friedlichen, dunkelhäutigen Zukunft anzudeuten.