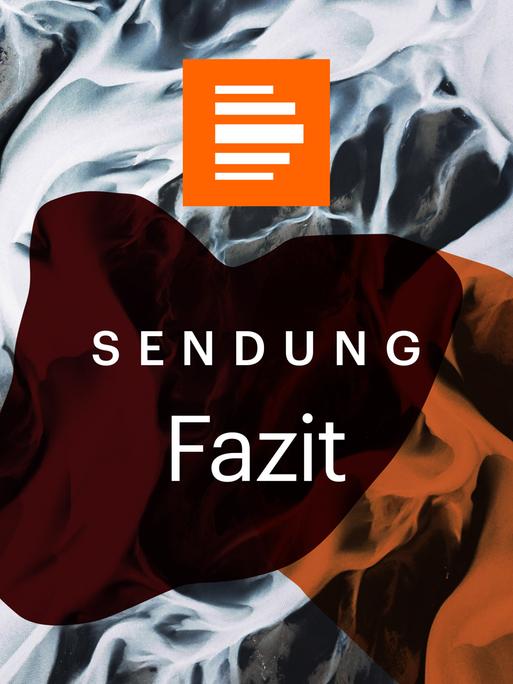Morbider Charme gegen ruhelosen Jetset
In Montevideo scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Oldtimer säumen die Straße, die Menschen wirken gemächlich. Das moderne Uruguay wird von dem mondänen Badeort Punta del Este verkörpert.
Der Markt Tristan Narvaja in Montevideo. Die beiden Händler Jorge Cabrera und Hugo Barrios putzen und polieren ihre Antiquitäten, prüfen sie. Die Schafschere ist noch gut in Schuss, sagt Jorge, und das, obwohl sie schon einige Jahre auf dem Buckel hat:
"Die hier ist schon 100 Jahre alt. Es gibt hier noch ältere. Damit wurden früher die Schafe geschoren. Das wurde importiert. Aus England und Deutschland. Die hier ist aus Solingen, echt Stahl. Die wurde importiert und dann wurden damit die Schafe geschoren."
Jeden Sonntag treffen sich die Menschen in Montevideo auf dem Markt von Tristan Narvaja. Ein einzigartiges Sammelsurium an Antiquitäten und Gerümpel findet sich hier. Schallplatten, Werkzeug, Kinderspielzeug, Kleidung, Lebensmittel, Zeitschriften… Es scheint, als sei die Zeit stehengeblieben. Die Menschen schlendern an den Ständen vorbei. Von Hektik keine Spur. Niemand feilscht, man unterhält sich leise. Manche Touristen entdecken Dinge, die sie schon lange gesucht haben, etwa 40 Jahre alte Schallplatten.
"Genießen sie Uruguay", ruft die Verkäuferin den amerikanischen Touristen noch nach, obwohl sie die alten Schallplatten nicht gekauft haben.
Altersschwache Autos stehen rostig an den Straßenrändern. Bröckelnde Fassaden einst prächtiger Häuser im Kolonialstil verströmen morbiden Charme, Linienbusse und Taxis bewegen sich für eine südamerikanische Stadt unnatürlich langsam voran. Alles kein Vergleich zu dem lauten, hektischen und strahlenden Buenos Aires, das gegenüber, auf der anderen Seite des Rio de la Plata liegt. In Montevideo scheint alles traurig, meint Schallplattenverkäuferin Silvana:
"Wie beim Tango, so traurig. Gut heute haben wir auch einen trüben Tag, aber es stimmt schon. Wir Uruguayer sind ziemlich grau. Wir sind sehr ruhig, ein wenig zurückhaltend. Das ist schon charakteristisch für Uruguay."
In kaum einer anderen Stadt ist die Einwanderer-Vergangenheit so präsent wie in Montevideo. Die Stände, auf denen die alten Bücher liegen, belegen dies eindrucksvoll. Bände aus aller Welt, die die Menschen einst in die neue uruguayische Heimat mitbrachten und die jetzt verhökert werden. Antiquitätenhändler Jorge glaubt, dass die Melancholie Montevideos mit der Geschichte der Einwanderer zusammenhängt:
"Ich glaube, das kommt alles aus der Einwandererzeit. Damals kamen viele Immigranten aus Spanien und Italien. Menschen, die den Krieg erlebt und dort in Europa keine gute Zeit verbracht hatten. Ihnen ging es hier auch nicht gut, sie vermissten ihre Familien. Aber die Einwanderer bauten das Land auf."
Anfang des 20. Jahrhunderts galten Uruguay und seine Hauptstadt als fortschrittlich. Uruguay wurde als Schweiz Südamerikas bezeichnet. Das Land hatte ein vorbildliches Schul- und Gesundheitswesen, wurde zwei Mal Fußball-Weltmeister. Großzügige Parks und Uferpromenaden in Montevideo luden zum Flanieren ein, mächtige Häuser im Kolonialstil zeugten vom Wohlstand der Bürger. Die Sozialgesetzgebung war geradezu progressiv. Eduardo Galeano, der wohl bekannteste zeitgenössische Schriftsteller Uruguays, blickt mit Wehmut zurück auf diese Zeit:
"Das war ein anderes Land. Wir hatten das Scheidungsrecht 70 Jahre, bevor Spanien es einführte. Das Frauenwahlrecht 14 Jahre eher als Frankreich. Dann ging es bergab mit Uruguay. Die Politiker nahmen den Staat in Besitz. Wir hatten den gesetzlichen Acht-Stunden-Arbeitstag noch vor den USA. Aber jetzt eine Arbeit zu finden, grenzt an ein Wunder. Und ein noch größeres Wunder wäre es, den Kochtopf zu füllen, wenn man nur acht Stunden arbeitet."
Es geht hinauf mit dem alten Aufzug im Palacio Salvio. 1928 erbaut, galt es damals mit seinen 26 Stockwerken als der höchste Wolkenkratzer Südamerikas. Josephine Baker trat hier auf, bekannte lateinamerikanische Künstler wie die Cuban Boys und Jorge Negrette feierten hier Erfolge. Im Vorläufergebäude wurde La Cumparsita uraufgeführt, eines der bekanntesten Tangolieder bis heute. Oben im Palacio Salvio hat man einen guten Blick über die Stadt.
Das Hochhaus steht an der Plaza de Independencia, dem Unabhängigkeitsplatz. In der Mitte sitzt dort Nationalheld José Artigas stolz auf seinem Pferd. Der schmucklose Präsidentenpalast ist zu sehen, ein Beleg funktionaler und ideenloser Architektur. Einige Palmen stehen verloren auf dem Pflaster. Die Reste der Stadtmauer hat man hierhergeschafft, einige Hotels und Banken sind zu erkennen. Touristen stehen herum, auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten, die es hier nicht gibt. Fast scheint es, als hätte der Schriftsteller Eduardo Galeano Mitleid mit seinem kleinen Volk, das so sehr der Vergangenheit nachtrauert:
"Wir Uruguayer sind nur wenige, etwa dreieinhalb Millionen Einwohner. Wir passen in einen Stadtteil jeder großen Metropole auf dieser Welt. Dreieinhalb Millionen konservative Anarchisten. Wir haben es nicht gerne, wenn man uns Befehle erteilt und wir tun uns schwer damit, uns zu ändern. Dreieinhalb Millionen Fußballtrainer, Fußballideologen. Auch wenn unser Fußball mehr aus der Nostalgie heraus lebt denn aus der Wirklichkeit."
Luis Eduardo ist Teil der Wirklichkeit im heutigen Montevideo. Er und sein Kollege sind mit dem Pferdekarren unterwegs:
"Hier sind die Pferdekarren üblich, wie auch die Handkarren, die an Fahrräder rangehängt werden. Und dann geht man eben zur Arbeit. Das ist eine gute Arbeit, auch wenn sie ziemlich schmutzig ist. Aber wir sorgen dafür, dass der Müll wiederverwertet wird."
Luis Eduardo ist Cartonero, ein selbsternannter Müllmann. Bevor ein Müllwagen kommt, haben er und seine Kollegen den Müll bereits nach Brauchbarem untersucht:
"Ich sortiere Kartons, Flaschen, Zeitungen, weißes Papier. Und dann hoffe ich, immer Nahrung für das Pferd zu finden. Meistens Gemüse, das die Leute wegwerfen. Oder die Schalen vom Gemüse, die im Abfall liegen. Ich kann das gut gebrauchen. Und dann fahre ich in die Supermärkte und suche Abfälle. Das ist das Essen für das Tier."
Die Müllsammler mit ihren Pferdekarren gehören zum Bild Montevideos. Eine archaische Form der Müllentsorgung, mitten im 21. Jahrhundert. Die Stadt hat ihre guten Jahre schon vor langer Zeit hinter sich gelassen. Seit Jahren geht es abwärts. Die Armut macht immer mehr Menschen zu schaffen, ebenso die Arbeitslosigkeit. Die Jungen flüchten aus der Stadt, aus dem Land. Doch die Uruguayer nehmen es hin, scheinbar klaglos, auch Luis Eduardo.
Eine andere Realität: In Punta del Este wird der Rolex Cup ausgetragen. Die besten Segelboote Südamerikas nehmen an der Regatta in dem uruguayischen Seebad teil. In Punta des Este ist Hochsaison.
Wer es sich leisten kann, fliegt per Hubschrauber ein nach Punta, wie der Badeort verkürzt genannt wird. Zwei Autostunden nur ist der mondäne Badeort von der Hauptstadt Montevideo entfernt. In dem Seebad treffen sich die Schönen, die Reichen, die Berühmten. Der Yachthafen kann es locker mit Nizza und Saint Tropez aufnehmen. Promi-Fotografen wie Daniel Oliveira gehen hier auf Jagd:
"Die Promis sind hier locker drauf, sie wollen hier Urlaub machen und schaffen das hier auch. Sie stehen hier auch nicht unter Druck. Sie wollen sich zeigen. Hier ist es laut und schrill, man kann aber auch eher zurückgezogen die Tage verbringen. Das ist hier etwas ganz eigenes. Eingebettet in Uruguay, aber doch wie in einem anderen Land."
Maradona, Omar Sharif, David Beckham, Shakira, in diesem Jahr Stones-Gitarrist Ron Wood. Die Promi-Dichte in Punta del Este ist hoch. Auch für die Segler ist Punta jedes Jahr ein Muss, sagt Alfredo García, der die Regatta seit Jahren organisiert:
"Das ist hier sicher eine der Städte in Südamerika, wo am meisten los ist. Die Regatten starten meist am Morgen. Mittags ist dann alles vorbei. Wir wollen den Leuten ja ausreichend Zeit und Gelegenheit geben, dass sie sich anderweitig vergnügen."
Alfredo lacht vielsagend und meint vor allem eines:
Im Spielcasino Conrad in Punta trifft sich ab Mitternacht der Jet Set. Die Suite in dem Hotel kostet schon mal 2500 Dollar die Nacht, manche Promis könnten sich das Geld sparen, sie machen durch. Black Jack, Poker, Roulette ist angesagt, überall stehen Spielautomaten.
Die Promis und die, die sich dafür halten, haben sich herausgeputzt. Gehen mit Sektgläschen von Tisch zu Tisch. Strahlend, modern, hip, abgefahren. Eine Nabelschau von Reichtum, Schönheit und Erfolg. Dabei sein ist alles, bei diesem Schaulaufen: Zwei gestylte Damen schwärmen:
"Das hier ist etwas ganz eigenes, sehr kosmopolitisch. Hier spürt man eine beeindruckende Energie. Du kannst hier machen, was du willst. Du findest einsame Strände, andere, auf denen Partys stattfinden, FKK-Strände. Du kannst um 9, um 10, um 12 oder erst um 4 aufstehen. Jeder macht, was er will. Du kannst hier sein und niemand treffen oder du bist mittendrin, wo was los ist. Das ist Punta del Este. Absolute Freiheit."
Und wer nicht spielt in Punta del Este, der tanzt - bis zum Morgengrauen.
La Barra und Punta Ballena sind die IN-Strände rund um Punta del Este. Gleich wo der Sand endet, beginnt die Partyzone. Und die Partygemeinde fühlt sich wohl.
"(Mann) Die Strände sind klasse. Die Insel Gorriti, im Osten von Punta La Barra, José Ignacio, Rocha, das sind wunderschöne Orte. Das hat internationalen Standard. Es kommen viele Touristen aus Europa. Viele nennen Punta auch das lateinamerikanische Saint Tropez." - (Frau) "Die Leute sind das Beste hier, auf jeden Fall. Hier sind immer Partys, am Hafen oder am Strand von La Barra, sehr empfehlenswert. "
Der Barrio Sur in Montevideo. Das Süd-Viertel. Keine gute Gegend. An einer Wand im Schatten eines mit Graffiti beschmierten Hochhauses haben sich 20 Jugendliche aufgebaut. Die meisten sind dunkelhäutig. Jeder hat eine Trommel umgehängt. Die Gruppe probt Candombe.
Candombe ist ein afro-uruguayischer Musikstil, dessen Rhythmus von drei Trommeln bestimmt wird. Einst brachten ihn afrikanische Sklaven in die Stadt am Río de la Plata. Die dunkelhäutigen Nachfahren pflegen Candombe bis heute, und auch immer mehr weiße Uruguayer schnallen sich eine Trommel um. So wie Gustavo Laporte, der Chef der Trommlergruppe.
Es gibt hier schon eine lange Tradition. Sie kommt von den Schwarzen aus Afrika. Wir proben hier die Llamada (phon. Schamada), also den Ruf. Wir gehen raus, trommeln und rufen so die Leute. Wir proben jetzt richtig ernst und gehen rum im Viertel. So bekommen wir Praxis für die Aufführungen im Karneval.
Der Barrio Sur ist die Wiege des Candombe in Montevideo. Das Viertel wirkt heruntergekommen. Die Fassaden verfallen, die Gehsteige sind voller Löcher, Schmutz und Müll türmen sich an den Seiten. Es riecht streng, Hunde und Katzen streunen herum. Die Bewohner des Viertels sitzen vor ihren Häusern und werfen Fremden misstrauische Blicke zu. Doch beim Klang des Candombe fangen sie an zu wippen, stehen auf, bewegen ihren Körper im Rhythmus der Trommeln.
Das kleine Montevideo hat über Jahrhunderte die Auswanderer aufgenommen. Menschen, die auf der Flucht waren, Menschen, die ihr Glück suchten, Menschen, die in einer neuen Stadt ein neues Leben beginnen wollten. Die Farbigen, die im 18. und 19. Jahrhundert als Sklaven gezwungen wurden, nach Uruguay zu gehen, bilden ein weiteres Kapitel einer Bevölkerungsschicht, die ihre Heimat aufgab. Die Traurigkeit und Wut darüber, die Sehnsucht, all das ist im Barrio Sur und in den Klängen des Candombe besonders gut zu spüren. Ismael, ein Mulatte mit langen geflochtenen Haaren, beschreibt seine Gefühle:
"Der Candombe spiegelt die eigenen Gefühle wider. Er nimmt dich völlig ein. Dun steigerst dich in den Rhythmus, spürst kaum noch deine Hände. Du wirst müde, aber du hörst nicht auf zu spielen. Die Trommel gibt dir eine unglaubliche Energie, man kann es nur schwer beschreiben. Man muss es fühlen, mehr als alles andere. Und wenn du es fühlst, dann spielst du auch. Es ist etwas ganz eigenes."
Ismaels Truppe ist nun im Barrio Sur unterwegs, mitten in der Llamada. Andere Cadombe-Gruppen nähern sich. Es ist laut, die Trommler geraten in Ekstase. Immer mehr Anwohner stehen auf, bewegen sich zu den Rhythmen. Der Barrio Sur pulsiert. Ismael Perreira hat sich beim Trommeln völlig verausgabt. Seine Hände sind dunkelrot gefärbt, als hätte er schwer Prügel bezogen:
"Das hier ist verrückt, göttlich. Von überall her kommen sie und trommeln. Und alle sind sie klasse. Und meinen Händen geht's gut, die sind abgehärtet, ich spüre nichts."
Szenenwechsel: vom Barrio Sur in Montevideo zum Hafen in Punta del Este. An eine Mauer gelehnt sitzt Leda. Sie repariert die Fischernetze und befestigt neue Köder darin. Auch Leda spürt nach der Arbeit ihre Hände kaum noch.
Der Aufstieg von Punta del Este zum mondänen Badeort, der Glamour der Reichen, Berühmten und Wichtigen – all das geht an Leda vorüber. Sie war noch nie im Casino Conrad. Die Strände von La Barra, Jose Ignacio und die tollen Diskotheken mit all dem Trubel kennt sie nur vom Hörensagen. Auch die imposanten Jachten in Sichtweite hat sie noch nie betreten. Ledas Mann ist seit mehr als 30 Jahren Fischer. Mit ihm zusammen verkauft sie ihren Fang am Hafen. Sie weiß nicht so recht, was sie vom Jet Set in Punta halten soll. Aber richtig dagegen ist sie eigentlich nicht:
"Das alles hier ist ziemlich widersprüchlich. Eigentlich gehört der Hafen den Fischern. Aber es hat sich alles geändert. Irgendwann kamen die Jachten. Sicher, der Tourismus profitiert davon. Es ist eine Menge los, viele Leute sind hier im Sommer. Das ist nicht schlecht. Es wird ja auch mehr Geld umgesetzt. Es sollen schon Leute hierherkommen. Und viele interessieren sich ja auch für die Fischerei, wollen wissen wie das genau funktioniert. Das ist wie eine Kette. Die Touristen kaufen mehr Fisch und wir haben mehr Arbeit."
Punta del Este hat binnen weniger Jahre einen steilen Aufschwung genommen. Allein in dem Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990 errichteten findige Spekulanten 70 Hochhäuser. Noch vor 30 Jahren hatte der Badeort gerade mal 22.000 Einwohner. Im Sommer bevölkern inzwischen gut eine Viertelmillion Menschen Punta. Aber der Jet Set, der Glamour, die Hektik – all das zieht wieder ab, sagt Leda. Spätestens wenn die Temperaturen sinken, im Winter:
"Es gibt auch dann Tourismus, aber es ist deutlich ruhiger. Das hat nichts mit dem Treiben jetzt zu tun. Du willst die Hauptstraße überqueren und es ist verheerend. Die Autos und Motorräder stehen permanent im Stau. Du brauchst Stunden, um voranzukommen."
Die Fun Fun–Bar im Herzen der Altstadt von Montevideo. In der Bar ist die glanzvolle Vergangenheit der uruguayischen Hauptstadt so greifbar wie nirgends sonst in der Stadt. Zu spüren ist es noch im mondänen Badeort Punta del Este, wo sich alles schneller dreht, immerzu in Bewegung ist. Montevideo dagegen zeugt vom Verfall der einstigen Pracht. Beide Orte gehen getrennte Wege, haben kaum etwas gemeinsam. Und doch ist beides Uruguay.
"Die hier ist schon 100 Jahre alt. Es gibt hier noch ältere. Damit wurden früher die Schafe geschoren. Das wurde importiert. Aus England und Deutschland. Die hier ist aus Solingen, echt Stahl. Die wurde importiert und dann wurden damit die Schafe geschoren."
Jeden Sonntag treffen sich die Menschen in Montevideo auf dem Markt von Tristan Narvaja. Ein einzigartiges Sammelsurium an Antiquitäten und Gerümpel findet sich hier. Schallplatten, Werkzeug, Kinderspielzeug, Kleidung, Lebensmittel, Zeitschriften… Es scheint, als sei die Zeit stehengeblieben. Die Menschen schlendern an den Ständen vorbei. Von Hektik keine Spur. Niemand feilscht, man unterhält sich leise. Manche Touristen entdecken Dinge, die sie schon lange gesucht haben, etwa 40 Jahre alte Schallplatten.
"Genießen sie Uruguay", ruft die Verkäuferin den amerikanischen Touristen noch nach, obwohl sie die alten Schallplatten nicht gekauft haben.
Altersschwache Autos stehen rostig an den Straßenrändern. Bröckelnde Fassaden einst prächtiger Häuser im Kolonialstil verströmen morbiden Charme, Linienbusse und Taxis bewegen sich für eine südamerikanische Stadt unnatürlich langsam voran. Alles kein Vergleich zu dem lauten, hektischen und strahlenden Buenos Aires, das gegenüber, auf der anderen Seite des Rio de la Plata liegt. In Montevideo scheint alles traurig, meint Schallplattenverkäuferin Silvana:
"Wie beim Tango, so traurig. Gut heute haben wir auch einen trüben Tag, aber es stimmt schon. Wir Uruguayer sind ziemlich grau. Wir sind sehr ruhig, ein wenig zurückhaltend. Das ist schon charakteristisch für Uruguay."
In kaum einer anderen Stadt ist die Einwanderer-Vergangenheit so präsent wie in Montevideo. Die Stände, auf denen die alten Bücher liegen, belegen dies eindrucksvoll. Bände aus aller Welt, die die Menschen einst in die neue uruguayische Heimat mitbrachten und die jetzt verhökert werden. Antiquitätenhändler Jorge glaubt, dass die Melancholie Montevideos mit der Geschichte der Einwanderer zusammenhängt:
"Ich glaube, das kommt alles aus der Einwandererzeit. Damals kamen viele Immigranten aus Spanien und Italien. Menschen, die den Krieg erlebt und dort in Europa keine gute Zeit verbracht hatten. Ihnen ging es hier auch nicht gut, sie vermissten ihre Familien. Aber die Einwanderer bauten das Land auf."
Anfang des 20. Jahrhunderts galten Uruguay und seine Hauptstadt als fortschrittlich. Uruguay wurde als Schweiz Südamerikas bezeichnet. Das Land hatte ein vorbildliches Schul- und Gesundheitswesen, wurde zwei Mal Fußball-Weltmeister. Großzügige Parks und Uferpromenaden in Montevideo luden zum Flanieren ein, mächtige Häuser im Kolonialstil zeugten vom Wohlstand der Bürger. Die Sozialgesetzgebung war geradezu progressiv. Eduardo Galeano, der wohl bekannteste zeitgenössische Schriftsteller Uruguays, blickt mit Wehmut zurück auf diese Zeit:
"Das war ein anderes Land. Wir hatten das Scheidungsrecht 70 Jahre, bevor Spanien es einführte. Das Frauenwahlrecht 14 Jahre eher als Frankreich. Dann ging es bergab mit Uruguay. Die Politiker nahmen den Staat in Besitz. Wir hatten den gesetzlichen Acht-Stunden-Arbeitstag noch vor den USA. Aber jetzt eine Arbeit zu finden, grenzt an ein Wunder. Und ein noch größeres Wunder wäre es, den Kochtopf zu füllen, wenn man nur acht Stunden arbeitet."
Es geht hinauf mit dem alten Aufzug im Palacio Salvio. 1928 erbaut, galt es damals mit seinen 26 Stockwerken als der höchste Wolkenkratzer Südamerikas. Josephine Baker trat hier auf, bekannte lateinamerikanische Künstler wie die Cuban Boys und Jorge Negrette feierten hier Erfolge. Im Vorläufergebäude wurde La Cumparsita uraufgeführt, eines der bekanntesten Tangolieder bis heute. Oben im Palacio Salvio hat man einen guten Blick über die Stadt.
Das Hochhaus steht an der Plaza de Independencia, dem Unabhängigkeitsplatz. In der Mitte sitzt dort Nationalheld José Artigas stolz auf seinem Pferd. Der schmucklose Präsidentenpalast ist zu sehen, ein Beleg funktionaler und ideenloser Architektur. Einige Palmen stehen verloren auf dem Pflaster. Die Reste der Stadtmauer hat man hierhergeschafft, einige Hotels und Banken sind zu erkennen. Touristen stehen herum, auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten, die es hier nicht gibt. Fast scheint es, als hätte der Schriftsteller Eduardo Galeano Mitleid mit seinem kleinen Volk, das so sehr der Vergangenheit nachtrauert:
"Wir Uruguayer sind nur wenige, etwa dreieinhalb Millionen Einwohner. Wir passen in einen Stadtteil jeder großen Metropole auf dieser Welt. Dreieinhalb Millionen konservative Anarchisten. Wir haben es nicht gerne, wenn man uns Befehle erteilt und wir tun uns schwer damit, uns zu ändern. Dreieinhalb Millionen Fußballtrainer, Fußballideologen. Auch wenn unser Fußball mehr aus der Nostalgie heraus lebt denn aus der Wirklichkeit."
Luis Eduardo ist Teil der Wirklichkeit im heutigen Montevideo. Er und sein Kollege sind mit dem Pferdekarren unterwegs:
"Hier sind die Pferdekarren üblich, wie auch die Handkarren, die an Fahrräder rangehängt werden. Und dann geht man eben zur Arbeit. Das ist eine gute Arbeit, auch wenn sie ziemlich schmutzig ist. Aber wir sorgen dafür, dass der Müll wiederverwertet wird."
Luis Eduardo ist Cartonero, ein selbsternannter Müllmann. Bevor ein Müllwagen kommt, haben er und seine Kollegen den Müll bereits nach Brauchbarem untersucht:
"Ich sortiere Kartons, Flaschen, Zeitungen, weißes Papier. Und dann hoffe ich, immer Nahrung für das Pferd zu finden. Meistens Gemüse, das die Leute wegwerfen. Oder die Schalen vom Gemüse, die im Abfall liegen. Ich kann das gut gebrauchen. Und dann fahre ich in die Supermärkte und suche Abfälle. Das ist das Essen für das Tier."
Die Müllsammler mit ihren Pferdekarren gehören zum Bild Montevideos. Eine archaische Form der Müllentsorgung, mitten im 21. Jahrhundert. Die Stadt hat ihre guten Jahre schon vor langer Zeit hinter sich gelassen. Seit Jahren geht es abwärts. Die Armut macht immer mehr Menschen zu schaffen, ebenso die Arbeitslosigkeit. Die Jungen flüchten aus der Stadt, aus dem Land. Doch die Uruguayer nehmen es hin, scheinbar klaglos, auch Luis Eduardo.
Eine andere Realität: In Punta del Este wird der Rolex Cup ausgetragen. Die besten Segelboote Südamerikas nehmen an der Regatta in dem uruguayischen Seebad teil. In Punta des Este ist Hochsaison.
Wer es sich leisten kann, fliegt per Hubschrauber ein nach Punta, wie der Badeort verkürzt genannt wird. Zwei Autostunden nur ist der mondäne Badeort von der Hauptstadt Montevideo entfernt. In dem Seebad treffen sich die Schönen, die Reichen, die Berühmten. Der Yachthafen kann es locker mit Nizza und Saint Tropez aufnehmen. Promi-Fotografen wie Daniel Oliveira gehen hier auf Jagd:
"Die Promis sind hier locker drauf, sie wollen hier Urlaub machen und schaffen das hier auch. Sie stehen hier auch nicht unter Druck. Sie wollen sich zeigen. Hier ist es laut und schrill, man kann aber auch eher zurückgezogen die Tage verbringen. Das ist hier etwas ganz eigenes. Eingebettet in Uruguay, aber doch wie in einem anderen Land."
Maradona, Omar Sharif, David Beckham, Shakira, in diesem Jahr Stones-Gitarrist Ron Wood. Die Promi-Dichte in Punta del Este ist hoch. Auch für die Segler ist Punta jedes Jahr ein Muss, sagt Alfredo García, der die Regatta seit Jahren organisiert:
"Das ist hier sicher eine der Städte in Südamerika, wo am meisten los ist. Die Regatten starten meist am Morgen. Mittags ist dann alles vorbei. Wir wollen den Leuten ja ausreichend Zeit und Gelegenheit geben, dass sie sich anderweitig vergnügen."
Alfredo lacht vielsagend und meint vor allem eines:
Im Spielcasino Conrad in Punta trifft sich ab Mitternacht der Jet Set. Die Suite in dem Hotel kostet schon mal 2500 Dollar die Nacht, manche Promis könnten sich das Geld sparen, sie machen durch. Black Jack, Poker, Roulette ist angesagt, überall stehen Spielautomaten.
Die Promis und die, die sich dafür halten, haben sich herausgeputzt. Gehen mit Sektgläschen von Tisch zu Tisch. Strahlend, modern, hip, abgefahren. Eine Nabelschau von Reichtum, Schönheit und Erfolg. Dabei sein ist alles, bei diesem Schaulaufen: Zwei gestylte Damen schwärmen:
"Das hier ist etwas ganz eigenes, sehr kosmopolitisch. Hier spürt man eine beeindruckende Energie. Du kannst hier machen, was du willst. Du findest einsame Strände, andere, auf denen Partys stattfinden, FKK-Strände. Du kannst um 9, um 10, um 12 oder erst um 4 aufstehen. Jeder macht, was er will. Du kannst hier sein und niemand treffen oder du bist mittendrin, wo was los ist. Das ist Punta del Este. Absolute Freiheit."
Und wer nicht spielt in Punta del Este, der tanzt - bis zum Morgengrauen.
La Barra und Punta Ballena sind die IN-Strände rund um Punta del Este. Gleich wo der Sand endet, beginnt die Partyzone. Und die Partygemeinde fühlt sich wohl.
"(Mann) Die Strände sind klasse. Die Insel Gorriti, im Osten von Punta La Barra, José Ignacio, Rocha, das sind wunderschöne Orte. Das hat internationalen Standard. Es kommen viele Touristen aus Europa. Viele nennen Punta auch das lateinamerikanische Saint Tropez." - (Frau) "Die Leute sind das Beste hier, auf jeden Fall. Hier sind immer Partys, am Hafen oder am Strand von La Barra, sehr empfehlenswert. "
Der Barrio Sur in Montevideo. Das Süd-Viertel. Keine gute Gegend. An einer Wand im Schatten eines mit Graffiti beschmierten Hochhauses haben sich 20 Jugendliche aufgebaut. Die meisten sind dunkelhäutig. Jeder hat eine Trommel umgehängt. Die Gruppe probt Candombe.
Candombe ist ein afro-uruguayischer Musikstil, dessen Rhythmus von drei Trommeln bestimmt wird. Einst brachten ihn afrikanische Sklaven in die Stadt am Río de la Plata. Die dunkelhäutigen Nachfahren pflegen Candombe bis heute, und auch immer mehr weiße Uruguayer schnallen sich eine Trommel um. So wie Gustavo Laporte, der Chef der Trommlergruppe.
Es gibt hier schon eine lange Tradition. Sie kommt von den Schwarzen aus Afrika. Wir proben hier die Llamada (phon. Schamada), also den Ruf. Wir gehen raus, trommeln und rufen so die Leute. Wir proben jetzt richtig ernst und gehen rum im Viertel. So bekommen wir Praxis für die Aufführungen im Karneval.
Der Barrio Sur ist die Wiege des Candombe in Montevideo. Das Viertel wirkt heruntergekommen. Die Fassaden verfallen, die Gehsteige sind voller Löcher, Schmutz und Müll türmen sich an den Seiten. Es riecht streng, Hunde und Katzen streunen herum. Die Bewohner des Viertels sitzen vor ihren Häusern und werfen Fremden misstrauische Blicke zu. Doch beim Klang des Candombe fangen sie an zu wippen, stehen auf, bewegen ihren Körper im Rhythmus der Trommeln.
Das kleine Montevideo hat über Jahrhunderte die Auswanderer aufgenommen. Menschen, die auf der Flucht waren, Menschen, die ihr Glück suchten, Menschen, die in einer neuen Stadt ein neues Leben beginnen wollten. Die Farbigen, die im 18. und 19. Jahrhundert als Sklaven gezwungen wurden, nach Uruguay zu gehen, bilden ein weiteres Kapitel einer Bevölkerungsschicht, die ihre Heimat aufgab. Die Traurigkeit und Wut darüber, die Sehnsucht, all das ist im Barrio Sur und in den Klängen des Candombe besonders gut zu spüren. Ismael, ein Mulatte mit langen geflochtenen Haaren, beschreibt seine Gefühle:
"Der Candombe spiegelt die eigenen Gefühle wider. Er nimmt dich völlig ein. Dun steigerst dich in den Rhythmus, spürst kaum noch deine Hände. Du wirst müde, aber du hörst nicht auf zu spielen. Die Trommel gibt dir eine unglaubliche Energie, man kann es nur schwer beschreiben. Man muss es fühlen, mehr als alles andere. Und wenn du es fühlst, dann spielst du auch. Es ist etwas ganz eigenes."
Ismaels Truppe ist nun im Barrio Sur unterwegs, mitten in der Llamada. Andere Cadombe-Gruppen nähern sich. Es ist laut, die Trommler geraten in Ekstase. Immer mehr Anwohner stehen auf, bewegen sich zu den Rhythmen. Der Barrio Sur pulsiert. Ismael Perreira hat sich beim Trommeln völlig verausgabt. Seine Hände sind dunkelrot gefärbt, als hätte er schwer Prügel bezogen:
"Das hier ist verrückt, göttlich. Von überall her kommen sie und trommeln. Und alle sind sie klasse. Und meinen Händen geht's gut, die sind abgehärtet, ich spüre nichts."
Szenenwechsel: vom Barrio Sur in Montevideo zum Hafen in Punta del Este. An eine Mauer gelehnt sitzt Leda. Sie repariert die Fischernetze und befestigt neue Köder darin. Auch Leda spürt nach der Arbeit ihre Hände kaum noch.
Der Aufstieg von Punta del Este zum mondänen Badeort, der Glamour der Reichen, Berühmten und Wichtigen – all das geht an Leda vorüber. Sie war noch nie im Casino Conrad. Die Strände von La Barra, Jose Ignacio und die tollen Diskotheken mit all dem Trubel kennt sie nur vom Hörensagen. Auch die imposanten Jachten in Sichtweite hat sie noch nie betreten. Ledas Mann ist seit mehr als 30 Jahren Fischer. Mit ihm zusammen verkauft sie ihren Fang am Hafen. Sie weiß nicht so recht, was sie vom Jet Set in Punta halten soll. Aber richtig dagegen ist sie eigentlich nicht:
"Das alles hier ist ziemlich widersprüchlich. Eigentlich gehört der Hafen den Fischern. Aber es hat sich alles geändert. Irgendwann kamen die Jachten. Sicher, der Tourismus profitiert davon. Es ist eine Menge los, viele Leute sind hier im Sommer. Das ist nicht schlecht. Es wird ja auch mehr Geld umgesetzt. Es sollen schon Leute hierherkommen. Und viele interessieren sich ja auch für die Fischerei, wollen wissen wie das genau funktioniert. Das ist wie eine Kette. Die Touristen kaufen mehr Fisch und wir haben mehr Arbeit."
Punta del Este hat binnen weniger Jahre einen steilen Aufschwung genommen. Allein in dem Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990 errichteten findige Spekulanten 70 Hochhäuser. Noch vor 30 Jahren hatte der Badeort gerade mal 22.000 Einwohner. Im Sommer bevölkern inzwischen gut eine Viertelmillion Menschen Punta. Aber der Jet Set, der Glamour, die Hektik – all das zieht wieder ab, sagt Leda. Spätestens wenn die Temperaturen sinken, im Winter:
"Es gibt auch dann Tourismus, aber es ist deutlich ruhiger. Das hat nichts mit dem Treiben jetzt zu tun. Du willst die Hauptstraße überqueren und es ist verheerend. Die Autos und Motorräder stehen permanent im Stau. Du brauchst Stunden, um voranzukommen."
Die Fun Fun–Bar im Herzen der Altstadt von Montevideo. In der Bar ist die glanzvolle Vergangenheit der uruguayischen Hauptstadt so greifbar wie nirgends sonst in der Stadt. Zu spüren ist es noch im mondänen Badeort Punta del Este, wo sich alles schneller dreht, immerzu in Bewegung ist. Montevideo dagegen zeugt vom Verfall der einstigen Pracht. Beide Orte gehen getrennte Wege, haben kaum etwas gemeinsam. Und doch ist beides Uruguay.