Sophie Pornschlegel ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Projektleiterin und Analystin beim European Policy Centre, einem Brüsseler Think Tank. Dort beschäftigt sie sich mit Europapolitik, europäischer Zivilgesellschaft, politischer Teilhabe und Demokratie in Europa. Zuvor war sie in Berlin bei der Denkfabrik "Das Progressive Zentrum" tätig.
Wie die Pandemie die Grenzen des Nationalstaats sichtbar macht
04:30 Minuten
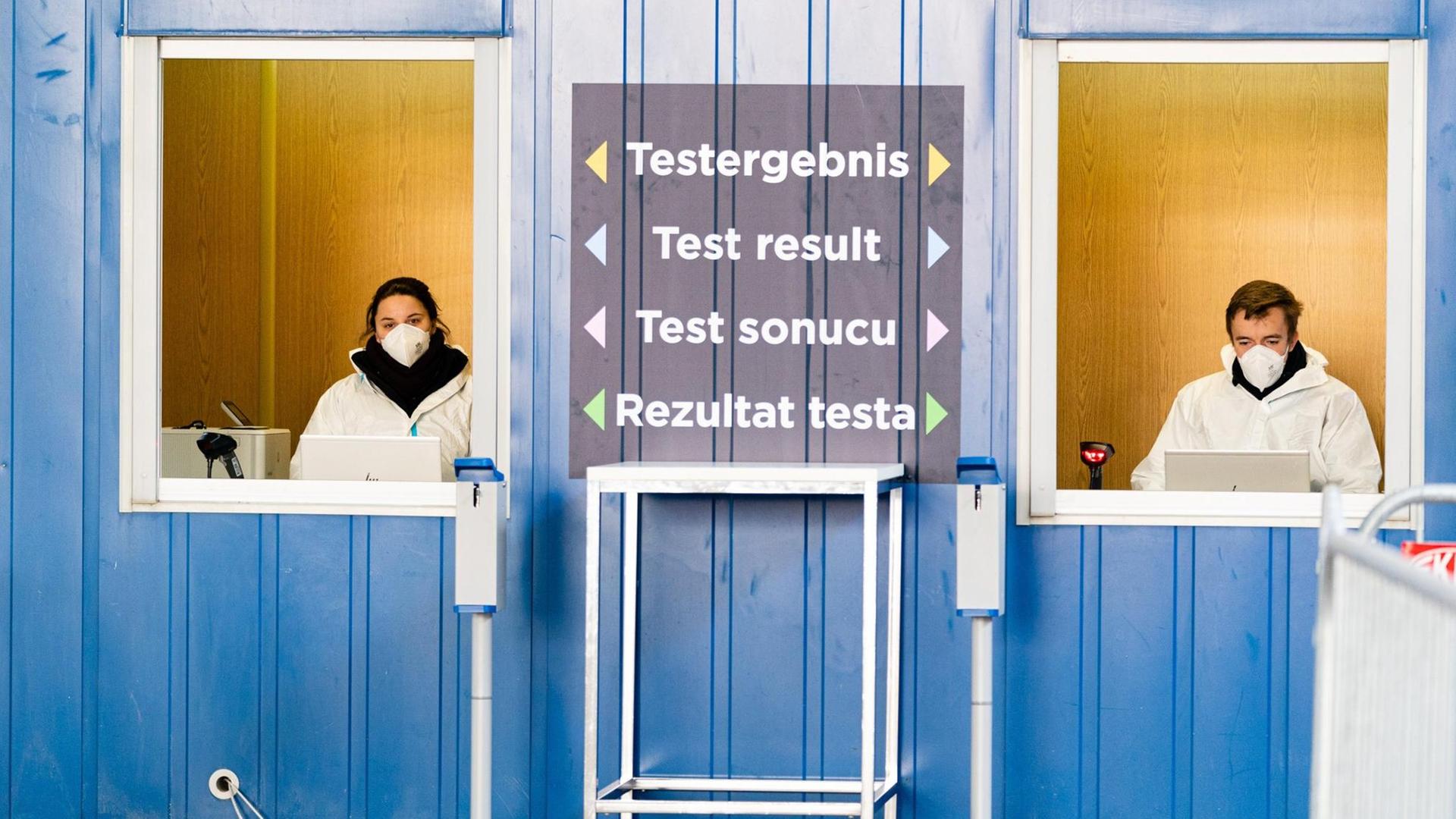
In der Coronakrise fielen viele Staaten in kleinlichen Nationalismus zurück. Sie schlossen die Grenzen und vergaßen die Solidarität. Geholfen hat es nichts, meint Sophie Pornschlegel. Zur europäischen Kooperation gebe es keine Alternative.
"Niemand ist eine Insel in sich ganz", schrieb der englische Dichter John Donne im 17. Jahrhundert.
"Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit."
Die beiden Sätze aus der Barockzeit gelten mehr denn je. Mitten in einer globalen Pandemie wird uns tagtäglich bewusst, wie abhängig wir voneinander sind, wie zerbrechlich das Menschenleben ist und wie verantwortlich wir füreinander sind. Unsere Haltungen und Handlungen können über Leben und Tod entscheiden.
Die wechselseitige Abhängigkeit gilt nicht nur zwischen den Individuen. Auch zwischen Staaten herrschen Abhängigkeiten, die wir vor der Coronakrise kaum beachtet haben. Im März dieses Jahres wurde deutlich, wie viele Industriezweige von Lieferketten aus China abhängig sind, wie sehr wir auf die Solidarität anderer angewiesen sind und wie lückenhaft die innereuropäische Kooperation noch immer ist.
Maßnahmen wie aus dem 19. Jahrhundert
Während der ersten Infektionswelle verfielen die meisten Länder in nationalistische Verhaltensmuster: Grenzschließungen, Exportverbote für medizinisches Equipment, in Frankreich sogar eine stramme Kriegserklärung an das Coronavirus. Abgesehen von der Tatsache, dass Grenzen für diesen "Feind" keine Bedeutung haben, schienen die Maßnahmen allesamt kontraproduktiv zu sein und direkt ins 19. Jahrhundert zurückzuführen.
Selbstverständlich sollten Staaten ihre Macht nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger vor einer katastrophalen Pandemie zu schützen. Relevant ist allerdings der Rahmen, in dem man sich auf die eigene Staatlichkeit zurückbesinnt. Kleinlicher Nationalismus und protektionistischer Patriotismus sind ein falscher Ansatz, genauso wie der Wunsch nach mehr "Autonomie". Interdependenzen kann man nicht abschaffen, wie auch das unglückliche Agieren zwischen Bund und Ländern beim Ringen um einheitliche Corona-Regeln zeigt.
Niemand ist eine Insel. Und ja, es ist richtig: die Corona-Pandemie ist ein Auswuchs einer ungezügelten, deregulierten Globalisierung. Deswegen kann man sie aber trotzdem nicht ignorieren, und es genügt auch nicht, sie zum metaphysischen Feind zu erklären. Die Politik sollte sich lieber überlegen, in welchen Bereichen nationale und europäische Souveränität sinnvoll ist sind und wie man diese souveräne Macht demokratisch legitimiert.
Mehr in die europäische Kooperation investieren
Deutschland sollte sich auf zwei Kernpunkte konzentrieren: erstens auf eine strategische Klärung seiner internationalen Beziehungen und Abhängigkeiten, insbesondere angesichts der internationalen Lage, in der Europa als Verfechter des globalen Multilateralismus immer einsamer dasteht. Das würde bedeuten, sich genau zu überlegen, welche Aufgaben man nur in einer engen internationalen Kooperation bewältigen kann, welche Lieferketten man diversifizieren sollte und welche strategischen Bereiche man nicht den Regeln des globalen Handels unterwerfen möchte.
Zweitens sollte Deutschland noch intensiver in die europäische Kooperation investieren. Die erste Infektionswelle war kein glorreicher Moment für die Bundesregierung. Der nationale Reflex "Abschottung" sollte in Zukunft vermieden werden. Eine dauerhafte Isolation von unseren europäischen Nachbarn ist in der Praxis nicht nur unmöglich, sie würde auch langfristigen Schaden anrichten. Deshalb ist der Ausbau der europäischen Souveränität und ihrer politischen Legitimation dringlich.
Emmanuel Macron hat schon 2017 in seiner Sorbonne-Rede auf die Bedeutung eines souveränen Europas hingewiesen – ein Europa, das öffentliche Güter für all seine Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. Seit dieser Rede hat sich leider wenig bewegt. In der Gesundheitspolitik beispielsweise hat die EU nach wie vor kaum Kompetenzen. Das führt dazu, dass sich EU-Staaten in einer Krisensituation im Wettbewerb miteinander befinden, um Medikamente, medizinisches Equipment und Impfstoff. Noch hat die Bundesregierung mit der deutschen Ratspräsidentschaft die Zügel in der Hand. Es wäre also Zeit, das politische Ziel "strategische Souveränität" noch stärker als bisher auf die Agenda der EU zu setzen.






