Musenkuss auf Messers Schneide
Berlin, den 26. Februar 1912: Mit einer Arbeit über die Häufigkeit von Diabetes Mellitus im Heer erwirbt der Pfarrerssohn Gottfried Benn (1886-1956) den medizinischen Doktorgrad an der Preußischen Militärakademie für ärztliches Bildungswesen. Einen Monat später erscheint im Wilmersdorfer Verlag A.R. Meyer seine Gedichtsammlung "Morgue". Bis heute gilt diese Publikation als skandalträchtig. Da hatte ein junger Arzt sozusagen die Arbeit zur Kunst erhoben: Was er auf dem Sektionstisch unter dem Skalpell gefunden hatte, gerann hier zu einer Dichtung, die wenig mit Erbauung und Schöngeistigkeit zu tun hatte.
Als Militärarzt nimmt Gottfried Benn während des Ersten Weltkrieges an der Erstürmung Antwerpens teil. Danach wird er für drei Jahre in die Etappe nach Brüssel versetzt. An seine Tätigkeit dort an einem Krankenhaus für Prostituierte erinnert sich Benn als eine der kreativsten Zeiten seines Lebens. In dieser Zeit entstehen die "Gehirne"-Novellen - fünf Prosastücke, in denen Benn sein literarisches Alter Ego, den Arzt Werff Rönne, wie in einer medizinischen Versuchsreihe auf die Suche nach der lyrischen Kunst schickt.
Das Doppelleben als Arzt und Dichter sollte Benn zeitlebens beibehalten. Seine literarische Karriere führte durch die 20er Jahre hindurch von den avantgardistischen Caféhauszirkeln des Berliner Expressionismus zur Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Künste 1932. Ab 1926 gelangen Benns Gedichte auch über den Äther zu ihrem Publikum. Der Rundfunk eröffnet den Literaten neue Spielräume. Benn gelingt es, dieses neue Medium erfolgreich zu nutzen. Paul Hindemith hört einen von Benns Rundfunkvorträgen und lädt den Dichter daraufhin zur Zusammenarbeit ein. Das gemeinsame Oratorium "Das Unaufhörliche" hat am 22. November 1931 seine Uraufführung in der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Otto Klemperer.
Benn emigriert nach 1933 nicht, er bleibt in der Reichshauptstadt und der Preußischen Akademie der Künste. Offen sympathisiert er mit dem jungen Nazi-Regime und ebenso offen polemisiert er gegen die "Literarischen Emigranten". Zwei Jahre später distanziert sich Gottfried Benn vom Nationalsozialismus. Es gelingt ihm, sich zunehmenden Anfeindungen, die dann auch zum Schreibverbot führen, zu entziehen, indem er sich wieder als Arzt in den Militärdienst aufnehmen lässt. Die während des Krieges verfassten "Statischen Gedichte" erscheinen erst nach dem Krieg und bilden den Grundstein für den späten Ruhm Benns.
Die "Lange Nacht" lässt den Dichter und sein Werk zu Wort kommen. Neben O-Tönen und Ausschnitten aus Werken Benns diskutiert Joachim Scholl mit Studiogästen den widerspruchsvollen Lebensweg eines der größten deutschen Dichter.
Die Studiogäste:
Das Doppelleben als Arzt und Dichter sollte Benn zeitlebens beibehalten. Seine literarische Karriere führte durch die 20er Jahre hindurch von den avantgardistischen Caféhauszirkeln des Berliner Expressionismus zur Mitgliedschaft in der Preußischen Akademie der Künste 1932. Ab 1926 gelangen Benns Gedichte auch über den Äther zu ihrem Publikum. Der Rundfunk eröffnet den Literaten neue Spielräume. Benn gelingt es, dieses neue Medium erfolgreich zu nutzen. Paul Hindemith hört einen von Benns Rundfunkvorträgen und lädt den Dichter daraufhin zur Zusammenarbeit ein. Das gemeinsame Oratorium "Das Unaufhörliche" hat am 22. November 1931 seine Uraufführung in der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Otto Klemperer.
Benn emigriert nach 1933 nicht, er bleibt in der Reichshauptstadt und der Preußischen Akademie der Künste. Offen sympathisiert er mit dem jungen Nazi-Regime und ebenso offen polemisiert er gegen die "Literarischen Emigranten". Zwei Jahre später distanziert sich Gottfried Benn vom Nationalsozialismus. Es gelingt ihm, sich zunehmenden Anfeindungen, die dann auch zum Schreibverbot führen, zu entziehen, indem er sich wieder als Arzt in den Militärdienst aufnehmen lässt. Die während des Krieges verfassten "Statischen Gedichte" erscheinen erst nach dem Krieg und bilden den Grundstein für den späten Ruhm Benns.
Die "Lange Nacht" lässt den Dichter und sein Werk zu Wort kommen. Neben O-Tönen und Ausschnitten aus Werken Benns diskutiert Joachim Scholl mit Studiogästen den widerspruchsvollen Lebensweg eines der größten deutschen Dichter.
Die Studiogäste:
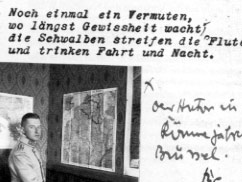
Gottfried Benn in Brüssel 1915-1916© Deutsches Literaturarchiv Marbach
Gottfried Benn bei Klett-Cotta
Doppel-Jubiläum im Jahr 2006:
120. Geburtstag am 2. Mai 2006 und 50. Todestag am 7. Juli 2006
Gottfried Benn
Das Jahrhundertwerk
2 Bde.
Sämtliche Gedichte; Künsterlische Prosa.
2006 Klett-Cotta
Gottfried Benn liest:
Einsamer nie
Ausschnitt aus: Soll Dichtung das Leben bessern?
Vortrag im Kölner Funkhaus 15.11.1955
Gedichte
Gottfried Benn
Einsamer nie
Gedichte und Prosa - gelesen von Gottfried Benn
Der HörVerlag
Zwei Cassetten
Alle Abbildungen dieser Seite entstammen dem Ausstellungskatalog "1886-1956 Gottfried Benn" des Deutschen Literaturarchivs Marbach/Neckar hrsg. von Ludwig Greve (1986)
Pfarrerssohn, Arzt, Soldat, Dichter, Ehemann und Liebhaber sind nur einige der Rollen, die Gottfried Benn (1886-1956) im Laufe seines Lebens eingenommen hat.
"Als ich ein halbes Jahr als war, zogen meine Eltern nach Sellin in der Neumark; dort wuchs ich auf. Ein Dorf mit 700 Einwohnern in der norddeutschen Ebene, großes Pfarrhaus, großer Garten, drei Stunden östlich der Oder. Das ist auch heute noch meine Heimat, obgleich ich niemanden mehr dort kenne, Kindheitserde, unendlich geliebtes Land. Dort wuchs ich mit den Dorfjungen auf, sprach platt und wenn es nicht die Arbeiterjungen waren, waren es die Söhne des ostelbischen Adels, mit denen ich umging. Diese alten preußischen Familien hier besaßen sie ihre Güter, und mein Vater hatte einen ungewöhnlichen seelsorgerischen Einfluß gerade in ihren Kreisen. Brandenburg blieb auch weiter meine Heimat. Das Gymnasium absolvierte ich in Frankfurt a.d. Oder, zum Glück ein humanistisches, studierte dann auf Wunsch meines Vaters Theologie und Philologie, zwei Jahre lang entgegen meiner Neigung; endlich konnte ich meinem Wunsch folgen und Medizin studieren. Es war das dadurch möglich, daß es mir gelang, auf die Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen in Berlin aufgenommen zu werden. Eine vorzügliche Hochschule, alles verdanke ich ihr! Virchow, Helmholtz, Leyden, Behring waren aus ihr hervorgegangen, ihr Geist herrschte dort mehr als der militärische, und die Führung der Anstalt war mustergültig. Ohne den Vater stark zu belasten, wurden für uns alle die sehr teuren Kollegs und die Kliniken belegt Dazu bekamen wir eine Reihe von Vorträgen und Vorlesungen über Philosophie und Kunst und allgemeine Fragen und die gesellschaftliche Bildung des alten Offizierskorps. Rückblickend scheint mir meine Existenz ohne diese Wendung zur Medizin und Biologie völlig undenkbar."
(Lebensweg eines Intellektualisten, 1934)
Weiterlesen unter gottfriedbenn.de
DHM: Gottfried Benn
Gottfried-Benn-Biografie bei Wikipedia
Seine Literatur vertritt vehement die Autonomie einer Kunst, der das politische Tagesgeschäft gleichgültig sein muss, sieht Benn doch in der literarischen Kunst - mit Nietzsche - die letzte metaphysische Tätigkeit des modernen Menschen. Ist der Beginn von Benns Schaffen in der Strömung des Expressionismus verankert, so sind doch zugleich ein Ton angeschlagen, eine Sprache, ein "beat", die einzigartig sind in der deutschen Literatur und die Leserschaft stets gespalten haben in Benn-Verehrer und diejenigen, denen er zu verstiegen, zu weltfern und artistisch war.
Die Lange Nacht über Gottfried Benn verfolgt den Lebenslauf dieses Ausnahmedichters, der zu den ganz wenigen seiner Generation gehört, die beide Weltkriege überlebt haben und so ästhetische Positionen der klassischen Moderne bis in die Zeit nach dem II. Weltkrieg weiterverfolgen konnte. Folgen Sie in den nächtlichen Stunden, zu denen die Musen die Dichter auf- und heimzusuchen pflegen, den Gesprächen der Studiogäste, hören Sie Benn im O-Ton und ausgewählte Musik von Chopin bis Schönberg.
Die "Lange Nacht über Gottfried Benn" verfolgt sein facettenreiches, widerspruchsvolles Leben und stellt den Autor vor, den eine Umfrage unter 50 namhaften Vertretern des Feuilletons 2001 als den bedeutendsten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts ermittelte.
Berlin, März 1912: "Morgue", nach dem Pariser Leichenschauhaus benannt, heißt der sechs Gedichte umfassende Zyklus mit dem der 26jährige, frisch zum Militärarzt promovierte Gottfried Benn seine lyrische Stimme erhebt. Von Erbauung und empfindsamer dichterischer Besinnlichkeit keine Spur. Was sich den Augen des jungen Arztes unter dem Skalpell auf dem Sektionstisch dargeboten hatte, wird hier in schlaglichtartigen Momentaufnahmen lyrisch festgehalten: Die "Kleine Aster" im Mundwinkel eines Toten oder das Rattennest und die "schöne Jugend" seiner Bewohner im Körper eines ertrunkenen Mädchens. Inwieweit die "Morgue"-Gedichte den Skandal provoziert haben, den Autor und Verleger stets gerne behauptet haben, ist angesichts von 500 Exemplaren des Flugblattes eine andere Frage.
Benns Literatur finden Sie im Internet unter: www.litlinks.it./b/benn.htm
Berlin, 1931: Eine kleine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Berlin-Kreuzberg sichert Gottfried Benn ein oft mehr als bescheidenes Auskommen. Als Autor ist er einer - wenn auch kleinen - Öffentlichkeit bekannt, zu Reichtum hat er es damit nicht gebracht. Neben Gedichten veröffentlicht er weiter Prosa und Essays in Zeitungen. Seit 1925 erklingen zunächst Benns Gedichte, dann auch Essays im eigenen Vortrag im neuen Medium Rundfunk. Hier hört ihn auch der Komponist Paul Hindemith und nimmt Kontakt zu Benn auf, dessen Artistik in den literarischen Kreisen als die Gegenposition zu den sozialistischen Programmatiken von Bertolt Brecht, Johannes R. Becher oder Egon Erwin Kisch verstanden wird. "Das Unaufhörliche" heißt das Oratorium, das am 21.11.1931 unter der Leitung von Otto Klemperer in Berlin uraufgeführt wird. Benn hat durch die 20er Jahre eine ästhetische Position der ahistorischen, zweckfreien Kunst vertreten. Seine Bemühungen, den Arztkittel an den Nagel hängen zu können, lassen ihn auf allen verfügbaren Kanälen, die Werbetrommel rühren für seine Art von Kunst- und Literaturverständnis.
Berlin, 1933: Benn trommelt auch dann noch, als die Nazis die Preußische Akademie der Künste übernehmen, deren Sektion für Dichtung Benn seit 1932 angehört. Die Essays und Rundfunkvorträge aus der Zeit bis 1934 gehören zu den dunkelsten Kapiteln in Benns Werken. Geradezu verzweifelt versucht er, sich den neuen Machthabern anzudienen und seine künstlerische Position zu retten. 1935 verlässt Benn ernüchtert Berlin und entzieht sich unter dem Eindruck des "Röhm-Putsches" möglichen Nachstellungen durch den Eintritt in die Wehrmacht. Als 1936 die SS Presse gegen ihn zu hetzen beginnt, wird Gottfried Benn mit Schreibverbot belegt.
Darmstadt, 21.10.1951: Gottfried Benn erhält als erster nicht aus Hessen stammender Autor den Georg-Büchner-Preis. Sichtlich ergriffen nimmt der Dichter den Preis entgegen. Immerhin hat es bis 1948 gedauert, bis Benn zunächst in der Schweiz und dann in Deutschland wieder veröffentlichen kann. Seine aus der Kriegszeit stammenden "Statischen Gedichte" sowie die Prosa und zwei Hörspiele aus den 50er Jahren leiten das Alterswerk Benns und ein Comeback ein, das Benn selbst wohl als letzter erwartet hätte.
Buch- und CD-Tipps
Gottfried Benn
Einsamer nie
Gedichte und Prosa - gelesen von Gottfried Benn
Der HörVerlag
Zwei Kassetten
Wer noch mehr von Gottfried Benn hören möchte, sei an die für das Frühjahr 2004 angekündigte 9CDs umfassende Edition der Rundfunkaufnahmen Benns bei Zweitausendeins verwiesen.
Helma Sanders-Brahms
Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
Rowohlt Verlag
Die Doppelbiografie. Gottfried Benn, selbst avantgardistischer Sprachkünstler von Rang, verliebte sich rasend in "die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte" (G.B.). Else Lasker-Schüler hatte bereits zwei Ehen hinter sich und einen heranwachsenden Sohn, als sie und der 17 Jahre jüngere Pastorensohn Gottfried Benn ("schön wie ein junger Gott") sich 1912 in Berlin begegneten. Beide haben ihre Liebe vor aller Öffentlichkeit in ihren Dichtungen zelebriert. Lasker-Schüler und ihr "gestreifter Tiger" erleben eine gemeinsame leidenschaftliche Zeit in der Berliner Boheme und steigern sich in ihren Gedichten zum schönsten (und erotischsten) Liebesdialog der Welt.
Thomas Doktor und Carla Spies
Gottfried Benn - Rainald Goetz.
Medium Literatur zwischen Pathologie und Poetologie
Westdeutscher Verlag, 1997
Die Autoren analysieren die Analogien und Unterschiede der literarischen Debüts von Benn und Goetz sowie die intertextuellen Verknüpfungen im Frühwerk der beiden Autoren-Mediziner analysieren.
Kommentierte Linkliste zu Gottfried Benn
Wolfgang Emmerich
Gottfried Benn
rororo Monographien
2006 Rowohlt TB.
Gunnar Decker
Gottfried Benn
Genie und Barbar
Biographie.
2006 Aufbau-Verlag
Text + Kritik.
Zeitschrift für Literatur, Herausgeber: Arnold, Heinz L..
H.44 Gottfried Benn
2006 Edition Text und Kritik
Dieses TEXT+KRITIK Heft widmet sich vor allem Gottfried Benns Poetik und sucht seinen Ort in der Kunst seiner Zeit. Es befasst sich mit seinem Verhältnis zur Medizin und den Naturwissen-schaften, zum"Dritten Reich"sowie zu Zeitge-nossen, u.a. zu Else Lasker-Schüler, Thea Sternheim und Ernst Jünger.Junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller schreiben über ihr Verhältnis zu Benn und eine Collage aus Gedichten und autobiografischen Texten Benns vermittelt ein anschauliches Bild des faszinierenden Autors.
Briefwechsel 1949-1956
Gottfried Benn, Ernst Jünger
Hrsg., kommentiert u. Nachw. v. Holger Hof
2006 Klett-Cotta
Joachim Dyck
Der Zeitzeuge
Gottfried Benn 1929-1949
2006 Wallstein

Gottfried Benns Buch "Söhne" (1913)© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Gottfried Benn im Labor (1916)© Deutsches Literaturarchiv Marbach
