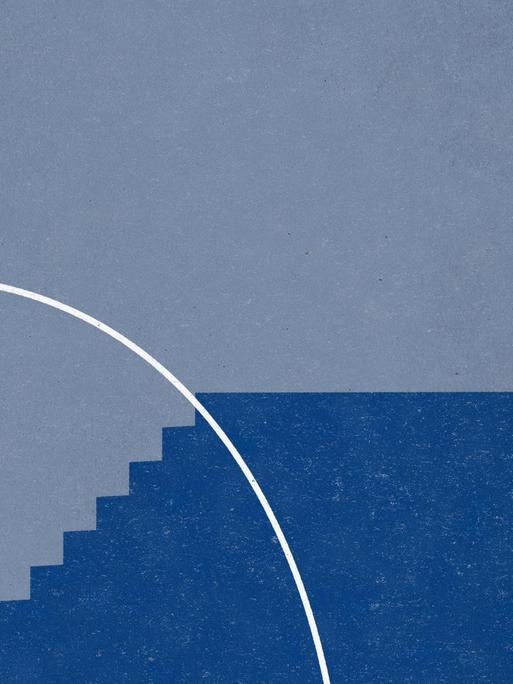Sprecher: Tom Vogt
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Technik: Hermann Leppich
Redaktion: Carsten Burtke
Frauen haben oft das Nachsehen
27:59 Minuten

Komponisten, Dirigenten, Solisten: In der klassischen wie zeitgenössischen Musikszene nimmt ein Geschlecht unangefochten die Führungsrolle ein. Warum das so ist und was geschehen muss, um es zu ändern, erklären Frauen und Männer aus der Musikwelt.
Stellen wir uns vor: Ein Alien, Captain Krik, also eine Art Captain Kirk mit umgedrehtem Düsenantrieb, gerät während seines Besuchs auf der Erde unversehens in einen irdischen Konzertsaal. Irgendwer schubst ihn auf einen freien Platz, allmählich dimmen die Kronleuchter des Saales auf Schummerlicht, nur die Bühne ist hell erleuchtet. Und der Captain sieht dort, was Manos Tsangaris so beschreibt.
"Alle diese Leute, uniformiert, in so einer komischen pinguinartigen Uniform: Sie kommen reingewackelt. Plötzlich klatschen alle. Man weiß noch nicht warum, aber die klatschen, ist ja noch gar nix passiert. Also der reine Auftritt. Dann wird irgendwie mit den Frequenzen gearbeitet. Irgendwas wird angeglichen. Da steht jemand auf, trötet was rein, spielt in einen Ton, alle folgen ihm. Das kann es aber noch nicht gewesen sein. Dann entsteht eine Stille. Ein Moment von Stille. Und dann kommt noch einer. Dann kommt noch einer, und dann klatschen sie wieder, und so weiter. Und dieser eine, das scheint der wichtigste Mensch zu sein weil: Tritt auf, ist auch ein Mann übrigens, tritt auf. Und dann stellt er sich vorne hin und alle sind ganz gespannt, blicken auf ihn, und dann fängt er an zu zucken, und alle müssen hinterher. Ja, das ist also pure Monarchie, oder? Einer steht vorne, zuckt, und alle müssen reagieren, oder?
Ja, und dann findet ein Frequenzereignis statt: die Luft, irgendwie bewegte Luft. Dieses Frequenzereignis geht irgendwie so rauf und runter und wird mal irgendwie rhythmisierter und weniger rhythmisiert. Und dann am Ende, wenn meistens, wenn dann alle ziemlich in Rage geraten sind und Schweißtropfen versprüht haben, gibt es plötzlich wieder eine Pause. Aber alle sind starr. Und dann fangen diese anderen, die gegenübersitzen, an, wie wild wieder mit ihren Händen gegeneinander zu klatschen und dann gehen sie. So dieses Ritual ist einfach absolut. Das klassische Musikritual."
Manos Tsangaris ist Komponist, Musiker und Direktor der Sektion Musik der Akademie der Künste Berlin.
Je höher die Posten im Orchester, desto weniger Frauen
Was der Alien sah, was wir gerade hörten, ist ein Orchester, das ein bekanntes klassisches Stück zum Besten gab, von Musikern gespielt, die im Durchschnitt zu 60 Prozent Männer und zu 40 Prozent Frauen sind. Stand 2020, sagt eine unlängst veröffentlichte Studie des Deutschen Musikinformationszentrums, kurz MIZ, über die Geschlechterverteilung in 129 öffentlich finanzierten Berufsorchestern.
Aber was heißt das? Soll man dieses Verhältnis schon als Gender-Erfolg bewerten? Ich mache mich auf eine Reise und frage nach. Es geht nach Bonn, dort im MIZ sitzt Timo Varelmann, der an dieser Studie mitgearbeitet hat und die Details erläutert.
"Wenn man jetzt weiter rein blickt in die Position innerhalb des Orchesters, was ein Kernpunkt dieser Studie auch war, zeigt sich, dass in den höheren Positionen – sprich Konzertmeisterpositionen, Stimmführung, Solopositionen –, dass dort der Frauenanteil unter 30 oder knapp 30 Prozent liegt", kritisiert er.
"Das heißt, verglichen mit diesem Gesamtanteil, findet man doch dann einen unterdurchschnittlichen Frauenanteil tatsächlich in den höheren Positionen. Wo wir in der Studie nachgeschaut hatten, war die tarifliche Eingruppierung dieser Orchester, und da zeigte sich noch mal zusätzlich, dass in den höchst dotierten Orchestern der Frauenanteil in höheren Positionen bei etwas über 20 Prozent liegt."
"Das sind eindeutig hierarchische Unterschiede"
Das heißt: Je höher die Posten, je besser besoldet die Dienststellung, desto weniger Frauen. Timo Varelmann hat das aufgrund seiner Erfahrungen so auch erwartet, erzählt er mir. Dennoch, meint er, gab es beim Blick auf die Positionen innerhalb der Orchester Überraschungen.
So hat die erste Violine einen Frauenanteil von 60 Prozent inne, bei den nicht-solistischen Spielerinnen beträgt er sogar zwei Drittel. Bei den prestigeträchtigen, also höher dotierten Stellen, überwiegt allerdings wieder der Männeranteil: Bis zu 70 Prozent sind das beispielsweise bei den Konzertmeistern. "Das sind eindeutig hierarchische Unterschiede", sagt mir Timo Varelmann zum Abschied.

Das Streichquartett des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin bei einer Probe: Juliane Färber engagiert sich im Orchestervorstand.© Deutschlandradio/Volker Michael
Wie kommt es zu einer derart systematischen Benachteiligung von Frauen in den öffentlich finanzierten Orchesterbetrieben? In Berlin treffe ich dazu die Konzertviolinistin Juliane Färber und frage sie: Wieso gibt es so wenige Frauen in den Führungspositionen?
Frauen wird weniger Führungsstärke zugetraut
"Also ich glaube, oft ist es tatsächlich so, dass sich auch prozentual weniger Frauen auf solche Stellen bewerben. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sehr oft Frauen, das glaube ich auch, weniger zugetraut wird", sagt sie.
"Also wenn dann eine Frau und ein Mann beide spielen, und beide sind ungefähr gleich gut, die Frau vielleicht sogar ein bisschen besser, dann in den allermeisten Fällen der Mann genommen wird, eben, weil es um Führungsstärke geht und Überlegenheit und die mentale Stärke, so einen Job ausführen zu können."
Juliane Färber ist festes Mitglied des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin und engagiert sich im Orchestervorstand. Ich rede mit ihr in den Gängen des Großen Sendesaals im Berliner Haus des Rundfunks. Färber hat gerade "Dienst". So heißt das, wenn man in einem großen öffentlichen Orchester Probe hat.
"Ich bin eher ein Fan der Quote"
Färber ist dankbar, hier Teil eines Ganzen zu sein, denn es gäbe hier bereits einige Führungspositionen, "die mit richtig starken Frauen besetzt sind." Insgesamt sei man "überdurchschnittlich gut aufgestellt." Im Allgemeinen findet sie jedoch, dass eine Quotierung das Mittel der Wahl ist, um eine wirkliche Gleichstellung in den Orchestern zu erreichen.
"Ich bin eher ein Fan der Quote, ganz grundsätzlich. Ich finde es schon, dass Qualität wahnsinnig wichtig ist, aber es ist eben oft trügerisch. Und ich glaube, in dem Moment, wo da eine Frau, ein Mann im Finale sind, da sollte man immer eher den Frauen die Stelle geben. Kommt eben vielleicht auf die Stelle drauf an. Aber ich glaube, Führungsposition kann man nur so bestärken. Man kann nur so versuchen, eine Ausgeglichenheit langsam peu à peu."
Soweit zu den Orchestermitgliedern. Noch deutlich langsamer geht es in puncto Gleichberechtigung bei den Dirigentinnen. Jüngstes Beispiel: Sir Simon Rattle – eine Dirigentenikone – bekam im Januar dieses Jahres einen Fünfjahresvertrag als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Dazu las ich in der "FAZ", diese Personalpolitik sei ein "eingefahrenes Muster der Mutlosigkeit." Dann bringt der Kommentator zwei Dirigentinnen als Alternative ins Spiel, die internationale Erfolge feiern: "An Frauen wie Mirga Grazinyte-Tyla oder Oksana Lyniv hat man ... wohl nicht gedacht."
Nur vier Chefdirigentinnen in Deutschland
Zurück nach Bonn. Anke Steinbeck ist hier Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Musikrat. Auf sie wurde ich aufmerksam, weil sie 2010 eine Dissertation mit dem Titel "Jenseits von Mythos Maestro – Dirigentinnen für das 21. Jahrhundert" veröffentlichte. Sie erzählt mir von den Resultaten ihrer Arbeit.
"Der Konzertbetrieb gilt als einer der konservativsten per se", sagt sie. "Eine Musikerin sagte mal zu mir: ‚Ehrlich gesagt, ich möchte auch keine Dirigentin haben. Ich will geführt werden. Ich brauche das Knistern von dem männlichen Dirigenten vor mir.‘ Und ja, ich glaube, es braucht einfach noch eine lange Zeit, bis wir dieses Bild, was wir in uns tragen, auflösen können."
Ebenfalls viel Zeit ist ja auch seit der Veröffentlichung ihrer Dissertation vergangen. Sieht Steinbeck mittlerweile eine Entwicklung zum Positiven, was die Repräsentanz von Chefdirigentinnen angeht?
"Damals, 2010, gab es vier Chefdirigentinnen in Deutschland. Heute, zehn Jahre später, gibt es noch immer nur vier – vier neue, vier andere Namen, aber es sind immer noch nur vier. Aktuell befinden wir uns in so einem Moment, dass die Agenturen sagen, Dirigentinnen sind gerade heiß begehrt, aber nur als Gäste. Das heißt, für jedes Orchester – ich übertreibe – für jedes Orchester ist erst einmal attraktiv, eine Dirigentin zu sich einzuladen. Aber einmal im Jahr, so nach dem Motto, reicht. Es muss auch nicht unbedingt qualitativ passen, sondern Hauptsache, da steht ein ‚in‘ hinter dem ‚Dirigent‘. Das ist zumindest das, was Agenturen mir widerspiegeln. Und das entsetzt natürlich", sagt Anke Steinbeck.
"Auf der einen Seite ist es schön, dass es diese Wandlung gibt. Auf der anderen Seite entsetzt es einen, weil man denkt, wir fallen gerade 50 Jahre zurück. Das gab es schon Mitte des 20. Jahrhunderts, dass Frauen als bunte Hunde sozusagen eingeladen wurden, um die Aufmerksamkeit auf das Orchester zu lenken. Und die Sorge habe ich aktuell, dass wir dabei sind, eine zweite Liga zu kreieren. Dirigentinnen gibt es ja, sie werden aus Political Correctness Gründen auch eingeladen, aber, na ja, es ist wie beim Fußball: Der Männerfußball ist der richtige Fußball, und den Frauenfußball, den findet man toll. Der ist auch eine Hochachtung vor der Leistung, aber es ist trotzdem was anderes."
Ein offenbar systemisches Problem
Ich frage dazu bei Steffen Georgi nach, Chefdramaturg beim Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Chefdirigent ist hier Vladimir Jurowski. Wie hält man es in diesem traditionsreichen Orchester mit der Verpflichtung von Dirigentinnen?
"Wir haben seit bereits nun schon im dritten Jahr eine ständige Gastdirigentin", erzählt Steffen Georgi. "Eine Anfang Dreißigerin, eine fantastische Frau, eine Dirigentin, die genauso wie Vladimir Jurowski natürlich auch Akzente setzt. Als ständige Gastdirigentin hat sie auch die Möglichkeit."
Das Problem ist offensichtlich systemisch, so scheint mir: Historisch bedingt eingeschliffene Rituale, männliche Hierarchien, nicht paritätisch besetzte Jurorenstellen, die auf das vermeintlich Sichere, also meistens auf das Männliche setzen. Denn schließlich – so die gängige Meinung – müssen Erwartungshaltungen berücksichtigt und Säle gefüllt werden. Das bestätigt mir Anke Steinbeck.
"Positionen, in denen Macht, Geld und Renommee zusammenkommt, die gelten generell als äußerst konservativ. Renommierte Abo-Reihen oder große renommierte Festivals, die sind oftmals männlich dominierend besetzt. Da lädt man eben den Großmaestro ein, denn das erwartet, denkt man, das Publikum. Die große Abendgarderobe. Dazu gehört eben ein, was weiß ich, ein Zsolty zum Beispiel", erklärt sie.
"Ein Orchestermanager sagte mal zu mir, wenn ich eine Dirigentin einkaufe, dann höre ich natürlich unter den Kollegen nach, was die über diese Dirigentin sagen. Und wenn die dann zu mir sagen, die ist zickig, tu sie dir nicht an, dann lade ich sie nicht ein. Und diese Geschichten, die im Hintergrund gestrickt oder weitergetragen werden, die sind so schwierig einzuordnen, weil man da nicht rankommt. Dann kann ich noch so sehr schauen, dass eine Jury paritätisch besetzt ist. Aber das, was im Hintergrund läuft, da komme ich mit meinem Political-Correctness-Gedanken nicht hin."
Umdenken in der Akademie der Künste Berlin
Gehen wir mal ganz nach oben zu den über Jahrhunderte festgeschriebenen Hierarchien und sehen uns dort die Besetzungen an. Zum Beispiel die der Sektion Musik der Akademie der Künste Berlin. Dort sind von 66 Mitgliedern gerade einmal 14 Frauen.
Es regnet in Berlin an diesem trüben Vormittag, als ich im Akademiegebäude am Hanseatenweg dem Direktor dieser Sektion gegenübersitze: Es ist der Komponist und Musiker Manos Tsangaris. Und dem ist die deutliche Unwucht in Richtung männliche Mitglieder nicht nur bewusst, und er will etwas dagegen tun.

"Da gab es eine große Diskussion", erzählt Manos Tsangaris, Direktor der Sektion Musik der Akademie der Künste Berlin.© imago / gezett
"Wir haben als Sektion Musik vor etwa zwei bis drei Jahren freiwillig, also ohne dass irgendeine Satzungsänderung oder dergleichen nötig war, beschlossen, dass wir erst dann wieder einen Mann zuwählen jeweils, wenn vorher eine Komponistin oder eine Klangkünstlerin gewählt worden war", erzählt er. "Da gab es eine große Diskussion. Es war auch durchaus nicht einstimmig, aber eine deutliche Mehrheit."
Doch es wird noch eine gute Weile dauern, bis hier eine auch nur annähernde Parität geschaffen sein wird, erklärt mir Tsangaris.
"Wir wählen immer erst eine Frau"
"Das ist ein Prozess von innen nach außen. Seit es die Akademie gibt, ist sie de jure unabhängig. Es kann kein preußischer König kommen und sagen, der oder womöglich die muss jetzt rein. Der Umfang der Sektion ist begrenzt. Und das heißt, je nachdem, wie viel Plätze frei sind, steht überhaupt was zur Verfügung oder gibt es die Möglichkeit, jemanden dazuzuwählen", erläutert er.
"Und die Sektion Musik hat sich entschlossen, freiwillig, wir wählen immer erst eine Frau und dann einen Mann. Gut, das kann man sich ja ausrechnen, wenn nur einmal im Jahr zugewählt wird. Man wird auf Lebenszeit gewählt, deshalb besteht die Akademie zum größten Teil aus alten Männern. Als ich herkam, gehörte ich zur jungen Generation. Ich war über 50."
Manos Tsangaris ist, genauer gesagt, Jahrgang 1956 und entspricht absolut nicht dem Klischeebild eines ergrauten Akademiedirektors. Er erzählt mir zum Beispiel, dass er über Twitter eine spannende Serie verfolgt, in der Elektronikavantgardist Brian Eno Pionierinnen der elektronischen Musik vorstellt. Tsangaris wirkt frisch, begeistert, offen und weltgewandt und in keiner Hinsicht "old school". Ich bin begeistert.
Ein Musikverlag nur für Werke von Komponistinnen
Eine, die schon seit Jahrzehnten energisch gegen die hierarchische Vorherrschaft der zornigen alten Männer ankämpft, ist Renate Matthei mit ihrem Furore Musikverlag, der seit 35 Jahren ausschließlich Werke von Komponistinnen verlegt und betreut.
Als ich sie erstmals vor einem Jahr kennenlernte, schämte ich mich: Ich dachte, ich würde mich in den Genres klassischer und neuer Musik ganz gut auskennen, wusste aber so gut wie keine Komponistin zu nennen. Jetzt frage ich Renate Matthei in ihrem Kasseler Verlagsbüro: Bin ich da unterbelichtet? Und, wenn ja, weshalb?
"Sie sind nicht unterbelichtet, sondern normal. Also das Problem ist ja in der Tat, dass das überhaupt nie als Defizit empfunden wurde. Dass niemand die Frage gestellt hat: ‚Ja, können denn die Frauen gar nicht komponieren?‘ Oder: ‚Warum gibt es denn keine Werke?‘ Und das finde ich als Phänomen schon irre. Zumal es ja die Bewegung in der Literatur und in der Malerei gab. Also das lag ja nahe, dass das wohl in der Musik ähnlich sein könnte. Und meine Erfahrung ist die, dass die Musik als Kunst die konservativste ist. Und dass die nochmal auf einem ganz großen Sockel steht", sagt die Musikverlegerin.
"Ich habe mal eine Definition gehört, Musik sei die Kunst, die am gottähnlichsten sei. So, und da ist natürlich kein Platz für eine Frau. Na ja, und warum kannten Sie die nicht? Das ist ein Bildungsnotstand, eine echte Bildungslücke und von der ich hoffe, dass da langsam nachgearbeitet wird. Also, dass die Komponistinnen Einzug finden in die Schulbücher, in die Universitäten, dass sie prüfungsrelevant werden und dass da nicht nach dem Geschlecht, sondern nach der Musik geguckt wird. Das wäre auch schon mal ein Fortschritt."
Komponistinnen, die man kennen sollte
Dann bitte ich Renate Matthei, mir – als erste Lektion –, einige Komponistinnen aus ihrem Verlag vorzustellen:
"Okay fangen wir mal mit Barbara Heller an. Barbara Heller ist ja eine zeitgenössische Komponistin, die dieses Jahr 85 wird und die viel komponiert, auch viel grafische Notationen macht, viel den Kontakt mit den anderen Künsten sucht. Sie macht zum Beispiel gerne was mit bildenden Künstlerinnen", so die Musikverlegerin.

Renate Matthei betreut und verlegt mit dem Furore Verlag ausschließlich Werke von Komponistinnen.© picture alliance / dpa / Furore Verlag
Und weiter: "Emilie Mayer ist keine zeitgenössische Komponistin. Die ist gerade sehr en vogue. Wir sitzen auch gerade wieder an weiteren Symphonien von ihr. Sie ist ja im Berliner Raum aufgewachsen, geboren und ist zu ihrer Zeit total viel gespielt worden. Und dann, wie viele, in der Versenkung verschwunden, hat aber ein unheimliches Werkschaffen. Also, Emilie Meyer ist, glaube ich, eine Komponistin, die für viele interessant ist zum Entdecken von Komponistinnen. Die ist nicht abschreckend, die ist einfach schön. Schöne Musik", sagt sie.
Fanny Hensel als Vorreiterin
"Und dann mit Fanny Hensel. Das war ja eine der ersten Komponistinnen, die überhaupt entdeckt wurde von den engagierten Frauen. Ich würde die inzwischen als Vorreiterin für ganz viele Komponistinnen – so Tür öffnend – bezeichnen", erklärt Renate Matthei.
Eine andere Komponistin ist Luise Volkmann. Als Selfmadefrau hat sie sich alleine durchgekämpft. Ihre aktuelle Produktion "When the Birds Upraise Their Choir" hat sie ihrem verstorbenen Vater gewidmet.
"Die Musik ist zwar international, aber das heißt nicht automatisch divers", das ist ihr nüchternes Fazit, wenn sie mit mir über ihren Karriereweg als Saxofonistin und Komponistin spricht. Als Kind einer Arbeiterfamilie hatte sie während des Studiums erst mal Probleme, sich selbst zu finden und sich dann auch noch auf die Kommunikationsformen des intellektuellen Musikhochschulbetriebes einzulassen.
Veränderter Blick auf Hierarchien
"Als ich mit 20 angefangen habe, Jazz-Saxofon zu studieren, war ich, sage ich mal, naiv und bin halt erst einmal so als Luise da in diese Welt reingegangen und habe relativ viel Konflikt einfach erlebt in der Kommunikation mit Professoren oder auch einfach nur so für mich, als Feedback auf mich", erzählt Luise Volkmann.
"Mein Vater ist 68er gewesen, das heißt, ich hatte auch noch eine ziemlich starke Skepsis gegenüber Hierarchien." Heute erlebt sie diese Hierarchiefrage mitunter aus einem anderen Blickwinkel, als Komponistin und zugleich als Leiterin einer Big Band.
"Was problematisch an der Rolle ist, ist, dass es eine Doppelrolle ist. Also man ist sozusagen auf eine Art ja auch Chefin dann, weil man irgendwie besser weiß, was aus dieser Komposition werden soll, als Musiker, und da sozusagen nicht nur als weibliche Musikerin dasteht, sondern auch noch mal, in der, sag ich mal, hierarchischen Ordnung weiter oben steht und irgendwie mehr weiß, wenn man dieses Stück halt komponiert hat. Und dass da einfach oft so die ja eine Kompetenz infrage gestellt wird oder immer wieder gesucht wird nach Schwachstellen. Und es eigentlich immer wieder darum geht, zu beweisen, dass man das kann und dass man wirklich weiß, von was man spricht und ein Ensemble zu dirigieren."
Braucht es eine Quote für Werke von Komponistinnen?
Problematisch ist auch, dass viele Werke von Komponistinnen, seien sie klassisch oder modern, einfach nicht programmiert werden, also nicht zur Aufführung kommen. Die Verlegerin Renate Matthei ist deshalb dafür, dass wenigstens bei den öffentlichen, also von uns Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen finanzierten Festakten zu 50 Prozent Werke von Frauen gespielt werden.
Steffen Georgi in Berlin sieht das mir gegenüber skeptisch.
"Ich persönlich denke, dass an allererster Stelle die Qualität der Musik steht. Und gerade bei Festakten wird – das ist eine Tatsache – Beethoven gespielt. Da gibt es nicht die Möglichkeit, Frau oder Mann zu wählen. Das ist einfach ein Unikat. Das ist Beethoven oder es ist Bach oder so", sagt er.
"Die zeitgenössische Musik wird dort nur eher begrenzt vorkommen. Und wenn sie denn vorkommt, wird man in erster Linie schauen, ist das geeignet für einen Festakt, wenn es eine festliche Ouvertüre ist? Ja, bitteschön: Wenn eine Frau die komponiert hat, dann kann sie das sein. Ja, wenn es nicht passt, dann wird es ein anderes Stück sein."
"Nicht über Musik urteilen, die niemand gehört hat"
"So, jetzt ist ja die Frage: Wie wird Qualität bemessen", sagt Renate Matthei.
"Also Qualität kann zum Beispiel sein: Ist das Werk schon mal aufgeführt worden? Ist sie verlegt? Gab es mal Presseartikel, gab es Rundfunksendungen? Also jemand, der sagen kann, ich habe schon Aufführungen hier und da gehabt, steht natürlich ganz anders da, als wenn sie sagt: Nein, ich habe mich da und da beworben. Und ist immer abgelehnt worden. Und an den Verhältnissen muss man eben etwas ändern", fordert sie.
"Deshalb geht es dann letztendlich doch, wenn ich es ändern will, doch schon über eine Quotierung. Die Musik muss ja gehört werden, sonst geht ja gar nichts. Das ist ja doch die Krux. Die Chance muss da sein, dass die Werke gespielt werden und gehört werden und dann beurteilt. Und nicht immer über Musik urteilen, die gar keiner gehört hat. Das ist ja eine Farce."
Von den 2000 Werken der 170 Komponistinnen – klassisch wie modern –, die im Portfolio des Furore Verlages stehen, sind 2019 beispielsweise gerade einmal sechs Orchesterwerke von öffentlich finanzierten Orchestern aufgeführt worden.
Ein "gläserner Deckel" über der Orchesterwelt
Man spricht von einer Wand, gegen die gelaufen wird, von einem "gläsernen Deckel", der die schöne heile Orchesterwelt nach oben hin abdichtet: bloß nichts Neues, jedenfalls nicht gleich! Und das betrifft zum einen Werke von Komponistinnen, als auch generell Stücke der sogenannten Neuen Musik.
Wie sieht das Steffen Georgi, der als Dramaturg des Rundfunk-Sinfonie-Orchesters Berlin ein erfahrener Programmierer der jeweiligen Spielzeit ist?

Größen wie Tschaikowski, Beethoven oder Brahms dominieren die Programme, sagt Steffen Georgi.© imago / STPP
"Es ist ja so, dass die Musik des 20. Jahrhunderts einen schweren Stand hat im Konzertprogramm bis lange Zeit in dieses Jahrhundert hinein. Und dass es heute noch so ist, dass die Konzertprogramme im Wesentlichen aus Tschaikowski, Beethoven, Brahms gebaut sind und dass die Musik des 20. Jahrhunderts punktuell und auch zunehmend eine Rolle spielt. Nun ist es ja nicht so, dass vom 1. Januar 1900 an plötzlich die Hälfte der Komponierenden Frauen gewesen sind. Es war auch ein langsamer Prozess", erklärt er.
"Aber es ist heute so, würde ich sagen, dass tatsächlich fast eine Parität herrscht. Dass es also genauso viel komponierende Frauen wie komponierende Männer gibt, die alle gemeinsam das gleiche Problem haben, dass sie halt heute leben oder fast bis eben noch gelebt haben und sich deswegen behaupten müssen in diesem Geschäft. Und das ist für jeden von denen, gleich welchen Geschlechts, schwierig."
Neue Musik hat generell schweren Stand
Manos Tsangeris, neben seiner Tätigkeit bei der Akademie der Künste auch selbst Komponist, weiß um diese Schwierigkeit.
"Das finde ich tragisch. Das finde ich problematisch für die Gesellschaft, weil, das sind eigentlich unsere großen Laboratorien, die wir nutzen können, um Öffentlichkeit wirklich zu gestalten, zu differenzieren, sich auseinanderzusetzen, Konflikte zu schärfen. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin dafür, dass auch für die großen Bühnen 50 Prozent der Kapazität für zeitgenössische Produktionen da sein müssten, in dem Bewusstsein, dass dann auch viel Schrott dabei ist.", sagt er.
"Entweder gibt es diese fünf bis zehn Produktionen pro Spielzeit auf halb Europa gerechnet, wo dann in die große Bühne mal drei bis fünfmal freigemacht wird für bestimmte, sowieso sehr gut eingeführte, Protagonisten, meistens Männer. Da wäre ich für eine Quotierung, einfach, weil es über Jahrtausende inzwischen Ungerechtigkeiten gegeben hat, die kulturhistorisch und machtpolitisch bedingt sind, sehr oft am Ende auch ökonomisch. Es geht immer um Geld und Besitz oder Eigentum letztlich. Deshalb muss man da vielleicht ein bisschen übers Maß hinausschießen, um da zu versuchen, da dran zu drehen und zu verbessern."
Rundfunk bildet das Konzertgeschehen ab
Ein Mittel könnte doch sein, diese Musikformen, die Stücke von Komponistinnen auch im Rundfunk hörbar zu machen. Es gibt ja durchaus viele Klassikprogramme, die eine Plattform sein könnten.
Das frage ich Alexander Lück. Er ist bei RBB Kultur verantwortlicher Redakteur für die Musikproduktionen, die auf dieser Welle gesendet werden.
"Es ist ja so: Wir bilden eigentlich das ab, was die Orchester in ihren Konzertprogrammen spielen. Das heißt, unser Angebot ist eigentlich das, was einmal pro Saison vom Deutschen Symphonieorchester, Rundfunksymphonieorchestern, von wem auch immer, geplant wird. Und wir gucken uns dann an, welche Programme wir nehmen. Und der Anteil von Komponistinnen in diesem Programm ist wirklich sehr, sehr gering. Dass man in einer ganzen Saison, sagen wir mal, über 10 Prozent an Werken von Komponistinnen findet, ist einfach nicht der Fall", sagt er.
"Das heißt, selbst, wenn wir wollten und wir wollten in unseren Konzertübertragungen viel mehr Komponistinnen vertreten haben, hätten wir es gar nicht, weil wir das nämlich gar nicht in der Angebotsliste unserer Rundfunkorchester beziehungsweise auch der anderen Orchester haben. Und da sehe ich ganz klar, dass das da die Klangkörper und die Dirigenten oder auch die Dirigentinnen stärker noch mal, glaube ich, wirklich die Netze auswerfen müssen, um einfach Repertoire zu entdecken. Und je häufiger man das macht und je mehr man da spielt, umso selbstverständlicher wird das auch."
Tendenzen zum Positiven erkennbar
Alexander Lück sieht aber auch positive Tendenzen: "Was man schon sagen muss, ist, die Dirigentinnen zum Beispiel werden häufiger. Ich habe gerade mal geguckt: Nächste Saison beim Deutschen Symphonieorchester sind drei Konzertprogramme mit Dirigentinnen. Das wäre vor sieben Jahren noch anders gewesen."
Eine andere positive Tendenz ist auch, dass der Anteil von Musik des 20. und 21. Jahrhunderts in der laufenden Saison des Rundfunk-Sinfonie Orchesters Berlin bei 53 Prozent liegt, eingerechnet Werke traditioneller Komponisten wie Schostakowitsch oder Strawinsky. Und ebenfalls bemerkenswert ist, dass deutschlandweit die Gleichstellung der Geschlechter bei Musikern unter 45 Jahren nahezu erreicht worden ist.
Überschattet wird dieser Trend jedoch davon, dass nur acht Prozent von Führungspositionen bei Generalmusikdirektionen und Intendanzen durch Frauen besetzt sind.
Der Alien Captain Krik wird also noch in vielen Jahren, wenn er uns mal wieder besucht, fast nur Pinguine sehen, die den Taktstock schwingen.