Mythos Vietnam
Alles wäre in Vietnam anders gekommen, wenn die Soldaten nur ausreichend Unterstützung von Politikern und der Bevölkerung erhalten hätten. Dieser Mythos hält sich auch heute noch hartnäckig. In einer Analyse des Vietnamkriegs widerlegt Bernd Greiner die Behauptung und zeigt die Verwerfungen der amerikanischen Bevölkerung zu Zeiten des Vietnamkriegs auf.
Seitdem die Dinge im Irak nicht so laufen, wie sich die Bush-Administration das vorgestellt hat, ist ein Begriff wieder aufgetaucht, dessen politische Spuren man eigentlich verwischt glaubte und der nun erneut wie ein Menetekel über den weltpolitischen Ambitionen der USA hängt: Vietnam. Doch die Erinnerung an den Verlauf des Vietnamkriegs und sein für die Amerikaner so schmähliches Ende kann Unterschiedliches bedeuten: die Warnung, sich nie mehr in einen solchen "militärischen Morast" hineinziehen zu lassen, die Erinnerung daran, dass man klare politische Ziele haben muss, wenn man sich zum Einsatz militärischer Mittel entschließt, aber auch die Aufforderung, sich dieses Mal nicht durch die Einsprüche der politischen Linken aus der Fassung bringen zu lassen und den eingeschlagenen militärischen Weg entschlossen weiterzugehen.
Welche Erinnerungen vorherrschen und welchen Schlussfolgerungen man zuneigt, hängt nicht nur von der politischen Positionierung ab, sondern auch davon, ob man eine eher europäische oder eine wesentlich amerikanische Erinnerung an den Vietnamkrieg hat. Letzteres schließt, so Bernd Greiner, einen für das Selbstverständnis vieler Amerikaner zentralen Mythos ein:
"Amerika, so die seit den Indianerkriegen populäre Meistererzählung, führt seine Kriege nicht aus freien Stücken oder selbstsüchtigen Motiven, sondern findet sich stets in der Rolle des überraschend und aus dem Hinterhalt Angegriffenen. Seine Truppen haben es mit Feinden zu tun, die den offenen Kampf scheuen und stattdessen die Wehrlosen und Schwachen, Frauen und Kinder attackieren - und damit zu verstehen geben, dass sie Freiheit und Sicherheit an der Wurzel treffen wollen. Diese Verachtung für das Leben anderer findet sich in der Geringschätzung des eigenen Lebens gespiegelt: Vor die Wahl zwischen Kapitulation und Untergang gestellt, optieren die fanatisierten Feinde der Zivilisation für Letzteres. Wer es aber mit Kamikazekämpfen im Dienste des Übels zu tun hat, wird notgedrungen zu einem Krieg ohne Regeln gezwungen und muss sich um der Rettung vor der Barbarei willen zeitweilig selbst barbarischer Mittel - den alles vernichtenden Gegenschlag eingeschlossen - bedienen."
Das klingt, als sei es unmittelbar auf den aktuellen Krieg gegen den Terror bezogen, ist aber tatsächlich ein Resümee der amerikanischen Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, in Sonderheit der moralischen Selbstprüfung der Nation nach Aufdeckung des Massakers, das amerikanische Truppen in dem Dorf My Lai angerichtet haben.
Der Historiker Bernd Greiner, der den Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" am Hamburger Institut für Sozialforschung leitet, wollte zunächst ein Buch über das Massaker von My Lai schreiben, wo US-Soldaten ein paar Hundert vietnamesische Zivilisten, vor allem Frauen, Kinder und Alte, mit Handfeuerwaffen gezielt ermordet haben, aber daraus entstanden ist eine eindrückliche Analyse des Vietnamkrieges sowie seiner Verarbeitung durch die amerikanische Gesellschaft. Greiner hat sich durch Tausende von Aktenordnern und Archivboxen gearbeitet, und dabei hat er nicht nur die Wegmarken untersucht, die zu den Massakern hingeführt haben, sondern hat auch die strafrechtliche Bearbeitung des Massakers durch die US-Militärjustiz geprüft und die zigtausend Petitionen in Augenschein genommen, die nach der Verurteilung eines amerikanischen Offiziers bei Abgeordneten und Regierung eingegangen sind, und die zu neunzig Prozent die Verurteilung kritisiert und die umgehende Freilassung des Leutnant Calley gefordert haben.
Tatsächlich wurde dessen Verurteilung zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe sehr bald in einzelnen Schritten auf ein paar Jahre Hausarrest reduziert. Wer die Abschnitte in Greiners Buch über die Bearbeitung von Kriegsverbrechen durch die US-Militärjustiz und die anschließende öffentliche Debatte in den USA gelesen hat, wird besser verstehen, warum die USA die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag für ihre eigenen Soldaten nicht anerkennen. Das wird auch bei einem anderen Präsidenten nicht anders sein.
Mindestens ebenso instruktiv wie Greiners Analyse der rechtlichen und moralischen Aufarbeitung des Vietnamkriegs ist die Untersuchung des Wegs in diesen Krieg, insbesondere die Entwicklung der in ihm angewandten Strategie. Man hat später gerne die Erklärung des amerikanischen Oberkommandierenden in Vietnam, General William Westmoreland, aufgegriffen, wonach die USA den Krieg durch die Berichte der eigenen Medien in der Heimat verloren hätten - eine Variante dessen, was man in Deutschland einmal als Dolchstoßlegende bezeichnet hat.
Greiners akribische Darstellung zeigt freilich, dass der Krieg in Vietnam verloren wurde, weil in ihm die militärischen Instrumentarien und die politischen Ziele zu keiner Zeit zusammenpassten: Politisch ging es darum, die Köpfe und Herzen der Vietnamesen für sich zu gewinnen; militärisch führte man gegen sie jedoch einen Vernichtungskrieg, bei dem es schließlich nur noch darum ging, möglichst viele Tote zu zählen, die kurzerhand zu gegnerischen Verlusten erklärt wurden, selbst wenn offensichtlich war, dass es sich bei ihnen um zivile Opfer handelte. Zu keinem Zeitpunkt hat das US-Militär in Vietnam eine Strategie gefunden, mit der man einen asymmetrischen Krieg führen und gewinnen konnte:
"So gesehen, erscheint das wahllose Niederbrennen von Häusern und das wilde Geballere beim Betreten von Siedlungen erst recht wie symbolische Inszenierungen. Sie gehörten zum Repertoire von Soldaten, die in Ermangelung realer Schlachtfelder sich am Ende fantasierte Kampfzonen schufen und in ihrer Fantasie alles und jeden zum Feind erklärten - zu einem Feind, den sie lokalisiert, gestellt und vernichtet hatten. 'Es fing mit ganz gewöhnlichen Gefangenen an’, berichtet ein Angehöriger der 'Amerial’ Division, 'mit Gefangenen, von denen man dachte, dass sie der Feind waren. Dann ging es weiter mit Gefangenen, die keine Feinde waren, schließlich mit Zivilisten, weil man keinen Unterschied mehr sah zwischen dem Feind und Zivilisten. Schließlich war ein Punkt erreicht, wo sie imstande waren, einfach jeden zu töten.’ Gewalt barg das Versprechen wieder gewonnener Kontrolle, sie schuf klare Verhältnisse jenseits aller Ambivalenzen und Unsicherheiten - und vor allem hinterließ sie eine mit Blut getränkte Spur eigener Macht. Darin lag ihr symbolischer Wert, ihre moralische Produktivkraft. Sie war der Beweis, etwas bewirken zu können - eine Botschaft an sich selbst und ein Mittel zur Kommunikation mit anderen."
Das Dilemma des amerikanischen Agierens bestand darin, dass man die psychische Dynamik einer Truppe nicht unter Kontrolle hielt, die durch Sprengfallen und Hinterhalte immer wieder Verluste erlitt, aber auf keinen Gegner stieß, der sich zum Kampf stellte und den man besiegen konnte. So ließ man den individuellen Gewalt- und Rachefantasien der Soldaten freien Lauf und suchte sie schließlich sogar zu einem Bestandteil der eigenen Strategie zu machen, wodurch diese immer stärker in Widerspruch zu dem übergeordneten politischen Zweck geriet. Als Anfang der 70er Jahre tendenziell jedem in Vietnam eingesetzten Soldaten klar war, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen war, setzte ein Zerfallsprozess in der Armee ein, der in Drogenkonsum, Desertion, Befehlsverweigerung, offener Widersetzlichkeit und offenbar auch der gezielten Ermordung von Vorgesetzten und missliebigen Kameraden seinen Niederschlag fand. Einige Beobachter haben diese Entwicklung mit dem Auseinanderfallen der russischen Armee im Jahre 1917 verglichen. Nicht die Heimat, sondern die Armee selbst hat den Krieg in Vietnam verloren.
Das heißt nicht, dass der Vietcong und die ihn unterstützenden Einheiten der nordvietnamesischen Armee unbesiegbar gewesen wären. Nach den schweren Verlusten der TET-Offensive standen sie am Rande des militärischen Zusammenbruchs, was freilich von amerikanischer Seite nicht hinreichend erkannt und ausgenutzt worden ist. Auf die Herausforderung des asymmetrischen Partisanenkrieges hatten Westmoreland und seine Generale nur die Antwort, den Gegner in einen Abnutzungskrieg zu verwickeln, den er zuletzt aufgrund seiner größeren Verluste und kleineren Ressourcen verlieren musste. Der Body-Count, das Zählen der Toten nach einer Operation und deren Verrechnung als getötete Gegner, war Ausdruck dieser Strategie. So führte man schließlich Krieg gegen eine Bevölkerung, die man eigentlich beschützen wollte, und zerstörte ein Land, das als prosperierendes Gegenbeispiel zum kommunistischen Entwicklungspfad aufgebaut und präsentiert werden sollte. Die asymmetrische Herausforderung verlangt klügere und raffiniertere Antworten als das plumpe Vertrauen in die eigene materielle und technologische Überlegenheit.
Die selbstzerstörerischen Effekte dieses Vertrauens kann man bei der Lektüre von Greiners Vietnambuch sehr gut studieren. Greiners Buch ist ein großartiges Beispiel dafür, dass sich sehr wohl aus der Geschichte lernen lässt: Man muss sie freilich genau studieren und seine Fragen sorgfältig stellen. Genau das hat Bernd Greiner getan.
Bernd Greiner: "Krieg ohne Fronten - Die USA in Vietnam"
Hamburger Edition, Hamburg 2007
Welche Erinnerungen vorherrschen und welchen Schlussfolgerungen man zuneigt, hängt nicht nur von der politischen Positionierung ab, sondern auch davon, ob man eine eher europäische oder eine wesentlich amerikanische Erinnerung an den Vietnamkrieg hat. Letzteres schließt, so Bernd Greiner, einen für das Selbstverständnis vieler Amerikaner zentralen Mythos ein:
"Amerika, so die seit den Indianerkriegen populäre Meistererzählung, führt seine Kriege nicht aus freien Stücken oder selbstsüchtigen Motiven, sondern findet sich stets in der Rolle des überraschend und aus dem Hinterhalt Angegriffenen. Seine Truppen haben es mit Feinden zu tun, die den offenen Kampf scheuen und stattdessen die Wehrlosen und Schwachen, Frauen und Kinder attackieren - und damit zu verstehen geben, dass sie Freiheit und Sicherheit an der Wurzel treffen wollen. Diese Verachtung für das Leben anderer findet sich in der Geringschätzung des eigenen Lebens gespiegelt: Vor die Wahl zwischen Kapitulation und Untergang gestellt, optieren die fanatisierten Feinde der Zivilisation für Letzteres. Wer es aber mit Kamikazekämpfen im Dienste des Übels zu tun hat, wird notgedrungen zu einem Krieg ohne Regeln gezwungen und muss sich um der Rettung vor der Barbarei willen zeitweilig selbst barbarischer Mittel - den alles vernichtenden Gegenschlag eingeschlossen - bedienen."
Das klingt, als sei es unmittelbar auf den aktuellen Krieg gegen den Terror bezogen, ist aber tatsächlich ein Resümee der amerikanischen Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, in Sonderheit der moralischen Selbstprüfung der Nation nach Aufdeckung des Massakers, das amerikanische Truppen in dem Dorf My Lai angerichtet haben.
Der Historiker Bernd Greiner, der den Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" am Hamburger Institut für Sozialforschung leitet, wollte zunächst ein Buch über das Massaker von My Lai schreiben, wo US-Soldaten ein paar Hundert vietnamesische Zivilisten, vor allem Frauen, Kinder und Alte, mit Handfeuerwaffen gezielt ermordet haben, aber daraus entstanden ist eine eindrückliche Analyse des Vietnamkrieges sowie seiner Verarbeitung durch die amerikanische Gesellschaft. Greiner hat sich durch Tausende von Aktenordnern und Archivboxen gearbeitet, und dabei hat er nicht nur die Wegmarken untersucht, die zu den Massakern hingeführt haben, sondern hat auch die strafrechtliche Bearbeitung des Massakers durch die US-Militärjustiz geprüft und die zigtausend Petitionen in Augenschein genommen, die nach der Verurteilung eines amerikanischen Offiziers bei Abgeordneten und Regierung eingegangen sind, und die zu neunzig Prozent die Verurteilung kritisiert und die umgehende Freilassung des Leutnant Calley gefordert haben.
Tatsächlich wurde dessen Verurteilung zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe sehr bald in einzelnen Schritten auf ein paar Jahre Hausarrest reduziert. Wer die Abschnitte in Greiners Buch über die Bearbeitung von Kriegsverbrechen durch die US-Militärjustiz und die anschließende öffentliche Debatte in den USA gelesen hat, wird besser verstehen, warum die USA die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag für ihre eigenen Soldaten nicht anerkennen. Das wird auch bei einem anderen Präsidenten nicht anders sein.
Mindestens ebenso instruktiv wie Greiners Analyse der rechtlichen und moralischen Aufarbeitung des Vietnamkriegs ist die Untersuchung des Wegs in diesen Krieg, insbesondere die Entwicklung der in ihm angewandten Strategie. Man hat später gerne die Erklärung des amerikanischen Oberkommandierenden in Vietnam, General William Westmoreland, aufgegriffen, wonach die USA den Krieg durch die Berichte der eigenen Medien in der Heimat verloren hätten - eine Variante dessen, was man in Deutschland einmal als Dolchstoßlegende bezeichnet hat.
Greiners akribische Darstellung zeigt freilich, dass der Krieg in Vietnam verloren wurde, weil in ihm die militärischen Instrumentarien und die politischen Ziele zu keiner Zeit zusammenpassten: Politisch ging es darum, die Köpfe und Herzen der Vietnamesen für sich zu gewinnen; militärisch führte man gegen sie jedoch einen Vernichtungskrieg, bei dem es schließlich nur noch darum ging, möglichst viele Tote zu zählen, die kurzerhand zu gegnerischen Verlusten erklärt wurden, selbst wenn offensichtlich war, dass es sich bei ihnen um zivile Opfer handelte. Zu keinem Zeitpunkt hat das US-Militär in Vietnam eine Strategie gefunden, mit der man einen asymmetrischen Krieg führen und gewinnen konnte:
"So gesehen, erscheint das wahllose Niederbrennen von Häusern und das wilde Geballere beim Betreten von Siedlungen erst recht wie symbolische Inszenierungen. Sie gehörten zum Repertoire von Soldaten, die in Ermangelung realer Schlachtfelder sich am Ende fantasierte Kampfzonen schufen und in ihrer Fantasie alles und jeden zum Feind erklärten - zu einem Feind, den sie lokalisiert, gestellt und vernichtet hatten. 'Es fing mit ganz gewöhnlichen Gefangenen an’, berichtet ein Angehöriger der 'Amerial’ Division, 'mit Gefangenen, von denen man dachte, dass sie der Feind waren. Dann ging es weiter mit Gefangenen, die keine Feinde waren, schließlich mit Zivilisten, weil man keinen Unterschied mehr sah zwischen dem Feind und Zivilisten. Schließlich war ein Punkt erreicht, wo sie imstande waren, einfach jeden zu töten.’ Gewalt barg das Versprechen wieder gewonnener Kontrolle, sie schuf klare Verhältnisse jenseits aller Ambivalenzen und Unsicherheiten - und vor allem hinterließ sie eine mit Blut getränkte Spur eigener Macht. Darin lag ihr symbolischer Wert, ihre moralische Produktivkraft. Sie war der Beweis, etwas bewirken zu können - eine Botschaft an sich selbst und ein Mittel zur Kommunikation mit anderen."
Das Dilemma des amerikanischen Agierens bestand darin, dass man die psychische Dynamik einer Truppe nicht unter Kontrolle hielt, die durch Sprengfallen und Hinterhalte immer wieder Verluste erlitt, aber auf keinen Gegner stieß, der sich zum Kampf stellte und den man besiegen konnte. So ließ man den individuellen Gewalt- und Rachefantasien der Soldaten freien Lauf und suchte sie schließlich sogar zu einem Bestandteil der eigenen Strategie zu machen, wodurch diese immer stärker in Widerspruch zu dem übergeordneten politischen Zweck geriet. Als Anfang der 70er Jahre tendenziell jedem in Vietnam eingesetzten Soldaten klar war, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen war, setzte ein Zerfallsprozess in der Armee ein, der in Drogenkonsum, Desertion, Befehlsverweigerung, offener Widersetzlichkeit und offenbar auch der gezielten Ermordung von Vorgesetzten und missliebigen Kameraden seinen Niederschlag fand. Einige Beobachter haben diese Entwicklung mit dem Auseinanderfallen der russischen Armee im Jahre 1917 verglichen. Nicht die Heimat, sondern die Armee selbst hat den Krieg in Vietnam verloren.
Das heißt nicht, dass der Vietcong und die ihn unterstützenden Einheiten der nordvietnamesischen Armee unbesiegbar gewesen wären. Nach den schweren Verlusten der TET-Offensive standen sie am Rande des militärischen Zusammenbruchs, was freilich von amerikanischer Seite nicht hinreichend erkannt und ausgenutzt worden ist. Auf die Herausforderung des asymmetrischen Partisanenkrieges hatten Westmoreland und seine Generale nur die Antwort, den Gegner in einen Abnutzungskrieg zu verwickeln, den er zuletzt aufgrund seiner größeren Verluste und kleineren Ressourcen verlieren musste. Der Body-Count, das Zählen der Toten nach einer Operation und deren Verrechnung als getötete Gegner, war Ausdruck dieser Strategie. So führte man schließlich Krieg gegen eine Bevölkerung, die man eigentlich beschützen wollte, und zerstörte ein Land, das als prosperierendes Gegenbeispiel zum kommunistischen Entwicklungspfad aufgebaut und präsentiert werden sollte. Die asymmetrische Herausforderung verlangt klügere und raffiniertere Antworten als das plumpe Vertrauen in die eigene materielle und technologische Überlegenheit.
Die selbstzerstörerischen Effekte dieses Vertrauens kann man bei der Lektüre von Greiners Vietnambuch sehr gut studieren. Greiners Buch ist ein großartiges Beispiel dafür, dass sich sehr wohl aus der Geschichte lernen lässt: Man muss sie freilich genau studieren und seine Fragen sorgfältig stellen. Genau das hat Bernd Greiner getan.
Bernd Greiner: "Krieg ohne Fronten - Die USA in Vietnam"
Hamburger Edition, Hamburg 2007
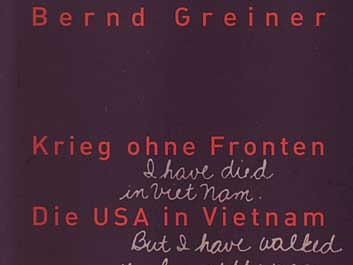
Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten.© Hamburger Edition
