Zeitbomben in der Ostsee

Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schießt das Militär in die Ostsee, im Zweiten Weltkrieg wurden allein in einer Nacht über 40.000 Bomben über Usedom abgeworfen. Unzählige Bomben und Munition rosten bis heute im Salzwasser vor sich hin und werden zunehmend zur Gefahr.
Wer in diesen herbststürmischen Zeiten an den Stränden der Insel Usedom nach Bernstein sucht, sollte besonders jene Schilder ernstnehmen, die vor der Verwechslung mit Phosphorklumpen warnen. Die Gefahr erheblicher Verbrennungen ist groß. Immer noch.
Dabei hat sie vor allem zu tun mit der Geheimaktion HYDRA im Kriegsjahr 1943. Damals wollten die Briten die deutsche Heeresversuchsanstalt für Raketenforschung Peenemünde am Nordzipfel der Insel Usedom zerstören. Allein in einer Augustnacht warf die Royal Air Force ca. 1.400 Sprengbomben, 36.000 Brandbomben sowie etwa 4.100 Phosphorbomben ab. Die meisten verfehlten ihr Ziel und landeten im küstennahen Wasser zwischen Peenemünde und Trassenheide. Detoniert ist im Wasser fast nichts. Doch weil ihr dünnes Gehäuse beim Aufprall platzte, setzten einige Bomben Phosphor frei.
Und der große unbeschädigte Rest? Rostet seit über 70 Jahren auf dem Meeresgrund vor sich hin und entlässt immer mehr Schadstoffe, sogenannte "sprengstofftypische Verbindungen", ins Wasser. Darunter Phosphor, aber auch TNT und dessen Abbauprodukte.
Die Taucher haben eine Ausbildung als Sprengstoffmeister
Derweil ist HYDRA längst nicht die einzige Quelle für die Unmenge an explosionsfähigen Bomben, Minen und Granaten am Ostseeboden, sagt der Meeresbiologe Jens Greinert.
"Zusätzlich gibt's dann auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern ehemalige Flak-Stellungen, wo natürlich auch Munition verschossen wurde. Die ist auch nicht immer explodiert. Dann gibt's natürlich die Bundeswehr- und NVA-Schießplätze, die auch oft ins Wasser rausschießen. Die Munition liegt da ja auch noch. Und das hat sich akkumuliert seit dem Ersten Weltkrieg oder sogar schon vorher. 1884 haben die angefangen ins Meer zu schießen. Und seitdem sammelt sich da immer mehr Munition im Meer an."

Das Muntionssuchschiff "Baltic Taucher" Rostock © Deutschlandradio / Silke Hasselmann
Das weiß auch Kapitän Alexander Klare. Einst auf Marine- und Containerschiffen unterwegs, sticht er seit einigen Jahren für die "Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH" in See. Der Betrieb ist unter anderem spezialisiert darauf, die Ost- und Nordsee nach Munition abzusuchen und diese gegebenenfalls zu bergen. Die "Baltic Taucher" genießen den bestmöglichen Ruf – bei Offshore-Windparkbetreibern, die für ihre Fundamente und für die Stromkabeltrassen einen geräumten Meeresboden brauchen genauso wie bei den Planern der Ostsee-Pipelines Nord Stream und jetzt Nord Stream 2, deren Gasleitungen durch den Greifswalder Bodden führen und bei Lubmin anlanden.
Ist ein Auftrag zu erledigen, sind die beiden Schiffe in zweiwöchigen Wechsel auf See, auch Kapitän Klare mit seiner "Baltic Taucher 2". Dann stets an Bord: fünf bis sechs Taucher, die eine Ausbildung als Feuerwerker oder Sprengstoffmeister gemacht haben.
"Ich sag mal, die schlimmsten Ecken in der Ostsee? Drüben Lubmin, Greifswalder Bodden. Alles was so die Teststrecke war im 2. Weltkrieg. Die Versuchsanstalt da. Man denkt jetzt anders drüber über die Jahre mit dem Ankern. Anker wegschmeißen und über Nacht liegenbleiben – da denkt man schon zweimal drüber, ob das macht oder nicht."
Denn dort hätten sie schon alles gefunden und das in rauen Mengen - von 20-Millimeter-Munition bis zur 500-Kilogramm-Fliegerbombe. Ist ein Verdachtspunkt lokalisiert, steigt ein Taucher mit Hammer, Spitzhacke und Handsonde hinab, um das Fundstück freizulegen, genauer zu betrachten und exakte Daten nach oben zu senden. Gerade bei den Kolossen unter den Bomben könne einem schon mulmig werden, sagt Kapitän Alexander Klare:
"Wenn man merkt, man braucht für diese Sonde 15 Meter Stahlabstand und man steht Diagonale 20 Meter weg von dem Ding? Also man muss einfach Vertrauen haben zu den Leuten, die da unten arbeiten. Und toi, toi, toi. Bisher noch nichts passiert."
Das größte Problem sind Rostbomben - sie können jederzeit detonieren
Auch nicht, als sie vor Lubmin einen V2-Sprengkopf samt Antrieb aus acht Metern Tiefe und einem 20 Meter breiten Krater geholt hätten. Dazu mussten die Taucher ihn zunächst freilegen. Mithilfe einer speziellen Spüleinrichtung lockerten sie zunächst vorsichtig den Sand, den sie dann wegsaugten. Vier, fünf Tage habe das gedauert, erinnert sich Alexander Klare.
Liegen die Bomben, Minen oder Granaten frei, entscheiden die Sprengmeister an Bord mit den per Video zugeschalteten Kollegen an Land, was geschehen soll. Ist ein Transport an Land zu gefährlich, wird bereits im Wasser gezündet, so wie unlängst eine Bombe in der Kadet-Rinne vor Ahrenshoop.
Heißt es hingegen "Bergen!", werden die explosionsfähigen Fundstücke in eine Gitterbox gehievt und an Land gebracht. Dort buddeln Kampfmittelbeseitiger sie wieder in die Erde, um sie kontrolliert zur Explosion zu bringen. Das Problem: Auch die "Baltic Taucher" transportieren immer häufiger Rostbomben, sagt Alexander Klare.
"Der Nachteil ist: Die können eben auch zerbrechen. Wenn sie in die Gitterbox reinpackt, muss man dolle aufpassen. Also es gibt welche, die wirklich schon angegriffen sind und Lochfraß haben, und wo man den Sprengstoff an sich, das TNT, schon da drin sieht. Ich sag mal, das Explodieren – das wäre eine kurze schnelle Sache für alle Beteiligten. Ich hätte mehr Respekt, wenn wir die an Bord genommen haben und die sich zerlegt und ausgast oder was auch alles passieren kann."
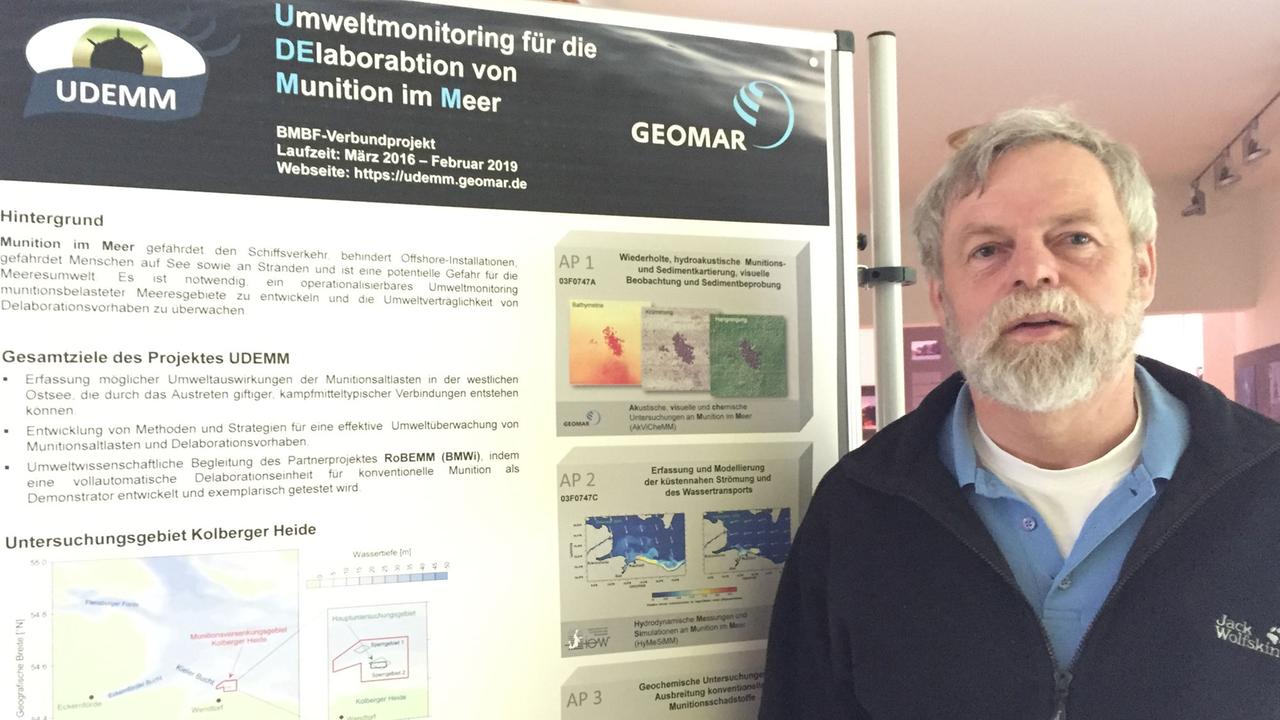
Kapitänleutnant a.D. Uwe Wichert, Munitionssucher in Ost- und Nordsee© Deutschlandradio / Silke Hasselmann
Doch auch auf solche Risiken würden die Mitarbeiter vorbereitet, ergänzt Kapitän Klare. Vor jeder Ausfahrt – also mindestens einmal im Monat – heißt es im Betrieb: Sicherheitsbelehrung. Auch der Umgang mit den Schutzanzügen werde geübt, die Bordapotheke "hochgefahren".
Auch der ehemalige Marinesoldat Uwe Wichert war schon an 16 Einsätzen im baltischen Teil der Ostsee beteiligt, bei denen 763 Minen, Bomben und Torpedos beseitigt wurden. Doch heute ist er nicht mehr ansatzweise auf so gefährlicher Kampfmittelsuche. Seit 2010 pensioniert und Mitglied Arbeitsgruppe "Munition im Meer" in Kiel, durchstöbert Uwe Wichert geeignete Archive nach zivilen wie militärischen Akten – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Recht klar sei das Bild bei den Minen:
"Wenn man das alles zusammennimmt von Skagerrak bis St. Petersburg, dann sind dort über 179.000 Minen in den beiden Weltkriegen und auch schon im Krim-Krieg gelegt worden. Dort hat die Russische Flotte ihren Kriegshafen Kronstadt mit Minen gesichert, damit die Engländer, die Franzosen, also die Alliierte Flotte nicht eindringen konnte. Alles andere - wie viel Bomben, wie viel Torpedos, wie viel Munition nach den Kriegen ins Wasser gebracht worden ist -, das ist mit mehreren Fragezeichen versehen. Aber wir arbeiten dran, dass wir alle möglichen Dokumente versuchen zu bekommen, auszuwerten, und natürlich auch: Was ist an Munition schon geborgen worden? Es ist nach den Kriegen sehr viel schon rausgeholt worden. Zum Beispiel ein Versenkungsgebiet in Deutschland im Bereich der Lübecker Bucht – da weiß man, dass da mindestens 15.000 Tonnen Munition wieder geborgen worden ist."
Viel Munition liegt außerhalb der Sperrgebiete
Derzeit schätzen Bund und Länder, dass im deutschen Ostseebereich mindestens noch 300.000 Tonnen an Bomben und Granaten, Minen und Patronen liegen. Wobei:
"Die Küste von Mecklenburg-Vorpommern war besonders im Zweiten Weltkrieg und kurz davor ein ausgedehntes Übungsgelände, und hier ist es im Augenblick noch sehr, sehr schwierig, genaue Zahlen festzulegen. Aber man kann nicht generell sagen, es gibt komplett freie Gebiete. Das hat man ja letztes Jahr mit den Strandanspülungen gesehen, dass immer wieder Munition dort aus Gebieten, wo man es eigentlich nicht vermutet hat, mit hoch geholt worden ist. Also: Wir arbeiten daran."
Es hilft natürlich, dass der Kapitänleutnant a.D. vertraut ist mit maritimen wie militärischen Gepflogenheiten. Uwe Wichert kann Logbücher verstehen, Schiffskarten lesen, militärische Codes entziffern. Auch die Originalberichte über Wetter und Seegang lassen Munitionssucher wie ihn Anhaltspunkte dafür gewinnen, wann und wo genau zum Beispiel Schiffe ihre explosive Fracht abgeschossen oder abgelegt haben müssen. Oft lasse sich aus der unmittelbaren Nachkriegszeit auch rekonstruieren, ob sich bestimmte Schiffe oder Boote längst von ihren Altlasten erleichtert hatten, bevor sie ein offizielles Versenkungsgebiet erreichten, "on-route-dumping" nennt man das.
"Wenn die erst mal zwei Tage bis zu einem Seegebiet gefahren sind und sind nach zwei Tagen wieder zurückgekommen, dann haben sie nicht viel Zeit gehabt zum Ausladen. Dann haben sie schon auf dem Weg dorthin die eine oder andere Munition rausgeworfen. Dieses on-route-dumping, also auf dem Weg zum Versenkungsgebiet Munition zu versenken, das haben wir sowohl Nordsee wie in der Ostsee überall gefunden und markiert eigentlich die Wege dorthin."
Uwe Wicherts Erkenntnisse fließen ein in die noch junge Geo-Datenbank, die sämtliche Munitionslagerplätze und Fundorte in der Ostsee auflistet. Einer der marinen Biologen, die mit dieser Datenbank arbeiten, ist Jens Greinert vom Helmholtz-Zentrum GEOMAR in Kiel. Auch er weiß, dass viele nichtgezündete Altlasten außerhalb der in Seekarten vermerkten Sperrgebiete liegen. Ein Grund: Um den Deutschen unmittelbar nach den beiden Weltkriegen den Zugriff auf noch intakte Waffen und Munition zu entziehen, hätten die Siegermächte auch Fischer angeheuert.
"Das war nach 1945. Da haben die Alliierten gesagt: Es gibt fünf Sperrgebiete in Ost- und Nordsee, wo die Munition verklappt werden sollte. Und da hat man den Fischern gesagt: 'Ihr fahrt da von hier aus hin.' Das war aber vor GPS. Das heißt, der Fischer konnte immer gar nicht so genau da hinfahren, wo er hinfahren sollte. Und er war ja schlau; er wurde nach Fahrten bezahlt. Das heißt, wenn man schneller fährt, also nicht ganz so weit fährt, dann kann man eventuell zweimal fahren und kriegt dann auch mehr Geld."
TNT reichert sich in Muscheln an
Als Rostbomben werden sie zusehends zu sprichwörtliche Zeitbomben, denn der enthaltene Sprengstoff verliert seine explosiven Fähigkeiten nicht. Hinzu kommt: Dem Salzwasser und den Strömungskräften unterworfen, beginnen die Metallgehäuse irgendwann zu zerfallen. Dann treten Schadstoffe aus, auch das im Schießpulver enthaltene TNT, sagt Professor Jens Greinert. Seit 2016 koordiniert der marine Biologe ein norddeutsches Umweltmonitoring-Projekt. Dabei geht es um die Frage, was die fortschreitende Zersetzung von Munitionsaltlasten in der Ostsee für die Meeresumwelt und letztlich auch für den Menschen bedeutet.
"Das TNT ist eben auch giftig und insbesondere die Umsetzprodukte, die Metaboliten. Die stehen auch im Verdacht, dass sie karzinogen sind, und wir wissen - das haben unsere Experimente gezeigt -, dass sie zum Beispiel durch Muscheln aufgenommen werden. Wir bringen Muscheln extra aus in unterschiedlichen Abständen in sogenannten Hotspots, also große Minenberge. Das sind wirklich Berge: 30 Meter lang, 9 Meter breit, 1,50 Meter hoch liegen dann 80 solche Minen auf einem Haufen, wo das TNT zum Teil auch schon frei liegt."
Normalerweise befindet sich das TNT in einer großen Metallhülle ohne Seewasserkontakt. So weit in Ordnung.
"Aber nach 70 Jahren fängt das an wegzurosten und das sehen wir auch. Wir haben auch einige Gebiete, wo relativ viel TNT frei am Meeresboden liegt. Das reagiert mit dem Wasser, wird auch durch Bodenströmungen und durch Sediment, was da eventuell durch die Strömungen vom Boden abgehoben wird, abrasiert. Verteilt sich dann als kleines Partikelchen, wird dann auch weiter verteilt durch die Bodenströmung und kann dann von den Muscheln in gelöster oder partikulärer Form aufgenommen werden. Das Problem ist: Wenn man es durch Muscheln aufnimmt, dann gibt es auch Fische, die die Muscheln fressen und Menschen, die die Fische essen. Und so kann das eigentlich die Nahrungskette hochwandern."
Wobei sich das TNT nicht im Fleisch der Meerestiere ablagere, sondern in der Leber, ergänzt Jens Greinert. Genauer wissen es die Kollegen vom Hamburger Thünen-Institut für Fischereiökologie. Die berichteten unlängst auf einer Fachtagung am Institut für Ostseeforschung Rostock-Warnemünde, dass sie eine Plattfisch-Art in einem besonders munitionsbelasteten Bereich der Kieler Außenförde untersucht haben. Ergebnis: 25% der Fische wiesen Lebertumore auf. In drei Vergleichsgebieten in der Ostsee habe die Tumorrate bei unter fünf Prozent gelegen.
Doch es sei noch zu früh, einen direkten Zusammenhang zwischen Krebs und TNT aus den rostenden Bomben herzustellen, sagt Jens Greinert, der vor allem im Sperrgebiet Kolberger Heide vor der Ostseeküste Schleswig-Holsteins forscht. Außerdem sei richtig, dass die Konzentration von TNT im Piktogramm-Bereich liege. Schließlich löse sich der giftige Stoff in vergleichsweise viel Ostseewasser auf.
"Es sind homöopathische Konzentrationen. Dennoch sind sie da."

Schilder warnen am Ostseestrand von Ahrenshoop vor dem Betreten eines Abschnitts, in dem Sand aufgespült und dabei in einem großen Stahlkäfig nach möglichen Munitionsresten durchgesiebt wird.© picture alliance / ZB / Bernd Wüstneck
Und sie werden stetig größer, je mehr Rostbomben zerfallen – so viel ist sicher. Doch um Umwelt- und Gesundheitspolitikern eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für mögliche Entscheidungen an die Hand zu geben, wollen auch Forscher im mecklenburgischen Rostock-Warnemünde mehr über die TNT-Belastung des Meereswassers wissen.
"Ja, also: Anja Eggert. Institut für Ostseeforschung. Ich arbeite hier in der 'Physikalischen Ozeanographie'. Wir betreiben und entwickeln Computermodelle, wo wir die Ostsee realitätsnah simulieren."
Algen verstoffwechseln TNT - doch die Abbauprodukte sind noch giftiger
Anja Eggert und Kollegen berechnen nicht, wohin die in der Ostsee gelandeten Granaten im Laufe der Zeit kullern. Sie wollen vielmehr wissen, wohin es sprengstofftypische Schadstoffe wie TNT in welcher Lösung und in welchem Tempo treibt. Dafür füttern sie ihre Rechner mit zahlreichen physikalischen Daten: Strömungsgeschwindigkeit in einem konkreten Ostseegebiet, Wassertemperatur, Geschwindigkeit, mit der sich TNT auflöst.
"Das heißt, wir haben unser Werkzeug fertig. Das ist das physikalische Modell. Das heißt, wir können ganz viele verschiedene Annahmen treffen. Zum Beispiel: Vielleicht liegen da hundert Bomben. Fünf davon sind verrostet und ein Quadratmeter TNT liegt offen. Oder vielleicht liegen da tausend Bomben. Für diese ganzen verschiedenen Szenarien können wir das rechnen. Genauso gut kann es nachher heißen: 'Da ist noch ein ganz anderes Versenkungsgebiet. Wo strömt das hin? In welchen Konzentrationen?' Oder auch noch mal rückwärts gedacht: Wenn irgendwie im Rahmen des Umweltmonitorings später festgestellt wird: 'Hier sind aber auch hohe Konzentrationen' - dass wir dann zurückrechnen können: 'Wo kommen die denn her?'"
Bislang gebe es keine amtlich festgelegten Schwellenwerte als Handreichung dafür, ab welcher Konzentration TNT und seine Abbauprodukte gesundheitsschädlich wirken, sagt der GEOMAR-Meeresbiologe Jens Greinert und traut sich doch diese Entwarnung zu:
"Jeder kann weiter in der Ostsee schwimmen. Ein Schluck Ostseewasser hat, glaube ich, noch keinem geschadet. Die letzten 70 Jahre sind ja nun die Leute nicht mit 'ner TNT-Vergiftung an Land gekommen und haben gesagt: 'Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist!' Das Problem ist aber, dass wir sehen, dass sich die Munition immer weiter auflöst, indem die Metallhülle einfach wegrostet. Und irgendwann werden alle aufgelöst sein. Vielleicht nicht in fünf oder zehn Jahren, aber in zwanzig, dreißig, fünfzig Jahren. Das Problem geht nicht weg. Und wir müssen jetzt einfach wissenschaftlich fundierte Grundlagen haben, auf deren Basis wir sagen können: Die Konzentration wird dann wahrscheinlich so und so hoch sein. Das können wir errechnen mit Modellen und nach bestem Wissen und Gewissen. Dann muss man es aber auch kontrollieren. Und dann kann man eigentlich erst sagen: Gibt es eine Gefahr?"
Denn hinzukommt, dass auch Vögel Muscheln fressen und dass sich das TNT an Mikroplastik-Partikel bindet, die ihrerseits ein zunehmendes Problem in den Meeren darstellen. Algen wiederum könnten das TNT durchaus verstoffwechseln. Doch dabei entstehen Abbaustoffe, die noch giftiger sind als das TNT selbst. Und so geht das wissenschaftliche Umweltmonitoring in einem Verbund der deutschen Küstenländer ebenso weiter wie die Suche und Bergung von Rostbomben in Ost- und Nordsee.






