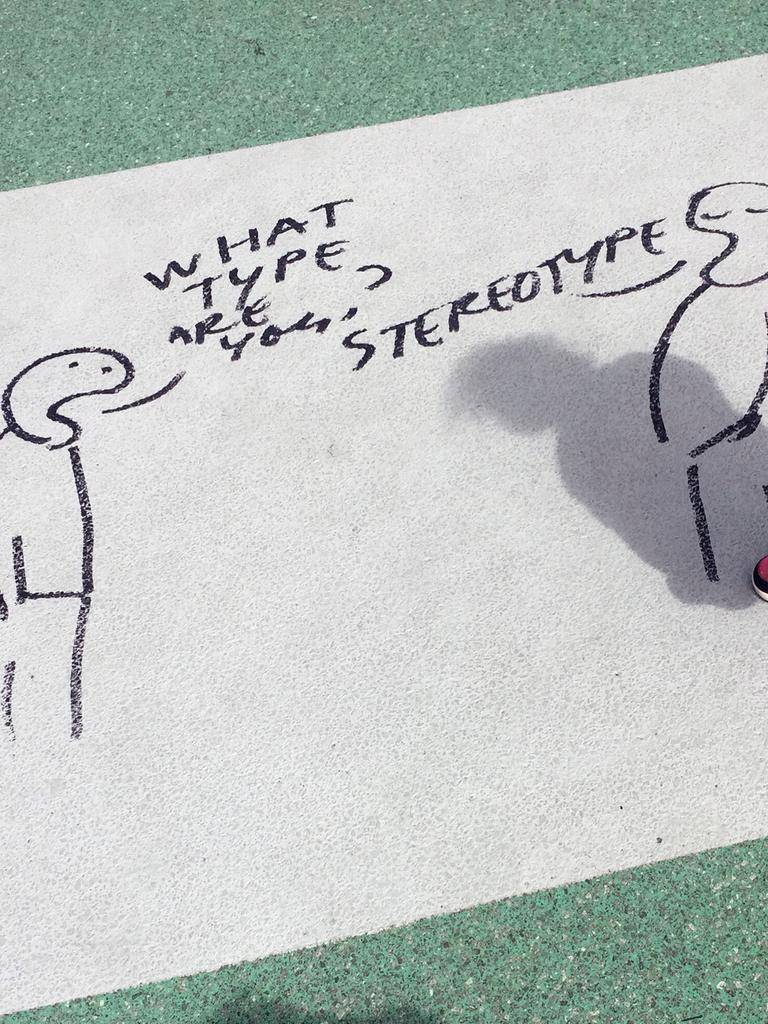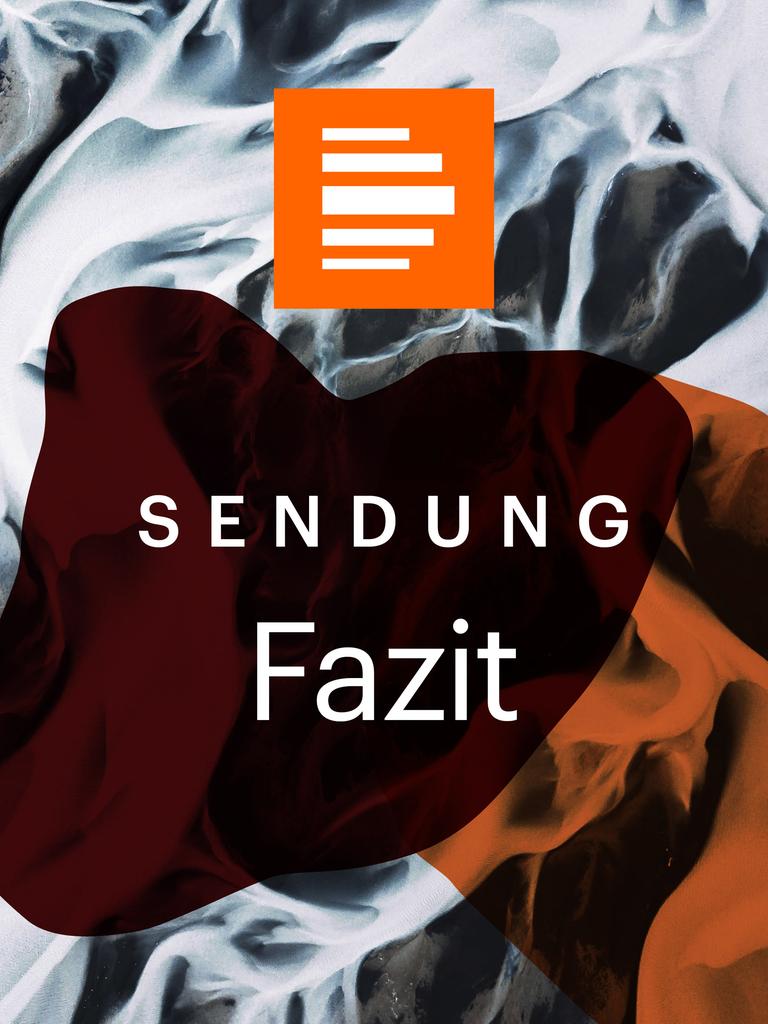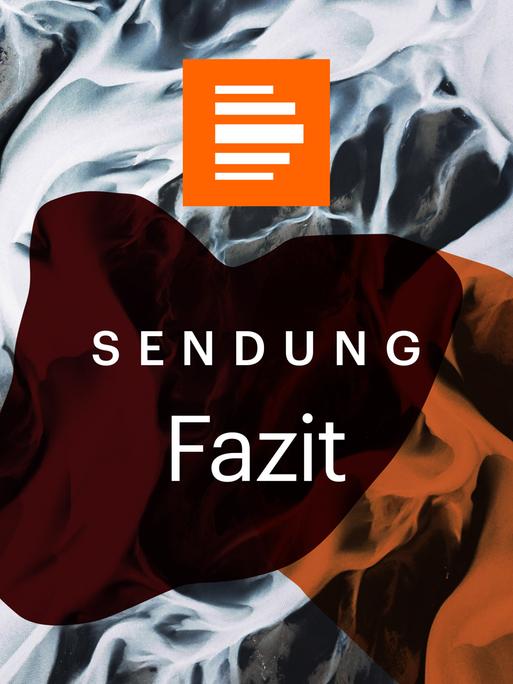Einseitig gegen Israel

Genozid-Vorwurf gegen Israel: US-Regisseur Ben Russell (links) mit Palästinensertuch bei der Berlinale. Sein Film "Direct Action" hatte nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun. © picture alliance / dpa / Reuters / Nadja Wohlleben
Hat die Kulturwelt ein Problem mit Antisemitismus?

Manche Kulturschaffende werfen Israel einen „Genozid“ und „Apartheid“ vor - doch die Verbrechen der Hamas bleiben in Boykottaufrufen unerwähnt. Nicht nur die Berlinale ist mit Debatten über Antisemitismus konfrontiert. Fehlt Empathie aus Ideologie?
Spätestens seit der Documenta 15 läuft eine Debatte über Antisemitismus in der Kultur. Bei Deutschlands wichtigster internationaler Kunstschau waren im Jahr 2022 antisemitische Inhalte zu sehen. Kürzlich fielen nun bei der Berlinale anti-israelische Äußerungen: Filmschaffende bezichtigten Israel eines „Genozids“ in Gaza – erwähnten aber nicht das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das von der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 begangen worden war.
Reden, Petitionen, Störaktionen und Boykotte: Teile der Kunst- und Kulturwelt blicken offenbar stark vereinfacht auf den Nahost-Konflikt. Was steckt dahinter?
Übersicht
- Welche Äußerungen fielen auf der Berlinale?
- Die Berlinale: ein Antisemitismus-Skandal?
- Wie problematisch sind die Begriffe „Genozid“ und „Apartheid“?
- Wie sehen manche Kulturschaffende den Nahostkonflikt?
- Von CTM bis Kunstbiennale: Welche Beispiele für Boykottaufrufe gibt es?
- Wie könnten Kulturinstitutionen und Politik reagieren?
Welche Äußerungen fielen auf der Berlinale?
Bei der Berlinale-Preisgala am 24. Februar 2024 sagte der palästinensische Regisseur Basel Adra: "Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende meines Volkes in Gaza gerade durch Israel abgeschlachtet werden.“
Adra hatte für „No Other Land“ über das Schicksal eines Dorfes im israelisch besetzten Westjordanland den Dokumentarfilmpreis erhalten – gemeinsam mit dem jüdisch-israelischen Regisseur Yuval Abraham. Dieser sagte in seiner Dankesrede: „In zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, wo wir nicht gleich sind. Ich darf mich in dem Land frei bewegen, Basel ist wie Millionen Palästinenser eingeschlossen in der Westbank. Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit muss ein Ende haben.“
Der US-Regisseur Ben Russel warf Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor: "Natürlich sind wir gegen den Genozid. Wir stehen in Solidarität mit all unseren Kameraden."
Auf den Hamas-Terror ging einzig die Co-Chefin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, zu Beginn der Veranstaltung ein - indem sie die Hamas aufforderte, die israelischen Geiseln freizulassen.
Die Berlinale: ein Antisemitismus-Skandal?
Als einseitig israelfeindlich wurde die Abschlussgala der Berlinale vielfach kritisiert, Vertreter von Bundesregierung und Opposition sprachen von Antisemitismus.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte wie der Großteil des Publikums applaudiert, im Nachhinein die Preisverleihung aber als „zum Teil unerträglich“ kritisiert und Aufarbeitung versprochen. Auf "Spiegel Online" sprach sie von einem „ekelhaften offenen Antisemitismus“ bei Linksradikalen. Der Jüdische Weltkongress warf ihr indes Untätigkeit gegen Antisemitismus im Kunstbetrieb vor.
Auch der Historiker Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, kritisierte die „sehr einseitige Veranstaltung“. Es sei „kein einziges Wort der Empathie“ für die rund 1200 Todesopfer der Hamas in Israel oder deren noch über 130 Geiseln gefallen. Er sagte aber auch: „Es war keine antisemitische Veranstaltung. Es wurde nicht 'From the River to the Sea!' gerufen, die Vernichtung des Staates Israel wurde nicht propagiert. Es wurde nicht dezidiert gegen Juden gehetzt.“
Rechtlich sei die Grenze der Meinungsfreiheit erreicht, wenn jemand zu Gewalt aufstachele, sagt der Jurist und Journalist Ronen Steinke: „Dumme, empörende, sonstige Meinungen sind nicht justiziabel, und das ist auch richtig so.“
Wie problematisch sind die Begriffe „Genozid“ und „Apartheid“?
Die Bundesregierung stützt sich auf die IHRA-Definition für Antisemitismus. So wertet der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein den Genozid-Vorwurf gegenüber Israel als antisemitisch: Das Land werde dämonisiert, doppelte Standards angewendet.
Doch die israelische Armee töte nicht Palästinenser, nur weil sie Palästinenser seien, so Klein. Vielmehr verteidige sich Israel nach dem Terrorangriff der Hamas.
Im Gaza-Krieg wurden laut dem Hamas-Gesundheitsministerium bislang mehr als 30.000 Menschen getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Begriffe wie "Apartheid" implizieren, Israel sei ein Aggressor, der die eigene Bevölkerung drangsaliere. Die Komplexität der regionalen Konflikte sowie die Handlungsspielräume und Positionen der Konfliktparteien würden damit ignoriert, so die Amadeu Antonio Stiftung in ihren Informationen zu antisemitischen Codes. Nach Ansicht Hunderter Rechtsexperten stellt der Hamas-Angriff seinerseits „höchstwahrscheinlich“ Völkermord dar.
Der Internationale Gerichtshof verhandelt unterdessen eine Klage Südafrikas gegen Israel wegen angeblichen Völkermords in Gaza. Von Deutschland wird Israel wegen seiner Siedlungs- und Besatzungspolitik kritisiert, die gegen UN-Resolutionen verstößt.
Wie sehen manche Kulturschaffende den Nahostkonflikt?
Dass der anti-israelischen Rhetorik mancher Filmschaffender auf der Berlinale niemand widersprochen hat, ist aus Sicht des Autors Ronen Steinke „leider symptomatisch für eine Atmosphäre in der Kunst- und Kulturwelt“, die öfter „stark vereinfachend auf den Nahost-Konflikt“ blicke.
Demnach werden Israelis als „weiße Kolonialisten“ betrachtet, die die Palästinenserinnen und Palästinenser unterdrückten. Als Lösung des Konflikts gelte der Abzug der „Siedler-Kolonialisten“.
Das sei „ahistorisch“, betont Steinke: „Die Menschen, die in Israel leben, die jüdischen Menschen, sind da nicht hingekommen – oder ihre Vorfahren – um es sich besonders gut gehen zu lassen oder um Bodenschätze auszubeuten oder um ein fremdes Land zu unterjochen.“ Es seien vielmehr Menschen gewesen, die unter anderem vor „grauenhaften Pogromen" in Europa geflohen seien.
Teile der Linken ohne "moralischen Kompass"
Nach Ansicht des Historikers Meron Mendel haben Teile der Linken ihren „moralischen Kompass“ verloren. Mendel bezieht sich etwa auf einen offenen Brief aus der Kulturszene vom 19. Oktober 2023, den unter anderem die Philosophin Judith Butler und die Fotografin Nan Goldin unterzeichnet hatten.
Kurz nach dem Massaker der Hamas warfen sie Israel einen Genozid in Gaza vor, ohne ursprünglich die Opfer der israelischen Seite zu erwähnen. Das sei die "Bankrotterklärung“ einer Ideologie, die sich „völlig unverständlicherweise als links“ verstehe, so Mendel.
Von CTM bis Kunstbiennale: Welche Beispiele für Boykottaufrufe gibt es?
Deutschlandradio-Kulturkorrespondent Vladimir Balzer meint, dass Teile des Kulturbetriebs nicht in der Lage sind zu differenzieren: zwischen der teils rechtsextremen israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu, der vielfältigen israelischen Gesellschaft und dem israelischen Staat.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist ein Boykottaufruf gegenüber Israel auf der Kunstbiennale in Venedig, die am 20. April 2024 beginnt. Die Biennale hat den Aufruf zurückgewiesen.
Eine weitere Boykottkampagne ist "Strike Germany", unter anderem von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux unterzeichnet. Die Kampagne behauptet: Kritik an Israel werde in Deutschland durch Entlassungen und offene Zensur „wirkungsvoll zum Schweigen gebracht“.
Die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment and Sanctions) gibt es schon länger - sie will Israel isolieren und ist ebenfalls sehr umstritten.
Zuletzt gab es auch Forderungen, Israel die Teilnahme am Eurovision Song Contest zu verweigern - was die Organisatoren ablehnten.
Wie könnten Kulturinstitutionen und Politik reagieren?
Bei der staatlichen Kulturförderung wird über "rote Linien" diskutiert: Wie kann die IHRA-Antisemitismusdefinition genutzt werden, um antisemitische Äußerungen im Kulturbetrieb zu vermeiden? Und das, ohne in die Kunst- und Meinungsfreiheit einzugreifen? Berlin musste eine sogenannte Antisemitismusklausel aus rechtlichen Gründen wieder zurücknehmen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth schlägt für Kulturinstitutionen einen „Code of Conduct“ vor.
Ein Verhaltenskodex genüge nicht, wenn Bühnen gekapert würden, sagt Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. „Es muss da schon auch noch ein konziseres Interventions-, Notfall- und auch Präventionskonzept folgen.“ Sie fordert zudem mehr Geld für Fortbildung und Prävention in Bildung und Kultur.
Wenzel selbst war von pro-palästinensischen Aktivisten als „Rassistin“ und „Zionistin“ beschimpft worden. Sie war Gastrednerin einer Performance der kubanischen Künstlerin Tania Bruguera, die das Projekt abbrach. Dabei sollten im Berliner Museum Hamburger Bahnhof 100 Stunden aus Hannah Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ gelesen werden. Arendt war Jüdin und musste 1933 aus Deutschland fliehen.
bth