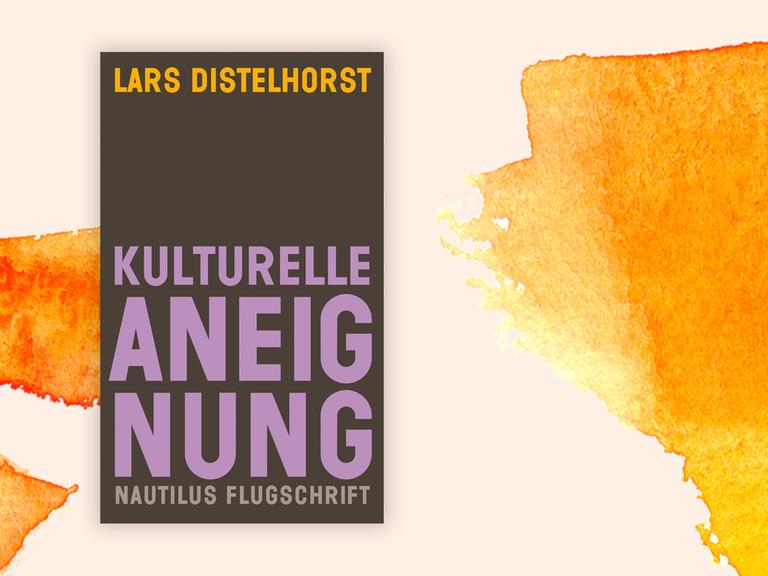Man sieht das gerade sehr, sehr gut an Amerika: Die Repräsentation von indigenen Menschen wird immer mehr. Auch durch Social Media, vorher konnte man sagen, ach, die existieren nicht mehr. Und es gibt auch in der Filmindustrie, der Musikindustrie immer und immer mehr Repräsentation, was auch die jungen indigenen Menschen sehr stolz macht.
Natives in Deutschland

Das US-Roadmovie „Wildhood“ läuft ab Dezember bei uns im Kino. Der Film wurde teilweise in indigener Sprache gedreht. Regisseur Bretten Hannam stammt aus dem Volk der Mi’kmaq. © Edition Salzgeber / Riley Smith
Hinter den Karl-May-Bildern
08:48 Minuten

Die Vorstellungen von Native Americans sind in Deutschland von Karl-May-Büchern geprägt. Dabei verzerrt das Bild von "Winnetou" den Blick auf sie. Aber wie leben Natives in Deutschland? Und welche Erfahrungen machen sie?
Der 16-jährige Link flieht mit seinem Bruder vor dem gewalttätigen Vater und macht sich auf die Suche nach seiner Mutter – einer indigenen Amerikanerin aus dem Volk der Mi’kmaq. Unterwegs treffen sie auf den indigenen Jugendlichen Pasmay, der sie im Auto mitnimmt. Es geht auf eine Reise, die Link nicht nur zu seinen indigenen Wurzeln führt, sondern auch entdecken lässt, dass er ein Two-Spirit ist.
Das amerikanische Roadmovie „Wildhood“ – ab Dezember in den deutschen Kinos zu sehen – wurde teilweise in indigener Sprache gedreht. Der Regisseur Bretten Hannam stammt aus dem Volk der Mi’kmaq.
Identitätskrise und Forschung nach der Herkunft
Auch die 22-jährige Studentin Laura Mendez ist stolz auf ihre indigene Herkunft. Geboren in Kolumbien, wurde sie mit fünf Jahren von einem deutschen Paar adoptiert und kam nach Nordrhein-Westfalen.
Ich bin sehr, sehr deutsch aufgewachsen. Wenn man mich kennt, dann merkt man das auch. Es beschreibt mich, wenn ich sage, ich bin deutsch. Aber ich bin eben auch indigen aus Kolumbien, und das verbindet mich als Person und das macht mich ganz. Und seitdem ich das weiß, habe ich diese Identitätskrise nicht mehr.
Als Kind versuchte Mendez, so deutsch wie möglich auszusehen, hellte ihre Haut auf, in der Schule wurde sie wegen ihres Aussehens gemobbt. Aber mit 16 Jahren begann sie, ihre Herkunft als Native American zu erforschen.
„Meine Adoptiveltern haben immer gesagt, Deine Vorfahren sind indigen, aber da war irgendwann ein Genozid, und mir wurde beigebracht, dass wir schon lange ausgestorben seien. Und weil ich adoptiert worden bin, hat sich das für mich angefühlt, als wäre ich der letzte Überlebende. Als ich dann in die Pubertät gekommen bin, habe ich natürlich die Realität gesehen.“
Und sie lernte über Social Media andere Indigene kennen:
„Ich dachte immer, es ist ganz schwierig, andere indigene Menschen zu finden, und habe ich mich einmal damit befasst, habe ich sehr, sehr schnell verschiedene indigene Menschen kennengelernt, deutschlandweit, aber auch in den Nachbarländern.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Natives
Es gibt vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg viele Indigene in Deutschland, erzählt Mendez. Sie kamen als US-Soldaten hierher. Im Frühjahr hat Laura die Instagram-Gruppe „Natives in Germany“ mitgegründet. Hier tauschen sich junge Indigene über politische und historische Themen, aber auch Filme und Serien mit indigenen Inhalten sowie Musik von indigenen Musikern aus.
In der Gruppe diskutiert man auch die bis heute präsenten Stereotype über Natives. Als im Sommer die Debatte über den Kinofilm „Der junge Häuptling Winnetou“ entbrannte und sich Mendez in einem Instagram-Video kritisch über die Darstellung von Indigenen in dem Film äußerste, erlebte sie einen massiven Shitstorm: „Leute haben wirklich versucht, meine Adresse herauszufinden, weil ich die Person in diesem Video war.“
Für die Mitglieder von ‚Natives in Germany‘ waren diese Angriffe ein Schock, weshalb sich viele im Moment nicht äußern wollen. Wie sehr Winnetou hierzulande mitunter wie ein nationales Kulturgut betrachtet wird, hat auch die in Berlin lebende, indigene Amerikanerin Jarral Boyd überrascht:
Die Geschichte mit Winnetou und Karl May, dass weiße Menschen sich zum Fasching jedes Jahr wie Indianer und dieser Glauben, dass die damit tatsächlich unsere Kultur feiern würden, das ist so verinnerlicht im deutschen Geist.
Die Linguistin und Erzieherin, die Workshops zu Themen wie Empowerment und Antirassismus gibt, ärgert diese Aneignung indigener Kultur, ohne sich für die Realität von Indigenen zu interessieren. Boyd hat eine starke Bindung zu ihren indigenen Wurzeln:
„Es hat immer eine große Rolle gespielt. Unsere Mutter wurde tatsächlich als Baby geklaut und tatsächlich an weiße Menschen, an Deutsche, verkauft. Sie wurde adoptiert und hat dann total ihre Wurzeln verloren. Dadurch war es für unsere Mutter sehr wichtig, dass meine Schwestern und ich unsere Kultur doch mitbekommen haben.“
Romantisierung von Natives in Deutschland
In Deutschland hat sie noch niemand nach ihrer indigenen Herkunft gefragt. Boyd hat das Gefühl, viele Deutsche würden lieber die eigene romantisierte Fantasie von Natives bewahren wollen, als etwas über deren reale Lebenswelt zu erfahren. Aber indigene Kultur lebt Boyd auch in Berlin:
„Meine Beziehung zur Welt ist geprägt von meinen indigenen Wurzeln. Wie ich durch die Welt gehe und wie ich mit der Natur, mit der Umwelt, mit Tieren, mit anderen Menschen umgehe. Wenn ich aufstehe und wenn ich abends einschlafe, es ist immer mit drin.“
Was es bedeutet, indigen zu sein
Das Gefühl, in Deutschland als Indigene wie ein Relikt wahrgenommen zu werden, kennt auch die indigene US-amerikanische Künstlerin Laura Arena, die seit 2009 zwischen Berlin und New York pendelt:
„Was ich wirklich liebe und was für meine Arbeit am wichtigsten ist, ist, zu erforschen, was es bedeutet, indigen zu sein. Meine Erfahrung in Deutschland ist, dass die Vorstellung von Indigenen tief in der Vergangenheit wurzelt.“
Arenas Mutter war die erste in ihrer Familie, die das Stammesgebiet verließ. Sie ging nach New York, wo Arena geboren wurde, aber sie war jeden Sommer zu Besuch im Reservat. In Deutschland erlebte sie einen kuriosen Umgang mit indigener Kultur:
„Ich war in Rostock in einem Restaurant, und als ich dem Barkeeper erzählte, dass ich indigen bin, sagte er: ich auch! Aber er war offensichtlich deutsch. Er zeigte mir Fotos von sich verkleidet als Native American. Er war wirklich überzeugt davon, einer zu sein. Mir hat er keine einzige Frage über mich gestellt.“
Das Thema ist auch eine Generationsfrage
Es ist, sagt Arena, schwer den Leuten hier zu vermitteln, warum es schmerzt, wenn zum Beispiel auf einem Kinderfest ein großes Tipi als Spielzeug aufgebaut ist, während Indigene vielerorts um Sichtbarkeit kämpfen.
In Amerika herrsche gegenüber dem Thema eine große Sensibilität. Hier gibt es die nicht, aber gerade das interessiert Arena:
„Für mich ist das auch ein Ansporn. Hier kann man durch Gespräche etwas an den Einstellungen der Menschen verändern. Die Deutschen lieben alles Indigene. Es ist eine gute Gelegenheit, Anstöße zu geben, neu zu denken, was indigen sein kann.“
Für Studentin Laura Mendez ist das Thema auch eine Generationsfrage. Winnetou-Romantik erlebt sie bei Gleichaltrigen eher nicht:
„Leute in meinem Alter sind da viel weiter, die unterstützen mich auch. Ich habe auch Mitstudierende, die mir sagen, ich find das toll, was Du machst, ich finde das wichtig. Und meine Mitstudierenden geben auch Komplimente. Ich kombiniere gerne traditionellen Schmuck mit ganz normaler Alltagskleidung. Und dann kommt immer so was wie, ach, heute siehst Du aber schön aus, und es ist nicht dieses: Du siehst aus wie Pocahontas. Und ich habe das Gefühl, dass diesen Menschen das auch sehr wichtig ist, andere Menschen zu respektieren, egal welche Nationalität oder welche Dinge anders sind.“