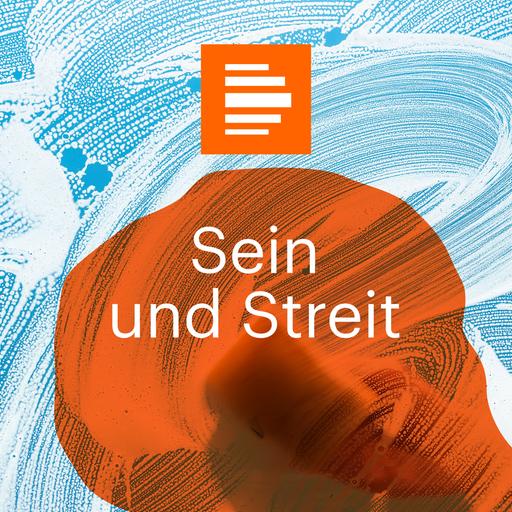Auf deutsch erschien das Buch von Ernest Callenbach 1978 beim Rotbuch Verlag, Berlin, unter dem Titel "Ökotopia. Notizen und Reportagen von William Weston aus dem Jahre 1999". Übersetzt von Ursula Clemeur und Reinhard Merker.
Kürzlich ist eine US-amerikanische Neuausgabe erschienen, die auch die Fortsetzung enthält: "The Complete Ecotopia"
Heyday Verlag, Berkeley 2021
560 Seiten, 28 Dollar
Neuausgabe von "Ökotopia"

Utopische Versöhnung von Ökologie und Hightech: das Eden Project im Süden Englands. © imago / Design Pics Editorial
Inspirierende Vision einer nachhaltigen Gesellschaft
05:51 Minuten

Wie könnte eine umweltgerechte Zukunftsvision aussehen? Der Kalifornier Ernest Callenbach fragte sich das schon vor über 40 Jahren. Sein Buch "Ökotopia" war ein Klassiker der Umweltbewegung. Nun ist es neu erschienen. Was sagt es uns heute?
In einem Interview für eine nie realisierte Fernsehsendung beschrieb Ernest Callenbach im April 1982 die Beweggründe dafür, seinen ökologischen Utopie-Roman "Ökotopia" zu verfassen, der 1975 erschienen war:
"Ich wuchs als Country Boy in der Mitte Pennsylvanias auf und zog als Student nach Chicago und lebte dort in einem der schrecklichsten Slums der westlichen Hemisphäre. Ich habe also beide Seiten kennengelernt, die landwirtschaftliche Vergangenheit unseres Landes und die schreckliche industrielle Gegenwart. Und das hat sich wohl irgendwie in meinem Gehirn festgesetzt, dass wir diese beiden Seiten in neuer Form zusammenbringen müssen. Aber eben im Kontext einer hoch technologisierten und städtischen Gesellschaft. Was 'Ökotopia' wirklich ist, ist der Versuch dieses Stadt-Land-Problem zu lösen, um ökologisch sensibel leben zu können."
Ökologisch, aber nicht technikfeindlich
Callenbach erzählt die Geschichte des Reporters William Weston, der im fiktiven Jahr 1999 als erster US-amerikanischer Journalist in die abgespaltene Nation Ecotopia reisen darf. Seine Notizen und Artikel bilden den Roman. Weston berichtet von einer umweltschonenden Energiewirtschaft, einem nachhaltigen Bauwesen, einer Abkehr von der Wegwerfgesellschaft. Aber auch von einer Gemeinschaft, die nicht technologiefeindlich ist, vielmehr die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Folgen der Technologie voranstellt. Anfangs erscheint der Bericht distanziert, kritisch betrachtet Weston Ökotopia. Doch im Laufe des Buches spürt man seine Faszination für dieses neue Leben in Harmonie.
Für Steve Wasserman, den Herausgeber des Heyday Verlags, bei dem nun "The Complete Ecotopia" erschienen ist, das auch den Nachfolgeband "Ecotopia Rising" aus dem Jahr 1981 umfasst, war Ökotopia vor allem ein Bild seiner Entstehungszeit: "All diese Sorgen der nuklearen Bedrohung, die Spannungen des Kalten Krieges, das wachsende Bewusstsein der zahlreichen Bewegungen der 1960er-Jahre für die Gefahr einer ökologischen Katastrophe, all das entfachte die Fantasie von Ernest Callenbach."
Literarisch zweifelhaft, ökologisch visionär
Steve Wasserman wuchs in Berkeley auf, war als Schüler beim Aufbau des "People’s Park" und bei den Protesten gegen den folgenden Militäraufmarsch in Berkeley dabei. Schon als 20-Jähriger las er zum ersten Mal Ökotopia, Autor Callenbach war ein Freund seiner Eltern.
"Seien wir mal ehrlich, Callenbach war kein guter Schriftsteller", sagt Wasserman. "Es ist mehr ein philosophisches als ein literarisches Buch. Dennoch, seine Zukunftsvision ist fesselnd, und sie stützt sich auf eine ganze Reihe von Betrachtungen, die damals besorgniserregend waren und es heute noch immer sind."
Ernest Callenbach fand 1975 keinen Verlag für sein Buch, deshalb brachte er es anfangs eigenhändig heraus. Seine Leser waren begeistert, gaben es weiter und so wurde "Ökotopia" zu einem Underground-Hit, bis schließlich mit Bantam ein größerer Verlag zugriff und die utopische Geschichte in zahlreiche Sprachen übersetzen ließ. Später gingen die Rechte an Heyday über. In Deutschland wurde das Buch zu einem Klassiker der damals westdeutschen Umweltschutzbewegung. "Dieses Buch hat über seine fast 50 Jahre immer wieder neue Leser gefunden, die jeweils neu darauf reagieren, was auf diesen Seiten zu finden ist", erzählt Wasserman.
Das Frauenbild wirkt heute eher altbacken
Callenbach zeichnete 1975 eine Gesellschaft, die durch ihre ökologische Nachhaltigkeit heute mehr denn je inspirierend wirkt. Es gibt im Rückblick aber auch Kritik an Callenbachs Werk. So wird dem Autor unter anderem ein tradiertes Frauenbild, aber auch ein antiindividualistisches Denken vorgeworfen.
Doch das läßt Steve Wasserman nicht gelten: "Ich verstehe schon, warum Leute das Buch durch die heutige Brille lesen und dabei die Bedenken von heute im Kopf haben. Aber ich denke, damit macht man einen kategorischen Fehler, nämlich, die Geschichte rückwärts zu betrachten. Jeder von uns ist Geisel seiner eigenen Zeit. Das läuft darauf hinaus, von einem literarischen Werk zu verlangen, die moralischen, ästhetischen oder politischen Maßstäbezu erahnen, die viele heute für die richtigen halten. Und es mindert oder verkennt die Leistung eines Autors, der bestimmte Dinge ganz klar erkannt hat."
Bis heute inspirierend – aber will man dort leben?
Die Vision einer nachhaltigen Zukunftsgesellschaft jedenfalls hat über die Jahrzehnte ihre Anziehung und Aktualität nicht verloren. Die Ökologisierung unserer Gesellschaft ist notwendiger denn je geworden.
Dennoch: Ein Leben dort, in diesem Fantasiestaat am Pazifik, kann sich Steve Wasserman nicht vorstellen. "Das ist eine gute Frage, aber: Nein, ich möchte nicht in Ökotopia leben, denn ich mag Städte zu sehr und ich will auch nicht in kollektiver Harmonie mit all den Leuten leben, die dasselbe denken."