Neue alte Werte für die Welt
Drei Mitglieder des Think Tank 30, der Jugendorganisation des Club of Rome, fragen, wie wir heute noch tugendhaft leben können. Ihr Buch will Wissen über gesellschaftspolitische Probleme vermitteln und zum Nachdenken anregen.
Die Tugend hat ein Problem: Sie hat eine schlechte Presse. Von Tugendterror ist die Rede, wann immer Korrektheit, Gutmenschentum oder Regulierungswut angeprangert werden sollen – kurz: wenn über Rauchverbot, Tempolimit oder Energiesparlampen diskutiert wird.
Die Worte "Tugend" und "Terror" zusammenzusetzen, mag dem spitzen Wohlklang des Doppel-T-Tugendterrors geschuldet sein. Sachlich ist diese Wortverbindung wenig sinnvoll, denn "Tugend" hat mit "Terror" nichts gemein. Terror ist keine Tugend. Und begänne Tugend zu terrorisieren, wäre sie schon keine Tugend mehr.
Der Tugend wieder Ansehen zu verschaffen, das haben sich Katharina Diel-Gligor, Wolfgang Gründinger und Ali Aslan Gümüsay vorgenommen. Deshalb edierten die drei Mitglieder des Think Tank 30, der Jugendorganisation des Club of Rome, sieben Texte zu sieben Tugenden – den vier platonischen: Weisheit, Mäßigung, Mut und Gerechtigkeit; sowie den drei christlichen: Hoffnung, Glaube und Liebe.
"7 Tugenden reloaded" begründen die Herausgeber so:
"Wir möchten diskutieren, wo und wie sich Werte und Tugenden bei aktuellen Herausforderungen bewähren können. Denn gerade wegen der Hektik des Alltags, gerade wegen der Zwänge und Nöte des Tagesgeschäfts in Politik und Unternehmen ist ein Wertegerüst umso wichtiger, das Halt und Orientierung bietet in einer sich rasch ändernden Welt."
So weit, so tugendhaft. Ferner heißt es über die Texte, die alle aus der Feder von Think Tank 30-Autoren stammen:
"Mit anschaulichen Beispielen und Kommentaren möchten wir entlang dieser klassischen sieben Tugenden … keinen 'Ratgeber' mit einer moralischen Anleitung auftischen, sondern wichtige gesellschaftspolitische Probleme erläutern, Hintergrundwissen vermitteln und die Leserinnen und Leser mit offenen Fragen zum Nachdenken anregen ..."
Pädagogisches, Anschauliches, Anregendes zum Nachdenken werden also versprochen. Doch der derart vorbereitete Leser wird enttäuscht. Denn eine ganze Reihe von Mängeln erweist über 200 Seiten der Tugend einen Bärendienst.
Es beginnt damit, dass alle Beiträge gleich aufgebaut sind und dieses Schema F nicht wirklich trägt. Die Texte starten mit einer sogenannten "Story": Fiktive Protagonisten stoßen auf ein Problem und eine Tugend, die bei der Lösung behilflich sein soll. Auf diese "Stories" zu Bildungsmisere, Klimawandel oder Finanzkrise folgen fachliche Erörterungen und Tugend-Exkurse, ehe Plädoyers zu diesem oder jenem Sinneswandel aufrufen.
Der Haken der "Stories" ist: Entweder müssen sie als Beleg für alles Mögliche herhalten – oder sie werden fallengelassen und stehen unverbunden den Texten voran. Werden sie überinterpretiert, halten sie davon ab, der Tugend auf den Grund zu gehen; wird auf ihren Gehalt nicht richtig eingegangen, sind sie schlicht fehl am Platze.
Die Worte "Tugend" und "Terror" zusammenzusetzen, mag dem spitzen Wohlklang des Doppel-T-Tugendterrors geschuldet sein. Sachlich ist diese Wortverbindung wenig sinnvoll, denn "Tugend" hat mit "Terror" nichts gemein. Terror ist keine Tugend. Und begänne Tugend zu terrorisieren, wäre sie schon keine Tugend mehr.
Der Tugend wieder Ansehen zu verschaffen, das haben sich Katharina Diel-Gligor, Wolfgang Gründinger und Ali Aslan Gümüsay vorgenommen. Deshalb edierten die drei Mitglieder des Think Tank 30, der Jugendorganisation des Club of Rome, sieben Texte zu sieben Tugenden – den vier platonischen: Weisheit, Mäßigung, Mut und Gerechtigkeit; sowie den drei christlichen: Hoffnung, Glaube und Liebe.
"7 Tugenden reloaded" begründen die Herausgeber so:
"Wir möchten diskutieren, wo und wie sich Werte und Tugenden bei aktuellen Herausforderungen bewähren können. Denn gerade wegen der Hektik des Alltags, gerade wegen der Zwänge und Nöte des Tagesgeschäfts in Politik und Unternehmen ist ein Wertegerüst umso wichtiger, das Halt und Orientierung bietet in einer sich rasch ändernden Welt."
So weit, so tugendhaft. Ferner heißt es über die Texte, die alle aus der Feder von Think Tank 30-Autoren stammen:
"Mit anschaulichen Beispielen und Kommentaren möchten wir entlang dieser klassischen sieben Tugenden … keinen 'Ratgeber' mit einer moralischen Anleitung auftischen, sondern wichtige gesellschaftspolitische Probleme erläutern, Hintergrundwissen vermitteln und die Leserinnen und Leser mit offenen Fragen zum Nachdenken anregen ..."
Pädagogisches, Anschauliches, Anregendes zum Nachdenken werden also versprochen. Doch der derart vorbereitete Leser wird enttäuscht. Denn eine ganze Reihe von Mängeln erweist über 200 Seiten der Tugend einen Bärendienst.
Es beginnt damit, dass alle Beiträge gleich aufgebaut sind und dieses Schema F nicht wirklich trägt. Die Texte starten mit einer sogenannten "Story": Fiktive Protagonisten stoßen auf ein Problem und eine Tugend, die bei der Lösung behilflich sein soll. Auf diese "Stories" zu Bildungsmisere, Klimawandel oder Finanzkrise folgen fachliche Erörterungen und Tugend-Exkurse, ehe Plädoyers zu diesem oder jenem Sinneswandel aufrufen.
Der Haken der "Stories" ist: Entweder müssen sie als Beleg für alles Mögliche herhalten – oder sie werden fallengelassen und stehen unverbunden den Texten voran. Werden sie überinterpretiert, halten sie davon ab, der Tugend auf den Grund zu gehen; wird auf ihren Gehalt nicht richtig eingegangen, sind sie schlicht fehl am Platze.
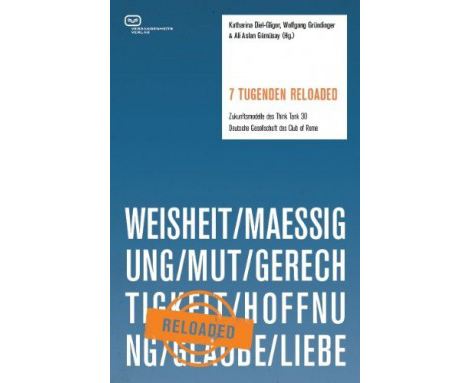
Zukunftsmodelle des Think Tank 30© Vergangenheitsverlag Berlin
Philosophisches Halbwissen und leere Beschwörungen
So erhellend manche Gedanken zu Datensammelwut, Generationenkonflikt oder Kampf der Kulturen auch sein mögen, das Wesen der Tugenden lassen sie im Dunkeln. Und wie! Es ist geradezu ernüchternd, mit welcher Einfältigkeit, mit welcher Mischung aus Anmaßung und Unkenntnis die meisten Tugend-Kommentare daherkommen. Ungeniert rollt eine Besserwisser-Prosa über die antiken Werte her, ohne je den langen Atem zu haben, sie wirklich zu durchdringen.
Überhaupt ähneln die Texte montierten Collagen aus Floskeln und Phrasen, die jeden Tag unzählige Male vom Zeitgeist geraunt werden. Tenor: Man solle keine Sonntagsreden halten; man solle alles kritisch hinterfragen; dafür benötige es Mut; auch der Glaube könne helfen; auf dass man nur ja nicht das Maß verliere – und so weiter.
All diese Beschwörungen sind – und das ist der tragische Punkt – ja nicht einmal falsch; sie sind vielmehr: nichts. Wollte man zu den Tugenden etwas Gehaltvolles mitteilen, ließe sich über sie nur von innen her, aus ihnen heraus sprechen. Anstatt dies zu wagen, verschwinden die Autoren im philosophischen Halbwissen und halten sich so die eigentlichen Fragen vom Leibe. Die Fragen, was sie, was uns die eine oder andere Tugend existenziell angeht.
Das Scheitern, sieben Tugenden zu "reloaden", neuzuladen, macht etwas Grundsätzliches deutlich – und das lässt sich immerhin von diesem Sammelband lernen: Tugend ist heute abstrakt kaum mehr zu beschreiben, jedenfalls nicht ohne Etikettenschwindel. Sie ist nur noch zu fassen, wenn sie am konkreten Einzelfall erläutert wird.
Das wusste zum Beispiel Elias Canetti, als er 1974 in "Der Ohrenzeuge" 50 Charaktere zeichnete, so als hätte es Psychologie und Soziologie nie gegeben: Er förderte in den kurzen Prosastücken etwa "Größenforscher", "Leichenschleicher" und "Schönheitsmoloche" zutage – also Individualitäten, die sich jedem Seelenschema entziehen.
So originell ließe sich auch über Tugenden schreiben. Man müsste, im Sinne Canettis, die Alltagserfahrung durchstöbern, um sie aufzuspüren, ja um gänzlich neue Tugenden zu entdecken, die es mit neuen Worten und neuen Begriffen herauszuarbeiten gilt. Alles andere heißt, einem Geschehen den Tugend-Stempel aufzudrücken, das – wie dieser Sammelband zeigt – besser ohne ihn auskommt.
Überhaupt ähneln die Texte montierten Collagen aus Floskeln und Phrasen, die jeden Tag unzählige Male vom Zeitgeist geraunt werden. Tenor: Man solle keine Sonntagsreden halten; man solle alles kritisch hinterfragen; dafür benötige es Mut; auch der Glaube könne helfen; auf dass man nur ja nicht das Maß verliere – und so weiter.
All diese Beschwörungen sind – und das ist der tragische Punkt – ja nicht einmal falsch; sie sind vielmehr: nichts. Wollte man zu den Tugenden etwas Gehaltvolles mitteilen, ließe sich über sie nur von innen her, aus ihnen heraus sprechen. Anstatt dies zu wagen, verschwinden die Autoren im philosophischen Halbwissen und halten sich so die eigentlichen Fragen vom Leibe. Die Fragen, was sie, was uns die eine oder andere Tugend existenziell angeht.
Das Scheitern, sieben Tugenden zu "reloaden", neuzuladen, macht etwas Grundsätzliches deutlich – und das lässt sich immerhin von diesem Sammelband lernen: Tugend ist heute abstrakt kaum mehr zu beschreiben, jedenfalls nicht ohne Etikettenschwindel. Sie ist nur noch zu fassen, wenn sie am konkreten Einzelfall erläutert wird.
Das wusste zum Beispiel Elias Canetti, als er 1974 in "Der Ohrenzeuge" 50 Charaktere zeichnete, so als hätte es Psychologie und Soziologie nie gegeben: Er förderte in den kurzen Prosastücken etwa "Größenforscher", "Leichenschleicher" und "Schönheitsmoloche" zutage – also Individualitäten, die sich jedem Seelenschema entziehen.
So originell ließe sich auch über Tugenden schreiben. Man müsste, im Sinne Canettis, die Alltagserfahrung durchstöbern, um sie aufzuspüren, ja um gänzlich neue Tugenden zu entdecken, die es mit neuen Worten und neuen Begriffen herauszuarbeiten gilt. Alles andere heißt, einem Geschehen den Tugend-Stempel aufzudrücken, das – wie dieser Sammelband zeigt – besser ohne ihn auskommt.
Katharina Diel-Gligor, Wolfgang Gründinger, Ali Aslan Gümüsay (Hg.): 7 Tugenden reloaded. Zukunftsmodelle des Think Tank 30 / Deutsche Gesellschaft des Club of Rome
Vergangenheitsverlag Berlin, April 2013
200 Seiten, 19,90 Euro
Vergangenheitsverlag Berlin, April 2013
200 Seiten, 19,90 Euro
