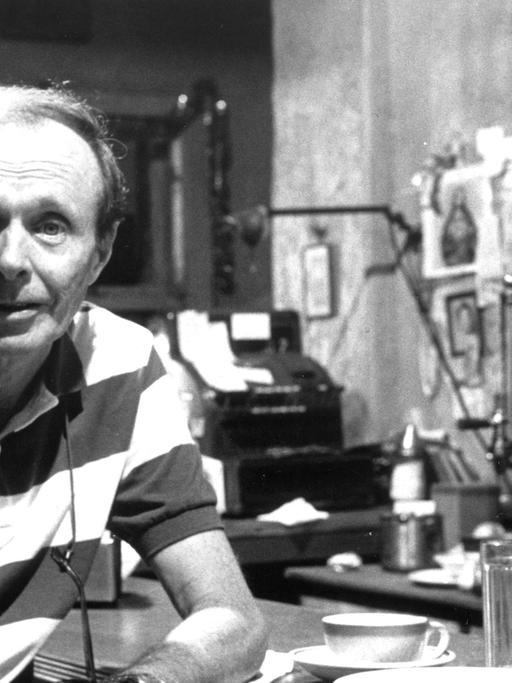Sacha Verna wurde 1973 in Zürich geboren. Seit 2001 lebt sie als freie Kulturkorrespondentin in New York, von wo aus sie für Funk und Presse in Deutschland, der Schweiz und Österreich berichtet.
Der sehnliche Wunsch nach Nähe
04:22 Minuten

Das Coronavirus hat New York schwer getroffen. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, viele Opfer können nur in Massengräbern bestattet werden. Die Journalistin Sacha Verna lebt seit 20 Jahren dort und beschreibt die Stadt im Ausnahmezustand.
Bis vor wenigen Wochen war New York eine Stadt, deren sprichwörtliche Energie sich davon nährte, dass sich 8,5 Millionen Menschen Tag und Nacht aneinander rieben. Buchstäblich: In den vollgepackten Subways, beim Schlangestehen vor dem neusten angesagten Schuppen, in den Waschsalons, wo die New Yorker, sich regelmäßig um die wenigen funktionierenden Maschinen und Trockner stritten.
Das Coronavirus und der damit verbundene Lockdown haben all dem ein Ende gesetzt: überall verbarrikadierte Schaufenster und Restaurants, Sirenengeheul ist das einzige Geräusch in den fast leeren Avenues.
Noch vor kurzem war New York eine Stadt, in der jederzeit alles zu kriegen war: Eine Pedicure um drei Uhr morgens, hawaiische Cocktails zum Frühstück, Stand-up-Comedy und roher Keksteig als Kombiangebot am frühen Abend. Jetzt macht man sich keine Gedanken mehr darüber, was man möchte. Man hat Angst, im Notfall nicht das zu bekommen, was man zum Überleben braucht.
Wird für mich ein Bett in einem der überfüllten Krankenhäuser frei sein, sollte mir etwas zustoßen? Oder bringt man mich in einem der Zelte unter, die im Central Park aufgestellt wurden? Wobei das immer noch besser ist, als zusammen mit anderen Leichen in einem der weißen Kühlwagen zu landen, die neben den Krankenhäusern stehen. Ganz zu schweigen von Hart Island, einer Insel im Nordosten der Bronx, wo Massengräber für die Toten ohne Angehörige ausgehoben werden.
Blühen des Schwarzmarktes
Der Frühling ist eine der schönsten Jahreszeiten in New York. Wer Glück und ein Fenster in seiner schuhschachtelgroßen Wohnung hat, das nicht auf einen Luftschacht geht, kann vielleicht ein paar Magnolien und Ginko-Bäume beim Erblühen beobachten.
Doch das einzige Blühen, das die Leute im Moment interessiert, ist das des Schwarzmarktes. Die Bagel-Bäckerei, die als Lebensmittelgeschäft noch geöffnet haben darf, verkauft unter der Hand Toilettenpapier. So der Tipp einer Nachbarin. Die Schreibwarenhandlung, die auch Postdienste versieht und deshalb ebenfalls offen ist, soll noch über Gesichtsmasken verfügen. Sechs Dollar das Stück. Wer sich unvermummt hinauswagt, gibt sich als Verräter im Kampf gegen die Seuche zu erkennen.
Das Einkaufen ist zur Tagesexpedition geworden. Man wartet stundenlang auf Einlass in den Supermarkt – immer unter der Aufsicht von Polizisten, die bei blinkendem Blaulicht in ihren Wagen sitzen, um dafür zu sorgen, dass die Wartenden die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand zueinander wahren. Für die Staatsgewalt scheint diese Regel allerdings nicht zu gelten. In Gruppen vertreten sich die Officers die Beine und lachen über Witze, die sonst niemand mitbekommt.
Die Supermärkte haben Plastiktüten wieder eingeführt, obwohl sie eigentlich verboten wurden. Denn die mitgebrachten Schleppnetze fassen längst nicht mehr die Hamsterkäufe.
Wer wird überleben?
New York wird das Coronavirus überleben. Natürlich. Aber gilt das auch für Jerry, der jeden Morgen im Rollstuhl an seiner Ecke saß und darauf wartete, dass ihm jemand einen Kaffee spendierte? Für Amir, der den Foodtruck mit dem Halal-Menü gegenüber der nun geschlossenen Moschee an der 11. Straße betrieb?
Nach 9/11 umarmten sich in dieser Stadt Wildfremde, um sich gegenseitig zu trösten. Während der legendären Stromausfälle tanzten die New Yorker zusammen auf dem Broadway. Nach dem Supersturm Sandy halfen sie einander beim Auspumpen der überfluteten Keller.
Doch in dieser Krise ist ihnen das genommen, was bisher den Charakter dieser Stadt ausgemacht hat: die Nähe ihrer Bewohner zueinander. Diese Nähe ist manchmal amüsant, oft nervtötend, immer unvermeidlich. Man wünscht sie sich sehnlicher zurück als alles andere.