Nicht auf den Mund gefallen
Im Buch von Kai Schlüter werden ausgewählte Stasi-Dokumente zu Günter Grass veröffentlicht. Die Spitzel zeichneten das Bild eines selbstgefälligen Schriftstellers, der sich weder in der Bundesrepublik noch in der DDR das offene Wort verbieten ließ.
Vor knapp zehn Jahren erbat ein Doktorand bei Günter Grass die Erlaubnis, dessen Stasi-Akte einzusehen. Grass lehnte ab. Warum, war damals dem Doktoranden und seinen Betreuern nicht ersichtlich. Hatte Grass von der Offenlegung etwas zu befürchten? Stufte die Stasi ihn etwa als DDR-freundlich und nützlichen Idioten ein, der sich vehement für die Anerkennung der DDR einsetzte? Nach dem Erscheinen des Buches von Kai Schlüter deutet vieles darauf hin, dass Grass sich seinerzeit weigerte, weil er keine Ahnung hatte, was ihn nach Akteneinsicht erwarten würde. Schließlich wusste er ja nicht, was die Stasi alles über ihn gesammelt hatte. War zum Beispiel seine jahrzehntelang verschwiegene Mitgliedschaft in der Waffen-SS der Stasi bekannt? Nein, das war sie nicht, wie der Blick in die nun schon mehrere Jahre zugänglichen Unterlagen zeigt.
Im Buch von Kai Schlüter werden ausgewählte Stasi-Dokumente zu Grass veröffentlicht und von Beteiligten, insbesondere von Grass selber, kommentiert. Der wortgewaltige Schriftsteller erhält also die Möglichkeit, "Fehlinterpretationen" der Stasi-Niederschriften in seinem Sinne zu korrigieren. Das mag bei bestimmten Dokumenten aus seiner Sicht notwendig gewesen sein, ändert aber insgesamt nichts an dem Bild, das die Stasi-Spitzel von Grass zeichneten: ein selbstgefälliger Schriftsteller, der sich weder in der Bundesrepublik noch in der DDR das offene Wort verbieten ließ.
Erstmals erweckte Grass das Interesse der Stasi im Mai 1961. Als Gastredner forderte er auf dem 5. Kongress des DDR-Schriftstellerverbandes:
"Geben Sie den Schriftstellern die Freiheit des Wortes! Geben Sie einem Enzensberger in Ihrem Land die Freiheit, die er noch in Westdeutschland hat, obgleich diese Freiheit des Wortes gefährdet ist. Hier ist sie aber gar nicht vorhanden."
Nach dem Bau der Mauer im August legte Grass nach und forderte ostdeutsche Schriftstellerkollegen, darunter Anna Seghers, auf, gegen die Selbst-Einbetonierung des SED-Staates zu protestieren. Diese schwiegen oder lehnten das Ansinnen ab. Daraufhin begann die Stasi mit der Observierung von Grass und bediente sich hierbei prominenter Spitzel, unter ihnen Hermann Kant, Manfred Wekwerth und Karlheinz Schädlich.
Hermann Kant, der bis heute bestreitet, bewusst ein Stasi-Spitzel gewesen zu sein, urteilte über seinen West-Berliner Schriftstellerkollegen:
"Grass ist ein Mensch ohne jede feste politische Einstellung und Haltung. Er schießt praktisch nach beiden Seiten und kommt sich dabei sehr imposant vor. Er möchte immer als ein Freiheitsapostel erscheinen. Er tritt gelegentlich auch in derselben Form wie bei uns gegen Adenauer auf, während er Tage später wieder vollkommen auf dessen Linie einschwenkt."
Die Mehrzahl der sogenannten Treffberichte, in denen über Gespräche und Lesungen von Grass und ostdeutschen Literaten berichtet wird, ist vergleichsweise banal, in fürchterlichem Funktionärsdeutsch geschrieben und liefert ein anschauliches Bild vom intellektuellen Tiefgang der Stasi-IM. Sie schätzten zudem die Intentionen und das Verhalten von Grass gegenüber der DDR und ihren Oppositionellen falsch ein.
Bei gelegentlichen Treffen mit Bürgern der DDR äußerte Grass auch Kritik an der Bundesrepublik und an dem von ihm verehrten Willy Brandt, der für den Radikalenerlass zur Bekämpfung linker und rechter Extremisten verantwortlich zeichne. Er sparte nicht mit Ratschlägen für Brandt, wie das bundesdeutsche System Richtung demokratischer Sozialismus verändert werden müsste. Brandt reagierte auf einen längeren Brief mit der Notiz: "Dieser oberlehrerhafte Klugscheißer."
Den Sozialismus im SED-Staat sah Grass in Gefahr. Die Einrichtung von Intershop-Läden und die Einfuhr von Volvos und Golf wertete er laut MfS-Dokumenten als "Kapitulation des Sozialismus vor seinem Todfeind, dem Kapitalismus". Gleichzeitig ließ er Ende der 70er-Jahre jedoch laut Spitzelberichten keinen Zweifel, dass er die BRD für das bessere System halte.
Als Grass Anfang der 80er-Jahre in Ost-Berlin seine Sympathie für die Entwicklung in Polen äußerte, wo die Solidarnocz das kommunistische Machtmonopol in Frage stellte, erteilte ihm die Stasi Einreiseverbot. Mehrere Teilnehmer des Treffens wurden verhaftet, darunter Lutz Rathenow, dem vorgeworfen wurde, politische Untergrundtätigkeit zu organisieren. Das Verbot wurde jedoch immer wieder aufgehoben, wenn die SED Interesse am Disput ihrer Getreuen mit Grass sah - so etwa bei der Berliner Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981, wo Grass, anders als seine Gastgeber erwartet hatten, die Aufrüstung in Ost und West gleichermaßen kritisierte. Trotz seiner Äußerungen gewann Grass offenbar das Vertrauen der SED-Funktionäre, denn ab Mitte der 80er-Jahre erschienen mehrere seiner Schriften in der DDR und er durfte sogar auf Lesereise gehen. Die Spitzel berichteten über großes Interesse an den Lesungen:
"Die von Grass vorgetragenen Auszüge aus den genannten Werken lösten insgesamt beim Publikum nur wenig Resonanz aus. Die Lesungen wurden lediglich zur Kenntnis genommen und mit Beifall bedacht, welcher nicht dem Inhalt, sondern dem Autor galt. Es kann eingeschätzt werden, dass keine provokatorischen Fragen gestellt wurden. Die Veranstaltungen verliefen diszipliniert und ohne Vorkommnisse. Die Veranstaltungen beeinträchtigten nicht die öffentliche Ordnung und Sicherheit."
Im letzten abgedruckten Stasi-Dokument vom Juli 1989 lobte Grass vor allem seine Sympathisanten in der DDR.
"Für sich ganz persönlich als Schriftsteller habe er erneut bestätigt bekommen, dass das DDR-Publikum belesener, sachkundiger und wesentlich interessierter ist, als beispielsweise das Publikum in der BRD, welches arrogant und oft feindselig reagiert."
Schlüters Buch bringt keine neuen Erkenntnisse und krankt vor allem daran, dass weder die Beurteilung des MfS durch Grass in seinem Roman "Ein weites Feld" noch der Umgang der DDR-Staatspartei mit ihm berücksichtigt werden. Vor allem der Sinneswandel der SED in der Einschätzung des Schriftstellers, der zur Veröffentlichung mehrerer seiner Bücher in der DDR führte, wird nicht erklärt. War Grass als radikalisierter Kritiker der Bundesrepublik während der Kohl-Ära für sie ein Bündnispartner, dem man auch moderate Kritik an den DDR-Verhältnissen durchgehen ließ? Solche und andere wichtige Fragen werden in diesem Buch nicht beantwortet.
Kai Schlüter: Günter Grass im Visier. Die Stasi-Akte
Aufbau Verlag, Berlin 2010
Im Buch von Kai Schlüter werden ausgewählte Stasi-Dokumente zu Grass veröffentlicht und von Beteiligten, insbesondere von Grass selber, kommentiert. Der wortgewaltige Schriftsteller erhält also die Möglichkeit, "Fehlinterpretationen" der Stasi-Niederschriften in seinem Sinne zu korrigieren. Das mag bei bestimmten Dokumenten aus seiner Sicht notwendig gewesen sein, ändert aber insgesamt nichts an dem Bild, das die Stasi-Spitzel von Grass zeichneten: ein selbstgefälliger Schriftsteller, der sich weder in der Bundesrepublik noch in der DDR das offene Wort verbieten ließ.
Erstmals erweckte Grass das Interesse der Stasi im Mai 1961. Als Gastredner forderte er auf dem 5. Kongress des DDR-Schriftstellerverbandes:
"Geben Sie den Schriftstellern die Freiheit des Wortes! Geben Sie einem Enzensberger in Ihrem Land die Freiheit, die er noch in Westdeutschland hat, obgleich diese Freiheit des Wortes gefährdet ist. Hier ist sie aber gar nicht vorhanden."
Nach dem Bau der Mauer im August legte Grass nach und forderte ostdeutsche Schriftstellerkollegen, darunter Anna Seghers, auf, gegen die Selbst-Einbetonierung des SED-Staates zu protestieren. Diese schwiegen oder lehnten das Ansinnen ab. Daraufhin begann die Stasi mit der Observierung von Grass und bediente sich hierbei prominenter Spitzel, unter ihnen Hermann Kant, Manfred Wekwerth und Karlheinz Schädlich.
Hermann Kant, der bis heute bestreitet, bewusst ein Stasi-Spitzel gewesen zu sein, urteilte über seinen West-Berliner Schriftstellerkollegen:
"Grass ist ein Mensch ohne jede feste politische Einstellung und Haltung. Er schießt praktisch nach beiden Seiten und kommt sich dabei sehr imposant vor. Er möchte immer als ein Freiheitsapostel erscheinen. Er tritt gelegentlich auch in derselben Form wie bei uns gegen Adenauer auf, während er Tage später wieder vollkommen auf dessen Linie einschwenkt."
Die Mehrzahl der sogenannten Treffberichte, in denen über Gespräche und Lesungen von Grass und ostdeutschen Literaten berichtet wird, ist vergleichsweise banal, in fürchterlichem Funktionärsdeutsch geschrieben und liefert ein anschauliches Bild vom intellektuellen Tiefgang der Stasi-IM. Sie schätzten zudem die Intentionen und das Verhalten von Grass gegenüber der DDR und ihren Oppositionellen falsch ein.
Bei gelegentlichen Treffen mit Bürgern der DDR äußerte Grass auch Kritik an der Bundesrepublik und an dem von ihm verehrten Willy Brandt, der für den Radikalenerlass zur Bekämpfung linker und rechter Extremisten verantwortlich zeichne. Er sparte nicht mit Ratschlägen für Brandt, wie das bundesdeutsche System Richtung demokratischer Sozialismus verändert werden müsste. Brandt reagierte auf einen längeren Brief mit der Notiz: "Dieser oberlehrerhafte Klugscheißer."
Den Sozialismus im SED-Staat sah Grass in Gefahr. Die Einrichtung von Intershop-Läden und die Einfuhr von Volvos und Golf wertete er laut MfS-Dokumenten als "Kapitulation des Sozialismus vor seinem Todfeind, dem Kapitalismus". Gleichzeitig ließ er Ende der 70er-Jahre jedoch laut Spitzelberichten keinen Zweifel, dass er die BRD für das bessere System halte.
Als Grass Anfang der 80er-Jahre in Ost-Berlin seine Sympathie für die Entwicklung in Polen äußerte, wo die Solidarnocz das kommunistische Machtmonopol in Frage stellte, erteilte ihm die Stasi Einreiseverbot. Mehrere Teilnehmer des Treffens wurden verhaftet, darunter Lutz Rathenow, dem vorgeworfen wurde, politische Untergrundtätigkeit zu organisieren. Das Verbot wurde jedoch immer wieder aufgehoben, wenn die SED Interesse am Disput ihrer Getreuen mit Grass sah - so etwa bei der Berliner Begegnung zur Friedensförderung im Dezember 1981, wo Grass, anders als seine Gastgeber erwartet hatten, die Aufrüstung in Ost und West gleichermaßen kritisierte. Trotz seiner Äußerungen gewann Grass offenbar das Vertrauen der SED-Funktionäre, denn ab Mitte der 80er-Jahre erschienen mehrere seiner Schriften in der DDR und er durfte sogar auf Lesereise gehen. Die Spitzel berichteten über großes Interesse an den Lesungen:
"Die von Grass vorgetragenen Auszüge aus den genannten Werken lösten insgesamt beim Publikum nur wenig Resonanz aus. Die Lesungen wurden lediglich zur Kenntnis genommen und mit Beifall bedacht, welcher nicht dem Inhalt, sondern dem Autor galt. Es kann eingeschätzt werden, dass keine provokatorischen Fragen gestellt wurden. Die Veranstaltungen verliefen diszipliniert und ohne Vorkommnisse. Die Veranstaltungen beeinträchtigten nicht die öffentliche Ordnung und Sicherheit."
Im letzten abgedruckten Stasi-Dokument vom Juli 1989 lobte Grass vor allem seine Sympathisanten in der DDR.
"Für sich ganz persönlich als Schriftsteller habe er erneut bestätigt bekommen, dass das DDR-Publikum belesener, sachkundiger und wesentlich interessierter ist, als beispielsweise das Publikum in der BRD, welches arrogant und oft feindselig reagiert."
Schlüters Buch bringt keine neuen Erkenntnisse und krankt vor allem daran, dass weder die Beurteilung des MfS durch Grass in seinem Roman "Ein weites Feld" noch der Umgang der DDR-Staatspartei mit ihm berücksichtigt werden. Vor allem der Sinneswandel der SED in der Einschätzung des Schriftstellers, der zur Veröffentlichung mehrerer seiner Bücher in der DDR führte, wird nicht erklärt. War Grass als radikalisierter Kritiker der Bundesrepublik während der Kohl-Ära für sie ein Bündnispartner, dem man auch moderate Kritik an den DDR-Verhältnissen durchgehen ließ? Solche und andere wichtige Fragen werden in diesem Buch nicht beantwortet.
Kai Schlüter: Günter Grass im Visier. Die Stasi-Akte
Aufbau Verlag, Berlin 2010
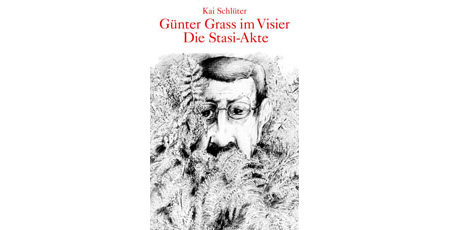
Cover: "Günter Grass im Visier. Die Stasi-Akte."© Aufbau Verlag
