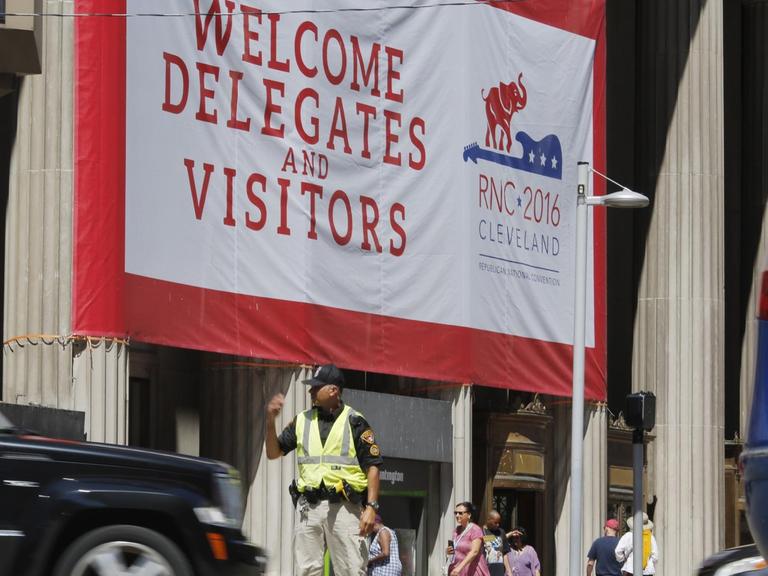Hat sich der Rassismus in den USA verändert?

Der Enthusiasmus afroamerikanischer Wähler für Barack Obama vor acht Jahren war groß. Doch Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze prägen das Land weiter. Der Historiker Sebastian Jobs zieht eine gemischte Bilanz der Regierungszeit des ersten schwarzen US-Präsidenten.
Am 8. November wird ein neuer US-Präsident oder zum ersten Mal eine Präsidentin gewählt. Vor acht Jahren begeisterte Barack Obama die Amerikaner mit seinem Versprechen von "Hope and Change", Hoffnung und Wandel. Der erste afroamerikanische US-Präsident wollte ein Versöhner sein, der die Rassenspannungen im Land mildert. Stattdessen haben sich diese Konflikte dramatisch verschärft. Tödliche Polizei-Einsätze gegen Schwarze lösten immer wieder wütende Proteste aus.
Rassistische Vorurteile sind sichtbarer und sagbarer geworden, sagt der Historiker und USA-Experte Sebastian Jobs. Der Professor für die Geschichte Nordamerikas zieht eine gemischte Bilanz der Amtszeit Barack Obamas.
Obamas eigene Einschätzung, die Lebensumstände schwarzer Amerikaner hätten sich sehr wohl verbessert, habe dieser mit Blick auf die eigene Lebenszeit gezogen. Seit den 1960er-Jahren habe sich die Lage der Afroamerikaner natürlich gravierend verbessert, erklärte der Juniorprofessor für die Geschichte Nordamerikas am John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin: "Es gibt eine Gesetzgebung, die ihnen das Wahlrecht zusichert, aber gleichzeitig gibt es natürlich rassistisch motivierte Gewalt und Alltagsdiskriminierung."
Rassismus ist sichtbarer und sagbarer geworden
Die Lebenssituation schwarzer Amerikaner sei geprägt durch Erfahrungen mit rassistisch geprägter Gewalt, überproportionalen Polizeikontrollen sowie durch Chancenungleichheit etwa beim sozialen Aufstieg oder bei der Kreditvergabe. In der achtjährigen Amtszeit Obamas seien zwei gegenläufige Bewegungen auszumachen: Mit dem Einzug einer schwarzen Familie ins Weiße Haus sei einerseits erstmals eine große öffentliche Debatte über die Rassenproblematik und die unterschiedlichen Lebensverhältnisse und Erfahrungen schwarzer Amerikaner entstanden. Mit der Bewegung "Black-Lives- Matter" etwa seien die Stimmen von Minderheiten hörbarer geworden: "Dort werden Erfahrungen von alltäglicher Diskriminierung sichtbar, die für Weiße gar nicht vorstellbar oder denkbar sind, und finden eine Öffentlichkeit."

Die Bewegung "Black lives matter" fordert die Gerechtigkeit und ein Ende der Vorurteile gegenüber Schwarzen fordert. Sie entstand, nachdem in Ferguson der afroamerikanische Schüler Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen wurde.© AFP / Kena Betancur
Rassistische Vorurteile werden lauter ausgesprochen
Verbunden mit Obamas Präsidentschaft habe sich aber zugleich auch eine größere "Sichtbarkeit und Sagbarkeit rassistischer Vorurteile" entwickelt. Dies sei bereits beim öffentlich geäußerten Zweifel an der amerikanischen Staatsbürgerschaft des ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus zum Ausdruck gekommen. "Donald Trump ist Sprachrohr und gleichzeitig auch Akteur in der Sagbarkeit rassistischer Vorurteile," sagte Jobs.
Insgesamt fänden sich in den Wahlprogrammen und im Wahlkampf substanzielle Forderungen nach Minderheitenrechten und die Debatte um Polizeigewalt kaum wieder, bedauerte Jobs. Dies spiele offenbar angesichts der Debatten über Clintons E-Mails oder Trumps Sexismus kaum eine Rolle.
"Aber es ist überhaupt keine Frage, die Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ist und bleibt ein historisches Ereignis," bilanzierte der US-Experte.
Das Interview im Wortlaut:
Ute Welty: Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen in dieser Woche im Zentrum der Überlegungen und der Beobachtungen hier in Deutschlandradio Kultur: die USA und die Träume, die USA und das Internet, die USA und der Populismus. All diese Themen haben wir schon aufgegriffen, finden Sie auch gesammelt auf deutschlandradiokultur.de/usa, und jetzt schauen wir auf die Schwarzen in den USA – acht Jahre, nachdem der erste schwarze Präsident der USA ins Weiße Haus eingezogen ist, acht Jahre nach Barack Obama –, und deswegen haben wir uns mit Sebastian Jobs verabredet, Professor am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien. Guten Morgen, Herr Jobs!
Sebastian Jobs: Guten Morgen, Frau Welty!
Welty: Obama selbst zieht völlig überraschend eine positive Bilanz, den Schwarzen gehe es dramatisch besser. Angesichts der vielen Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze klingt das fast zynisch.
Jobs: Würde ich gar nicht sagen, weil wenn man dieses Statement von Barack Obama, was er ja im Podcast WTF gesagt hat im letzten Jahr, nimmt, dann kommt es natürlich auf den Bezugspunkt an. Barack Obama sagt in diesem Interview, dass es ihm darum geht, dass sich die Lage von Afroamerikanern während seiner Lebenszeit wesentlich verbessert hat, und wenn eben seine Lebenszeit – geboren in den 60er-Jahren – der Bezugspunkt die 60er-Jahre sind, dann sag ich, na klar, die Lage von Afroamerikanern hat sich verbessert. Es gibt eine Gesetzgebung, die ihnen das Wahlrecht zusichert, gleichzeitig gibt es natürlich – Sie haben es schon angesprochen – rassistisch motivierte Gewalt, es gibt Alltagsdiskriminierung und die Debatte über Polizeigewalt ist ja auch in Deutschland sehr angekommen und sehr präsent.
Welty: Wenn wir von der Lebenszeit mal abrücken, welchen Anteil hat denn die Amtszeit von Barack Obama, denn er selber hat seine Hautfarbe ja wenig bis gar nicht zum Thema gemacht?
Die Präsenz einer schwarzen Familie im Weißen Haus
Jobs: Ja, das stimmt, da muss ein schwarzer Präsident einen gewissen Balanceakt vollführen, aber es ist überhaupt gar keine Frage, die Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ist und bleibt ein historisches Ereignis. Was aber gleichzeitig wichtig ist, ist zu sehen, dass mit der Präsenz einer schwarzen Familie im Weißen Haus eine öffentliche Debatte über Race, wie es auf Englisch heißt, einhergeht, nicht zuletzt über soziale Medien. Und die geht meiner Wahrnehmung nach her in zwei Richtungen: Zum einen geht es in dieser Debatte die Stimmen von Minderheiten, die hörbarer geworden sind. Da gibt es prominent natürlich die Black-Lives-Matter-Bewegung, und dort werden Erfahrungen von alltäglicher Diskriminierung, die für Weiße eben gar nicht vorstellbar sind oder denkbar sind, die werden dort sichtbar und finden dort eine Öffentlichkeit. Und die finden sich aber zum Beispiel gar nicht so sehr wieder, diese Menschen, diese Stimmen von Minderheiten in den Parteiprogrammen, nicht zuletzt der beiden Spitzenkandidaten für das Präsidentschaftsamt. Das ist die eine Entwicklung, die ich sehe innerhalb dieser Debatte über Race. Zum anderen gibt es eine größere Sichtbarkeit und Sagbarkeit eben rassistischer Vorurteile, was sich daran zeigt im öffentlichen Sprechen eben über Barack Obamas Hautfarbe. Hier in Deutschland kommt das vielleicht gar nicht so an, aber es wird selbst seine Staatsbürgerschaft, über seine Geburt, vermeintliche Geburt in Kenia oder außerhalb der USA infrage gestellt, und natürlich auch im derzeitigen Wahlkampf werden von Donald Trump – er ist Sprachrohr und gleichzeitig auch Akteur in der Sagbarkeit rassistischer Vorurteile. Also ich sehe diese zwei Bewegungen, die damit einhergehen, seit Barack Obama im Weißen Haus ist.
Welty: Wenn das Thema Rassismus immer noch eine Rolle spielt, welchen Anteil hat Hautfarbe, wenn es um die Karriere eines Menschen geht? Obama ist ja ein Beispiel für die Karriere eines Schwarzen, aber wie sehr ist der soziale Status in den USA nach wie vor eben eine Frage von Weiß oder Schwarz?
Erfahrungen von Vorurteilen, Alltagsrassismus und Gewalt
Jobs: Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil es gerade für Afroamerikaner, aber auch für andere ethnische Minderheiten eine Art von Alltagsdiskriminierung gibt, wo sie gar nicht an diesem mythischen amerikanischen Traum teilnehmen können. Der amerikanische Traum ist ja, dass wenn man sich nur anstrengt, wenn man hart arbeitet, kann man Karriere machen. Und gleichzeitig ist es die Erfahrung von Afroamerikanern, dass sie aber von der Polizei überproportional oft angehalten werden, wenn sie im Fahrzeug unterwegs sind, wenn sie im Auto unterwegs sind. Sie haben wesentlich geringere Chancen zum Beispiel, wenn sie sich bewerben auf Karrierejobs, wesentlich geringere Chancen, Bankenkredite zu bekommen, und nicht zuletzt spitzt sich das natürlich in so was zu wie eben in rassistisch motivierter Gewalt. Letztes Jahr haben wir das gesehen, 2015 in Charleston, als ein Jugendlicher in einer Kirche in South Carolina neun afroamerikanische Gemeindemitglieder getötet hat. Also das sind Erfahrungen, die spezifisch sind für ethnische Minderheiten und gerade eben für Afroamerikaner, die sie dann doch unterscheiden von den Erfahrungen einer Mehrheitsgesellschaft, einer weißen.
Welty: Wenn Sie diese Art von Bilanz ziehen, was bedeutet das dann für die letzten Tage des Wahlkampfs für die Kandidaten und Clinton und Trump?
Jobs: Ich glaube, wir haben gesehen, dass dieser Wahlkampf voller Überraschungen ist …
Welty: Nicht zuletzt heute.
Jobs: … und dass es unglücklicherweise wenig um solche substanziellen Fragen geht, sondern es geht eben … Obwohl, die Sexismusdebatte, die um Donald Trumps Äußerungen entbrannt ist, das ist eine wichtige und substanzielle Debatte, aber es ist interessant, dass diese Debatten über E-Mails, über Sexismus, die Minderheitenrechte und die Lage von Minderheiten und Black Lives Matter, solche Sachen zum Beispiel eben überschattet und die fast überhaupt nicht vorkommen – das finde ich sehr, sehr schade.
Welty: Der Historiker Sebastian Jobs über Schwarz und Weiß in Amerika nach Obama. Ich danke sehr für Ihre Einschätzung!
Jobs: Gern!
Welty: Einschätzungen, Meinungen, Analyse – all das finden Sie auf deutschlandradiokultur.de/die-usa-am-scheideweg. Zum Beispiel auch, was die Social Bots angeht und das Prinzip Hoffnung.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.