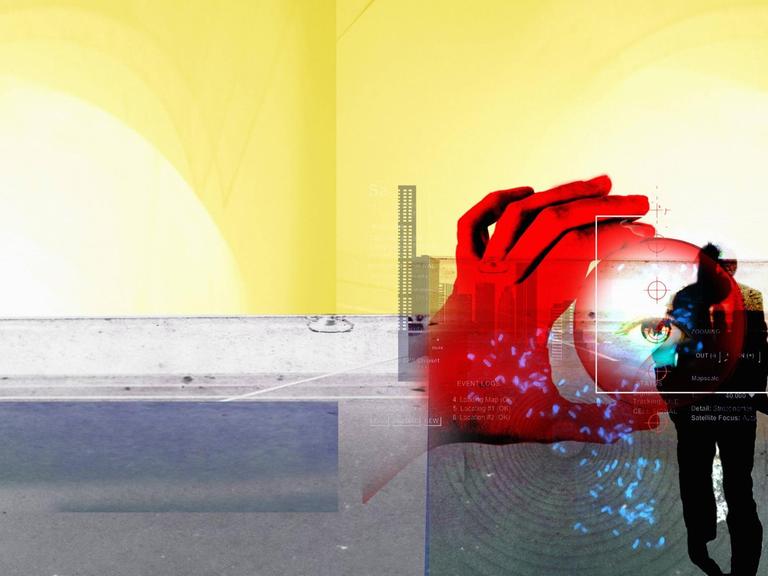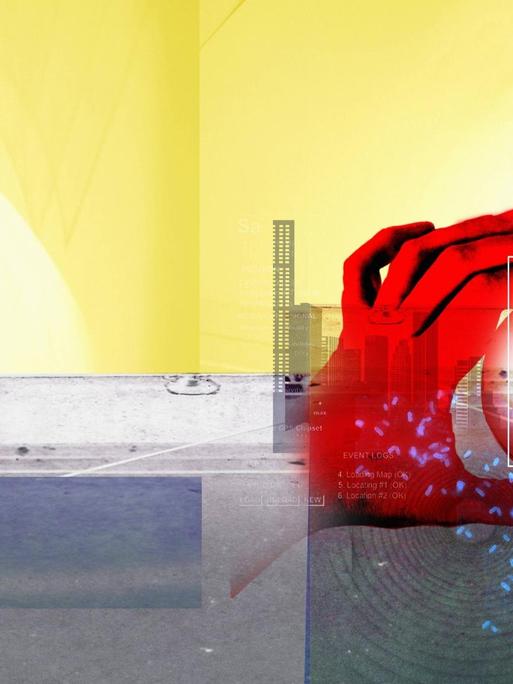Vom eigenen Blick am Bildschirm gefangen
05:41 Minuten

Ein Bildschirm voller Video-Kacheln und sich selbst hat man stets im Blick – das ist seit Corona der Normalfall universitärer Lehre. Wie verändert das die Bildung? Um das zu begreifen, müssen wir den Bildschirm als Medium ernst nehmen.
"Ich merke, dass es mich träge macht, es macht mich unglücklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in meiner menschlichen Entwicklung nach vorne bewege. Aber in irgendeiner anderen Entwicklung, von der ich nicht weiß, ob ich sie eigentlich haben möchte", sagt Benedict Gehle, der Philosophie und Medienwissenschaften studiert.
Kommilitonen kauen vor der Kamera
Während Schülerinnen und Schüler zumindest zwischenzeitlich in die Schulen durften, mussten Studierende zu Hause bleiben. Auf ihren Bildschirmen reiht sich seit nunmehr eineinhalb Jahren ein Gesicht an das andere.
"Gesichter sind quasi die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen im Seminar", sagt die Geschichtsstudentin Mareike-Beatrice Stanke. "Ein Hintergrundrauschen, das aber nach vorne treten kann, wenn die Person halt irgendetwas macht. Also, zum Beispiel wenn Du dann plötzlich einen essenden Kommilitonen vor der Kamera hast."
Bildung als Selbstreflexion
Der französische Philosoph Michel Foucault hat einen doppeldeutigen Bildungsbegriff: Zum einen gibt es die Kultur der Selbstbildung. Der gebildete Mensch versucht, seinen Handlungen "eine rationale und reflektierte Struktur zu verleihen", indem er Gründe und Informationen abwägt, sich hinterfragt. Schließlich entwickelt er so eine individuelle "Lebenskunst", eine "Ästhetik der Existenz". Das kann er nicht allein, für seine Selbstreflexion braucht er einen Spiegel.
Heiko Liepert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie und ihre Didaktik an der Universität Kiel: "Reflexion ist eine Metapher, und da steckt die Spiegelmetapher ja schon drin. Das heißt, wir müssen uns an etwas reflektieren. Wir brauchen eine Reflexionsfläche, in der wir uns überhaupt erst in den Blick nehmen können."
In der Online-Lehre nimmt man sich über den Bildschirm in den Blick. So wird aber die zweite Dimension von Foucaults Bildungstheorie relevant. Die Bildungsinstitutionen der Industriegesellschaft sollen den Einzelnen in die Gesellschaft integrieren - durch Erziehung, Kontrolle, Prüfungen, Zertifikate. All das wird in Online-Seminaren irritationsfrei gewährleistet.
Kulturwandel vom Begriff zur Geste
Irritieren tut Studierende wie Mareike-Beatrice Stanke vielmehr etwas anderes: dass das Ganze auf dem Bildschirm stattfindet. Inmitten des Hintergrundrauschens der Mitstudierenden findet man plötzlich sich selbst. Die Spiegelung verändert sich: "Man beobachtet sich quasi beim Reden, man beobachtet sich beim Artikulieren, und das hat dann schon eine gewisse Form von Selbstüberwachung und wie man sich gibt, was so in Präsenz nicht stattfinden würde, dass man sich so sehr reflektiert."
Genau hier liegt das bildungsphilosophische Problem: Der mediale Sprung in die Online-Lehre, der Einsatz des Bildschirms, betrifft den Reflexionsprozess selbst. Mit dem ungarischen Filmtheoretiker Béla Balázs könnte man das als einen Sprung von einer begrifflichen zu einer visuellen Kultur fassen. Man kommuniziert plötzlich wortlos, über "Mienen und Gebärden".
Sich vom Digitalen nicht verführen lassen
Liepert zufolge ist es die Aufgabe von Bildung, so einen Wandel bewusst zu begleiten – er verweist auf den Philosophen Hans Blumenberg: "Blumenberg hat Bildung mal als 'Unverführbarkeit' beschrieben. Der steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum klassisch humboldtschen Bildungsbegriff sicherlich, aber er legt den Schwerpunkt heutzutage darauf, weder fraglos einer Autorität zu trauen noch einer sozialen Gruppe zu trauen noch sich selbst zu trauen, sondern den Schwerpunkt auf Denkprozesse zu legen."
Bildung in der digitalen Welt wäre mit Blumenberg also das Vermögen, sich von ihr nicht verführen zu lassen. Das erfordert ein Zögern gerade in Hinblick auf das Hauptargument für Digitalität: dass Kommunikation leichter und bequemer wird.
Annika Frye, Professorin für Designwissenschaft, ist der Auffassung, dass in der Freude über die aufrechterhaltene Minimalkommunikation das Medium dieser Kommunikation oft übersehen wird – der Bildschirm. Und der ist kompliziert. Prinzipiell sind durch ihn eine Vielzahl an visuellen Erfahrungen möglich. Zusammenarbeit in virtuellen Räumen, Rollenspiele, geteilte Schreibprozesse.
Die Videokacheln als Kasperletheater
Dass es eineinhalb Jahre lang vor allem bei gerasterten Kachel-Menschen blieb, ist für Frye enttäuschend, "weil es wirklich auf schlechteste Art und Weise das simuliert, was uns ausmacht - also, ein bisschen wie so ein Kasperletheater, weil das ja auch sowas Ausschnitthaftes ist, wo dann am Ende nur die Figur zu sehen ist, aber nicht der Arm."
Das Kasperletheater etablierte sich kurz nach der Humboldt'schen Bildungsreform im deutschen Sprachraum. Es entstand aus demselben humanistischen Geist. Auf Jahrmärkten wiesen Kaspers Abenteuer einprägsam und leicht verständlich auf gesellschaftliche Missstände hin. Sie sollten zur Demokratie, zum Ungehorsam erziehen.
Das Kasperletheater entwickelte hierfür eine Pädagogik der Groteske, in der Verzerrung, Grauenvolles und Missgestaltetes mit dem Komödiantischen zusammenkamen.
Ähnlich kollidieren auf den Bildschirmen der Online-Universität begriffliche Inhalte mit einer ihnen äußeren Form: Die gewohnte Reflexion wird verzerrt. Gute Voraussetzungen, Unverführbarkeit zu lernen – wenn man das Kasperletheater sieht.