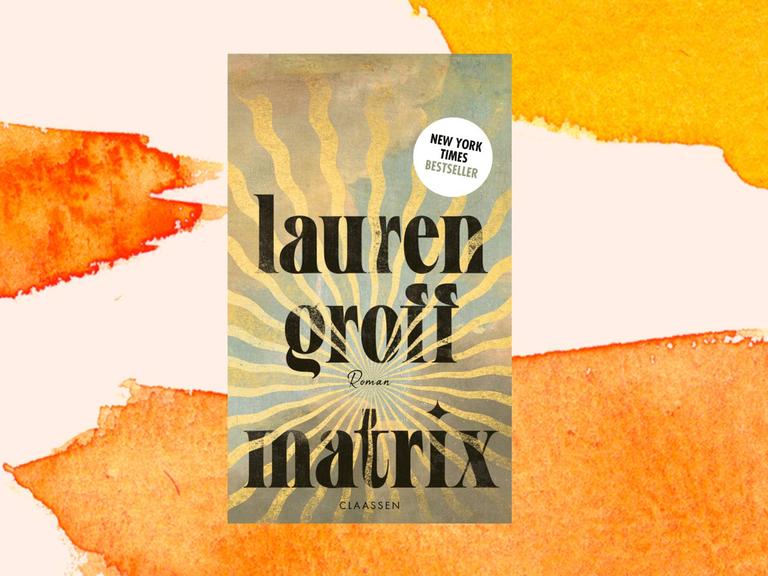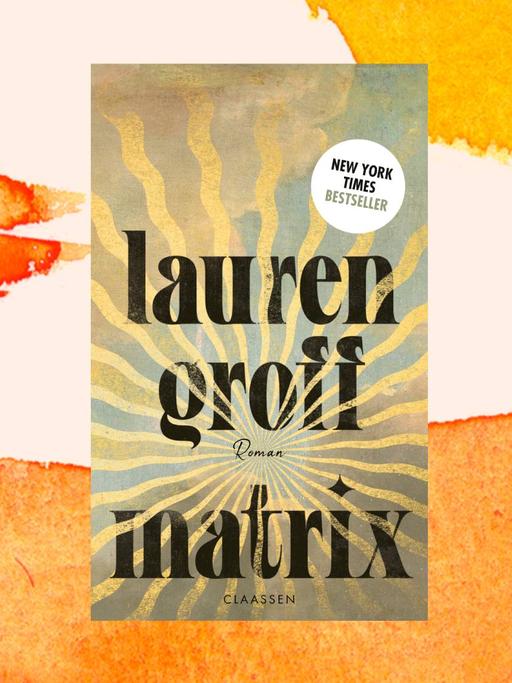Ottessa Moshfegh: „Lapvona“
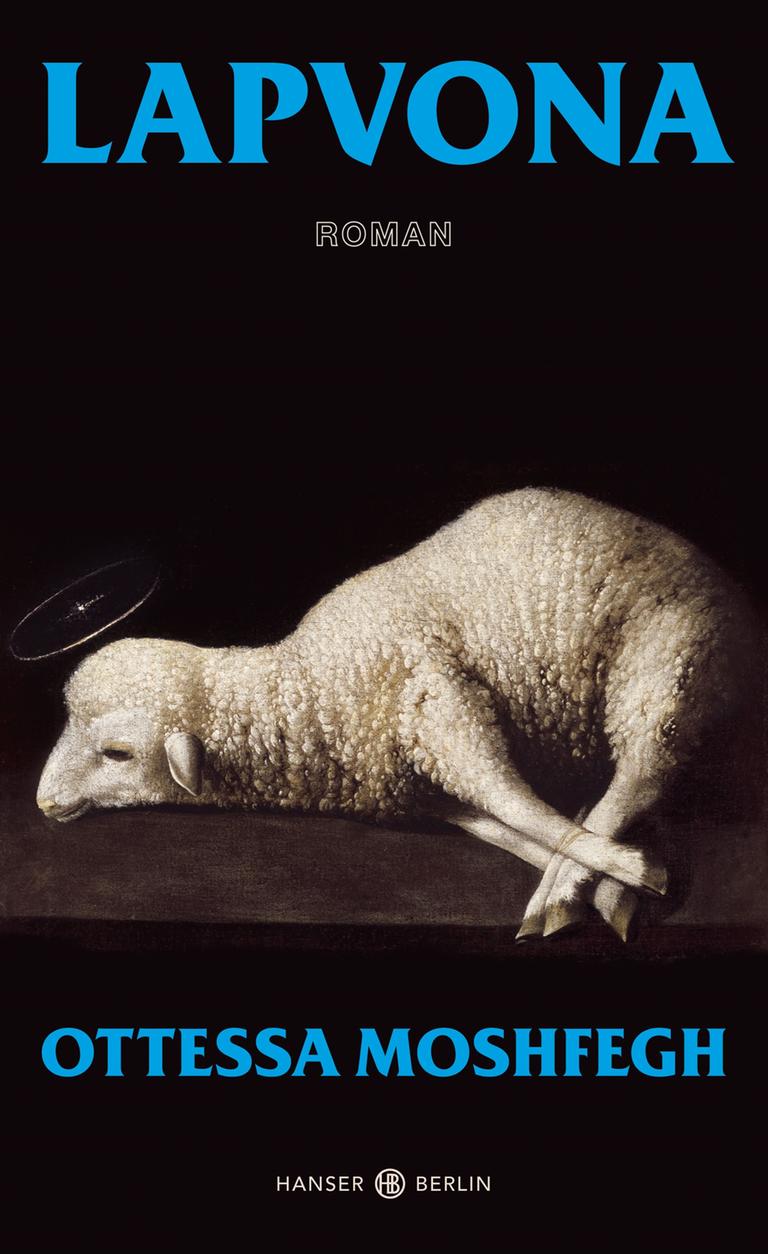
© Hanser Verlag
Sie herrscht grausam und allmächtig
06:31 Minuten
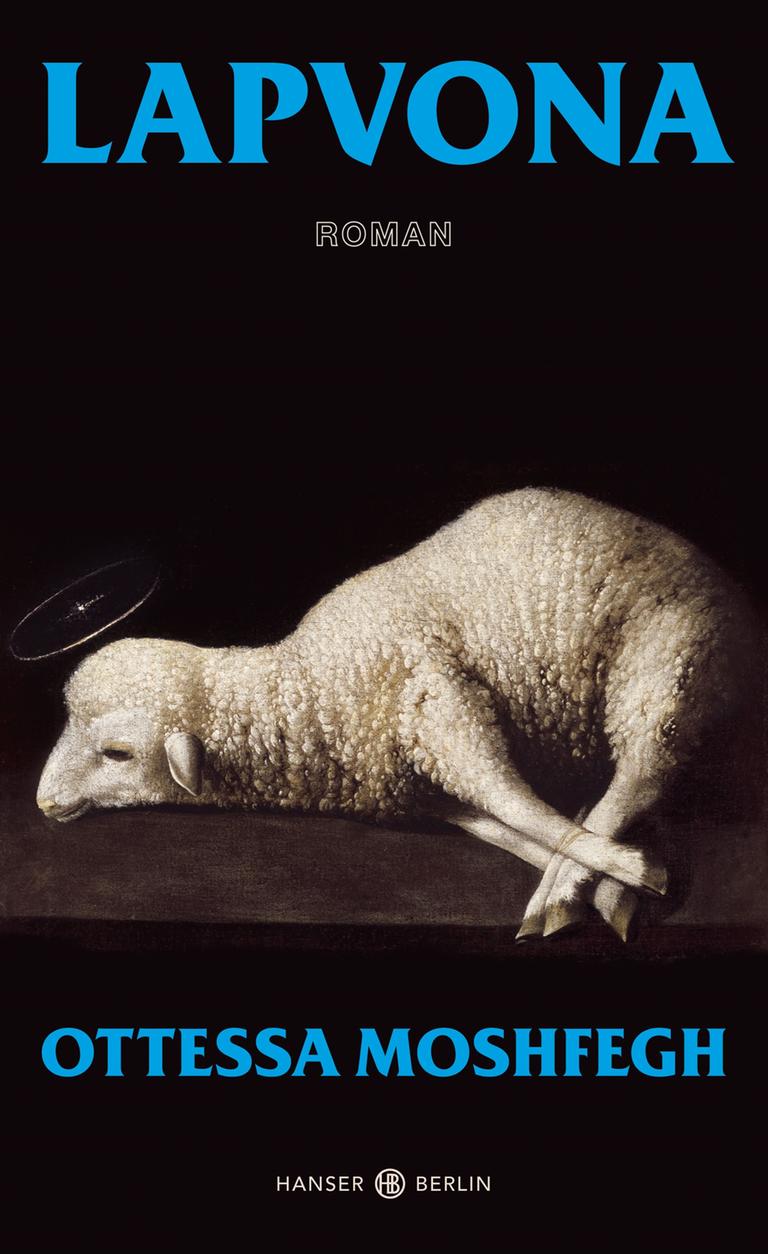
Ottessa Moshfegh
Anke Caroline Burger
LapvonaHanser Berlin, Berlin 2023336 Seiten
26,00 Euro
Dieses Buch ist nichts für schwache Mägen: Ottessa Moshfegh frönt in ihrem Mittelalter-Epos der Dekadenz und Grausamkeit, jenseits jeder Moral. Damit demonstriert die eigenwillige Autorin, dass Literatur alles darf. In ihrem Werk regiert sie allein.
Ottessa Moshfegh hatte noch nie besonders viel Hoffnung im Angebot. Ihre Romane erzählen von Einsamen und Außenseiterinnen, schwelgen im Schmerz und in perversen Gelüsten. „Lapvona“ aber ist ein Gipfel an Grausamkeit, selbst in Moshfeghs oft faszinierend groteskem Werk. In Lapvona, einem mittelalterlichen Fürstentum, wird gehungert und gequält, vergewaltigt, an den Pranger gestellt und gemordet.
Ein Sohn für einen Sohn
Eine verstümmelte Leiche setzt die Handlung in Gang. Der Sohn des Fürsten Villiam ist tot. Mit willkürlichen Steuern ohne Maß und Moral regiert er Lapvona. Für seinen ermordeten Sohn, ja selbst für den geständigen Täter – den missgebildeten Sonderling Marek, „Bankert“ des Lammhirten – hat der Fürst nur ein müdes Lächeln übrig. Denn er „war so daran gewöhnt, unterhalten zu werden, dass jedes Drama, mochte es auch noch so echt sein, auf ihn wie eine Inszenierung zu seiner persönlichen Zerstreuung wirkte.“
Den 13-jährigen Täter tauscht Villiam kurzerhand gegen seinen toten Sohn ein, der im selben Alter war. Mareks Aufstieg vom Lammhirten zum fürstlichen Ziehsohn steht lose im Zentrum des Romans. Genauso grundlos und unwahrscheinlich wie sein Rollenwechsel reihen sich in „Lapvona“ die Katastrophen aneinander.
Unglück für alle
Das Unglück ereilt alle: die erblindete Ina, die als Ausgestoßene ihre Jugend in einer Höhle im Wald verbringt, nur um danach als kräuterkundige, aber zwielichtige Heilerin ins Dorf zurückzukehren. Mit ihrer Milch, die bis ins hohe Alter nicht versiegt, zieht Ina zahllose Kinder, auch Marek groß. Steht ihr so immerhin noch ein wenig Souveränität innerhalb der Gemeinschaft zu, malträtiert Moshfegh andere Figuren bis an die Grenze des Ertragbaren.
Mareks Mutter wird wiederholt vergewaltigt, lebt schließlich stumm, mit herausgeschnittener Zunge im Schloss bei ihrem Sohn, den sie kurz nach der Geburt verlassen hatte.
Literatur darf alles
In „Lapvona“ bekommt am Ende keine Figur, was sie verdient. Die Autorin statuiert an keinem der Charaktere ein Exempel, liefert keinen gesellschafts-analytischen Erklärungsansatz für Dekadenz und Niedertracht. Wenn der Fürst von Lapvona mit Willkür regiert, herrscht Ottessa Moshfegh auf dieselbe Art und Weise in ihrem Roman. Im Allmachtsrausch stellt sie, an Georges Bataille und Marquis de Sade geschult, die Grausamkeit aus – in epischer Opulenz, bis ins kleinste Detail, und zwar einfach: weil sie es kann. Weil Literatur das darf.
So ist es kein Zufall, dass ausgerechnet der sadistische Herrscher von Lapvona uns daran erinnert, wie wir diesen Roman zu lesen haben, als Fiktion nämlich, ohne moralische Implikationen: „Villiam war ein fröhlicher Mensch. Tragödien dieser Art ließen ihn kalt. Es war einfach nicht wahr. Es war unmöglich. Aber irgendwie akzeptierte er es doch, als eine Art Spiel.“
Voyeuristische Lust
Ob diese brutale Potenzgeste durch einen Roman trägt, ist eine andere Frage. Wie der unterhaltungsverwöhnte, schnell gelangweilte Regent, verliert die Autorin, wenn sie mit einer allmächtigen Erzählinstanz zwischen ihren Figuren hin- und herspringt, auch die ein oder andere Nebenfigur aus den Augen.
Ihr feines Sensorium für die Gegenwart kommt in diesem Roman nicht zum Tragen. Die voyeuristische Lust am Exzess haben uns George R. R. Martins Fantasy-Epos „Das Lied von Eis und Feuer“ und dessen erfolgreiche Serien-Verfilmung „Game of Thrones“ längst vor Augen geführt. Aber vermutlich hat Ottessa Moshfegh, die sich gern stolz und genialisch gibt, auch diese Rezeption längst kalkuliert. Und schreit der Welt ins Gesicht, was sie kann, einfach: weil sie es kann.