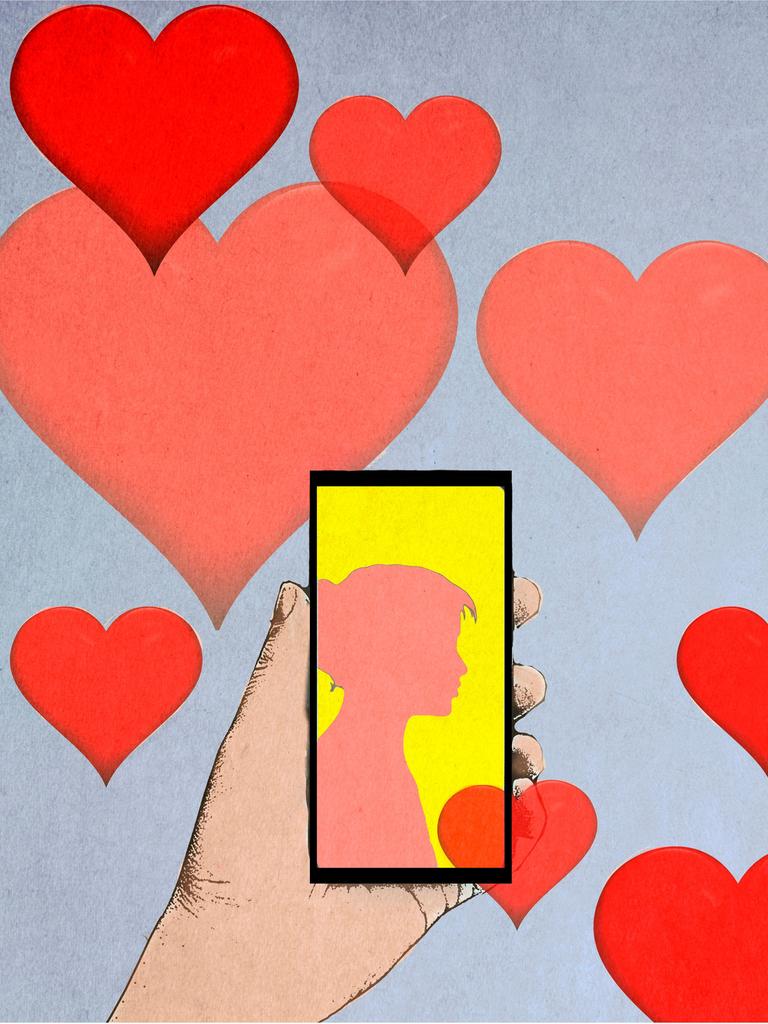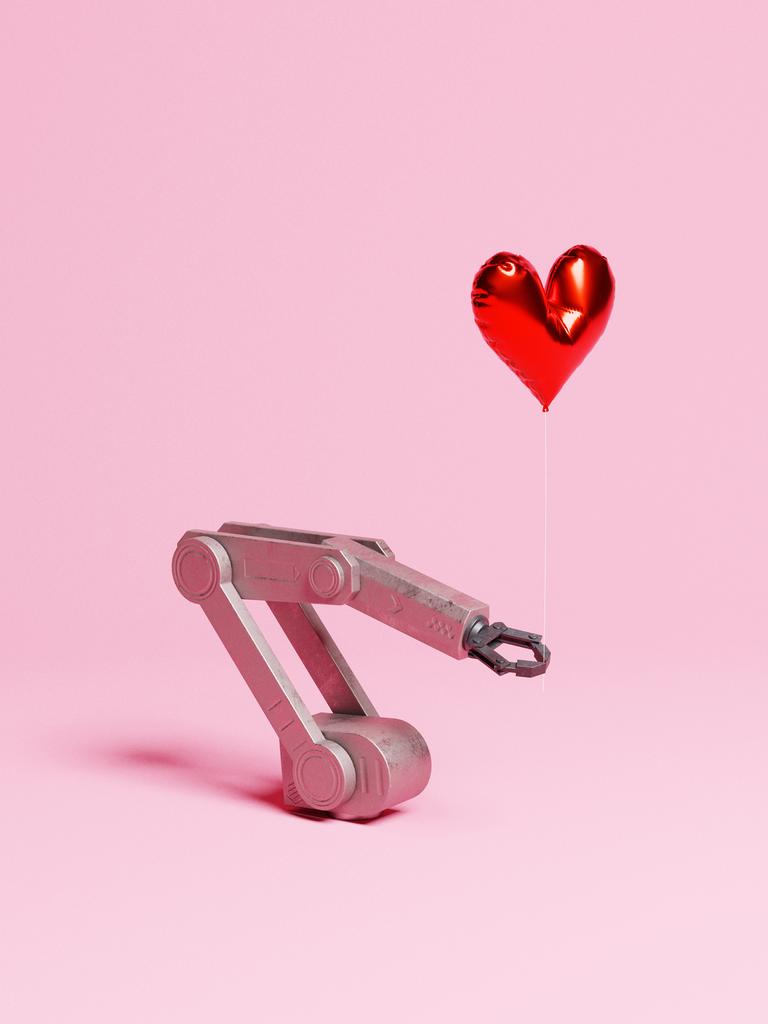Parasoziale Beziehungen

Dank Smartphones können wir jederzeit in Kontakt mit anderen treten und somit auch Beziehungen zu Fremden aufbauen - oft auch einseitige. Darunter leiden andere soziale Kontakte. © IMAGO / fStop Images / Malte Mueller
Was Social Media mit unserem Sozialleben macht

Smartphones und Social Media bestimmen unsere Leben. Wir bauen darüber sogar Beziehungen zu Menschen auf, die wir gar nicht kennen. Das hat auch Effekte auf unser Sozialleben in der Offline-Welt - positive wie negative.
Anderthalb Meter. So viel Abstand zum Smartphone halten wir gerade noch aus, bevor wir nervös werden, sagt Sozialpsychologin und Therapeutin Johanna Degen. Das Internet, vor allem Social Media, nimmt viel Platz in unserem Leben ein, auch in sozialer Hinsicht. Das prägt uns mehr, als uns bewusst ist.
Inhalt
Was sind parasoziale Beziehungen?
Parasozial werden Beziehungen genannt, die wir indirekt führen, also vermittelt über Medien, heute vor allem über Social Media, Messengerdienste und Partnerbörsen. Diese können verschiedene Formen haben: Es können einseitige Beziehungen zwischen Fans und Künstlern oder Followern und Influencern sein, aber auch Beziehungen zu künstlichen Intelligenzen (zum Beispiel Chatbots) oder zu anderen Menschen beim Onlinedating. Auch zu Menschen, die man persönlich kennt, kann man über Messenger oder Videochat parasoziale Beziehungen pflegen.
Das funktioniert, weil unser Gehirn „keine evolutionäre Schranke“ eingebaut habe, die zwischen echten und digitalen Beziehungen unterscheidet, sagt Sozialpsychologin Johanna Degen. Wir messen parasoziale Beziehungen also Bedeutungen zu, weil es Beziehungen für uns sind. In der Pandemie hat sich etwa gezeigt, so die Therapeutin: „Die Menschen vertrauen ihren Influencerinnen und Influencern mehr als zum Beispiel Freunden und Familie, wenn es um politische Haltung geht.“ Man habe das Gefühl, sie seien für einen da.
Welche Auswirkungen hat das?
Parasoziale Beziehungen können positive Effekte haben. „Wir beruhigen uns über das Internet“, sagt Johanna Degen. Social Media verringere das Gefühl von Einsamkeit. Auch Onlinedating funktioniere: Fast die Hälfte der Paare, die in den vergangenen fünf Jahren zusammengekommen sind, hat sich über das Internet kennengelernt.
Doch die Entwicklung hat auch Kehrseiten: Onlinedatingplattformen haben starke Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, sie können Angst, Essstörungen und depressive Verstimmungen auslösen. Außerdem wirkt sich Social Media auf das soziale Leben offline negativ aus: „Wir senden weniger Signale, die uns ansprechbar machen: lächeln, lange angucken, Handflächen zeigen“, so Degen.
Parasozialen Beziehungen lassen uns Bindungen zu Familie und Freunden vernachlässigen, etwa beim "Phubbing", wenn man im Beisein von anderen sein Smartphone benutzt. Durch das Parasoziale lernen wir auch Sozialverhalten, das wir offline übertragen.
Dann findet man Ghosting (das plötzliche Nichtmehrmelden) auch beim Therapeuten, beim Handwerker oder bei Freunden in Ordnung. Dann akzeptieren wir auch, dass Beziehungen einseitig sein dürfen oder zu einem ökonomischen System gehören. Dann werden Partnerbörsen dafür genutzt, um Bedürfnisse niedrigschwellig auszulagern, sich Komplimente abzuholen oder seinen ‚Marktwert zu checken‘.
Warum ist das ein Problem?
„Die Traditionen, die wir da etablieren, die schreiben sich in unsere Gesellschaft ein“, sagt Johanna Degen. „Dann kann es passieren, dass der Mensch zum Rohmaterial von Technik wird. Das heißt: Der Wert des Menschen hängt dann davon ab, wie viel Zeit er oder sie online ist. Also wir werden für den ökonomischen Zweck zum Beispiel von Technik verbraucht, statt Technik zu benutzen, um zu leben.“
Das ist laut Degen ein Problem, weil die Zeit, die man online verbringt, keinen sogenannten Spillover-Effekt hat, also einen Übertragungseffekt. Was das bedeutet, macht die Therapeutin am Beispiel Festivals fest: Wer zu einem Festival fährt, um dort einen potenziellen Partner kennenzulernen, aber keinen bekommt, der oder die hat immer noch etwas anderes erlebt: Musik gehört oder schöne Gespräche geführt. Wer aber nur online nach einem Partner sucht (und keinen findet), hat dabei sonst nichts getan. So kann es passieren, dass man „aus Versehen das Leben nicht lebt“, so Degen.
Was kann man dagegen tun?
Die Nutzung von Smartphones oder Social Media sowie parasoziale Beziehungen sind für Johanna Degen weder eine Angst (etwas zu verpassen, FOMO) noch eine Sucht, sondern höchstens ein suchtähnliches Verhalten, eine Gewohnheit. Die oft genutzte Strategie, die Onlinezeit zu begrenzen, bringe nichts, sagt die Sozialpsychologin. Parasoziale Beziehungen hätten auch bei kurzer Dauer negative Effekte, etwa wenn man sich mit anderen vergleicht. Doch sie hält auch nichts davon, Technik generell zu verteufeln.
Ihr Plädoyer: „Was wir brauchen, ist eine parasoziale Kompetenz.“ Dafür benötige es mehr Bildung, diese könne man sich aber auch selbst antrainieren. Man müsse zunächst anerkennen, dass parasoziale Beziehungen bedeutsam seien. „Wenn wir es schon so ernst betreiben, dürfen wir es gerne ernst nehmen und in unser soziales Sein einbetten“, so Degen.
Vor allem plädiert sie dafür, sein Leben zu gestalten. Man sollte sich daher fragen: „Sind wir im Modus des angeeigneten Lebens?“ Das bedeutet, zu unterscheiden und sich zu fragen: „Werde ich gerade konsumiert oder lebe ich ein sinnvolles und erfüllendes Leben mit Technik? Benutze ich Technik, um zu leben?“
leg