Peggy Mädler: "Wohin wir gehen"
Galiani Verlag, Berlin 2019
219 Seiten, 20 Euro
Wenige Striche, deutliches Bild
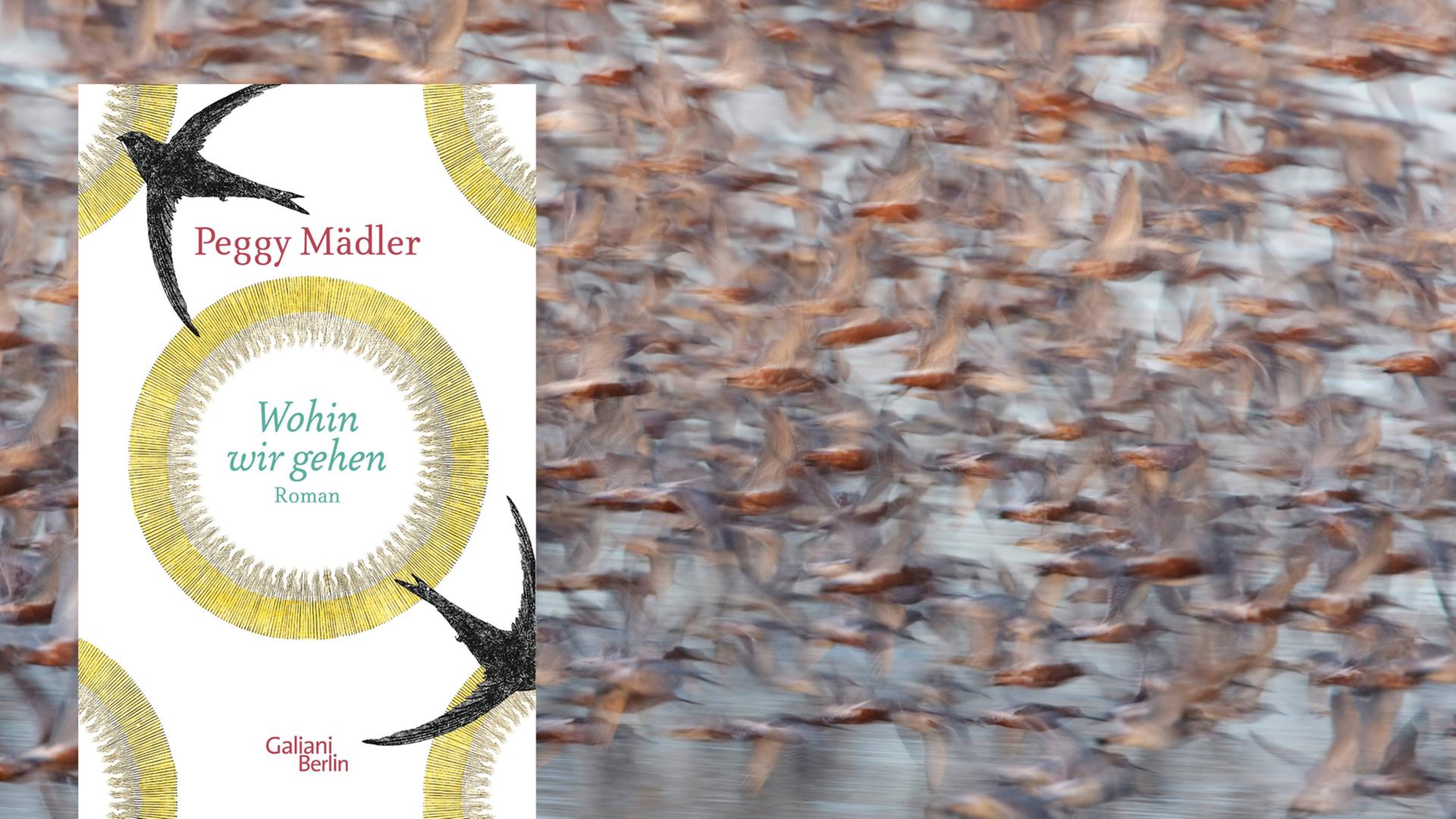
In ihrem Roman "Wohin wir gehen" schreibt Peggy Mädler sich unscheinbar durch mehrere politische System und Staaten. Und das mit einer Sprache, die kaum funkelt. Doch unser Kritiker lobt, es gehe nicht um Effekte, sondern um die Räume zwischen den Tönen.
Das ist ein auf den ersten Blick unscheinbar wirkendes Buch. Diverse politische Systeme, verschiedene Länder und Familienkonstellationen durchziehen den Text, dabei hat die Sprache überhaupt nichts Auftrumpfendes oder Kennerisches. Das Besondere an diesem Roman ist, mit welch vermeintlich sparsamen Mitteln er seine Wirkung erzeugt. Wer zu stark auf spektakuläre Reize setzt, muss hier zwangsläufig enttäuscht werden – in diesem Buch wird nicht effektgesteuerter Journalismus als Literatur getarnt, sondern hier geht es um die Kunst der Zwischenräume.
Wirr und katastrophal wie das 20. Jahrhundert
Im Mittelpunkt stehen zwei Freundinnenpaare aus verschiedenen Generationen. Ihre Geschichten werden jeweils chronologisch erzählt, wechseln sich im Text aber ab, so dass ein merkwürdig luftiges und dehnbares Zeitgeflecht entsteht. Man ist immer ganz nah dran, in Großaufnahme: nie wird allgemein über die Zeitläufe reflektiert, es geht in einzelnen Bildern und Szenen um den konkreten Alltag der handelnden Personen.
Die Biografien entsprechen den Wirren und Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Es geht um Liebe und Tod, um Krieg und Vertreibung, um Unterdrückung und die leichten Momente von Lebenslust. Die großen Gefühle und Umstürze prägen nur indirekt die einzelnen Momentaufnahmen. Das Habsburgerreich in Böhmen und Mähren, die Kämpfe zwischen Kommunisten und Nationalisten unter den Deutschen in der Tschechoslowakei, die DDR und die unmittelbare Gegenwart in Berlin: All dies tritt hier auf engstem Raum zusammen, und es wird in den komplexen Beziehungsstrukturen der handelnden Personen nahezu plastisch herausgearbeitet.
Starke Vergangenheit, schwächere Gegenwart
Das vielleicht Verblüffendste an diesem Roman ist, wie hier die frühe DDR geschildert wird. Almut und Rosa, zwei Freundinnen durch viele Geschichtsbrüche hindurch, sind Mitte bis Ende der 40er-Jahre Schülerinnen und wachsen voller Hoffnung in neue gesellschaftliche Erfahrungen hinein. Die Autorin des Buches ist in der DDR aufgewachsen und war zum Zeitpunkt des Falls der Mauer 13 Jahre alt. Vielleicht erklärt das ihren unvoreingenommenen, aber distanzierten Blick, in dem diese Hoffnungen aufscheinen und ernst genommen werden. Gleichzeitig wird aber genauso deutlich, wie belastet der Alltag von vornherein war.
Der Autorin gelingt es, ihre Figuren in wenigen Strichen sehr pointiert zu charakterisieren. Die Spiegelung des früheren Freundinnenpaars in zwei Mittdreißigerinnen der Jetztheit, Kristine und Elli (Almuts Tochter) hat dabei einen besonderen Reiz. Nur an wenigen Stellen blitzt etwas zu Gewolltes auf, und merkwürdigerweise wirken manche Szenen aus den heutigen Jahren im Zweifel sogar etwas weniger stark als diejenigen vergangener Jahrzehnte – trotz der durchgehend einfach gebauten Sätze im Präsens. Aber vielleicht ist genau dies der Grund dafür, warum dieser Roman durchaus beeindruckt. Dass es hier um die großen existenziellen Fragen geht, registriert man gegen Schluss wie überrumpelt.






