Philip Manow: (Ent-)Demokratisierung der Demokratie
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
160 Seiten, 16 Euro
Von liberalen Eliten und Anti-Demokraten
07:05 Minuten
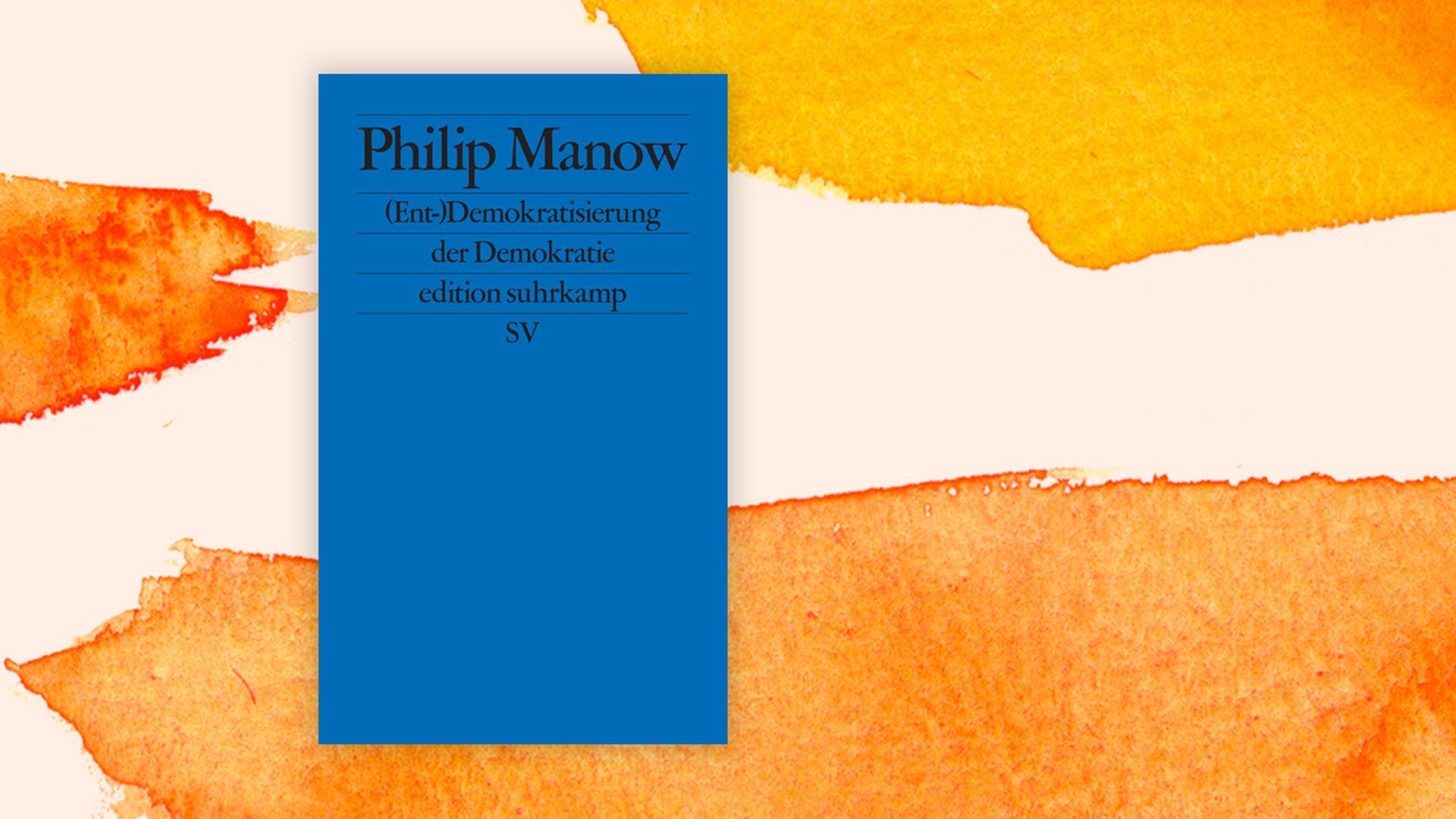
Anti-demokratische Populisten versus demokratische Liberale? Philip Manow bürstet in seinem Essay "(Ent-)Demokratisierung der Demokratie" eingewöhnte Perspektiven gegen den Strich. Über weite Strecken ist dies sehr erhellend.
Dass die Demokratie sich in der Krise befindet, ist zu einem Allgemeinplatz geworden. Man wähnt sie wahlweise von Populisten, von autoritären Staatsführern und ihren Anhängern bedrängt – oder von einem entfesselten Neoliberalismus: einem globalen Wirtschaftssystem, das sich jeder demokratischen Kontrolle entzieht.
Aber wie existenziell ist die Notlage tatsächlich, in der sich die Demokratie befindet? Und wie unterscheidet diese sich von all jenen anderen Krisen, die die abendländische Demokratie seit der Französischen Revolution durchlaufen hat?
Das sind die Fragen, denen der Bremer Politikwissenschaftler Philip Manow in seinem kurzen, aber überaus anregenden und instruktiven Essay "(Ent-)Demokratisierung der Demokratie" nachgeht.
Das sind die Fragen, denen der Bremer Politikwissenschaftler Philip Manow in seinem kurzen, aber überaus anregenden und instruktiven Essay "(Ent-)Demokratisierung der Demokratie" nachgeht.
Einhegung des "Pöbels"?
Wie der Titel schon andeutet, betrachtet er die politische Lage als ambivalent: Sie ist, so lautet seine zentrale These, zugleich vom Wachsen und vom Schwinden demokratischer Prozesse geprägt. In den jüngsten Erfolgen populistischer Parteien und Führer könne sich schon deswegen keine "Krise der Demokratie" zeigen, weil diese durchweg auf demokratischem Wege zustande gekommen sind.
Eher handle es sich um eine "Krise der Repräsentation", also jener Mechanismen, mit denen das Volk in der Demokratie vor sich selber geschützt werden soll, vor seiner eigenen Unberechenbarkeit und Verantwortungslosigkeit. Oder anders gesagt: jener Mechanismen, mit denen die demokratischen Eliten das Gemeinwesen und vor allem auch ihre eigenen Interessen vor der Herrschaft des Pöbels schützen wollen.
Der Wunsch zur Einhegung des Pöbels ist so alt wie die Demokratie, wie Manow in einem historischen Exkurs zeigt. Zugleich ist ihre Geschichte von der schrittweisen Ausweitung der Partizipationsmöglichkeiten geprägt. Durften sich anfangs nur Männer mit einem hohen sozialen Status an demokratischen Wahlen beteiligen, so wurden diese Rechte später auch an niedere Gesellschaftsschichten und Frauen vergeben.
Demokratie ist unberechenbar wie noch nie
Inzwischen unterliegt die Teilhabe keinen Beschränkungen mehr, weswegen die Demokratie so demokratisch ist wie noch nie – aber eben auch so unberechenbar wie noch nie. Zumal die politischen Parteien, deren institutionalisierte Entscheidungsprozesse lange Zeit für Berechenbarkeit sorgten, stark an Bedeutung verlieren.
Aus dieser Krise der repräsentativen Demokratie gehen vor allem charismatische Figuren mit einem Talent zur Polarisierung als Sieger hervor. Ob diese – wie etwa Donald Trump – die Demokratie dauerhaft abschaffen wollen, lasse sich noch nicht sagen, so Manow, auch wenn er die Gefahr durchaus sieht. Für ungerechtfertigt hält er indes die Gewohnheit der "liberalen Eliten", jeden, der nicht in das eigene Weltbild passt, als "Anti-Demokraten" zu brandmarken.
Die wahre "Entdemokratisierung der Demokratie" geht für ihn nicht von demokratisch gewählten Politikern aus, sondern von der Entmachtung der Nationalstaaten durch transnationale Gebilde wie die Europäische Union. Eine funktionierende Demokratie, so Manow, könne es nur im Rahmen eines territorial definierten Staats geben, in dem das Staatsvolk auf den Ausgleich unterschiedlicher Interessen vertrauen kann, so dass es den politischen Gegner nicht als Feind betrachtet. Die "Denationalisierung der Politik" sei also gleichbedeutend mit ihrer Entdemokratisierung, wovon gerade jene liberalen Eliten profitieren, die sich selber für besonders demokratiefreundlich halten.
Unterkühlter Blick auf die Neue Rechte
Manows Studie ist trotz ihrer gedanklichen Komplexität überaus lesbar. Er versteht es – keine geringe Kunst –, dialektisch zu argumentieren und nachvollziehbar zu schreiben. Wie er die eingewöhnten Perspektiven auf anti-demokratische Populisten und demokratische Liberale gegeneinander verkehrt, ist anregend. Bloß den seinerseits dialektischen Charakter des Rechtspopulismus bekommt er nicht hinreichend scharf in den Blick. Denn hier siegt ja nicht nur ein "Pöbel" gegen seine Unterdrückung durch demokratische Repräsentationsmechanismen. Dieser wird wesentlich auch durch das Ressentiment gegen – migrantisch geprägte oder sonstwie nicht der Norm entsprechende – Bevölkerungsgruppen geeint.
Oder anders gesagt: Es handelt sich um einen "Pöbel", der sich selber als Elite betrachtet, bloß dass diese Selbsteinschätzung nicht auf einem sozio-ökonomischen Fundament ruht, sondern auf rassistischer Ideologie.
Davon hat Manow keinen Begriff: Wie schon in seinem letzten Buch, "Die Politische Ökonomie des Populismus", brilliert er über weite Strecken mit kühlem analytischen Materialismus. Doch bleibt sein Blick auf die kulturellen Impulse der Neuen Rechten dabei auch diesmal zu unterkühlt.






