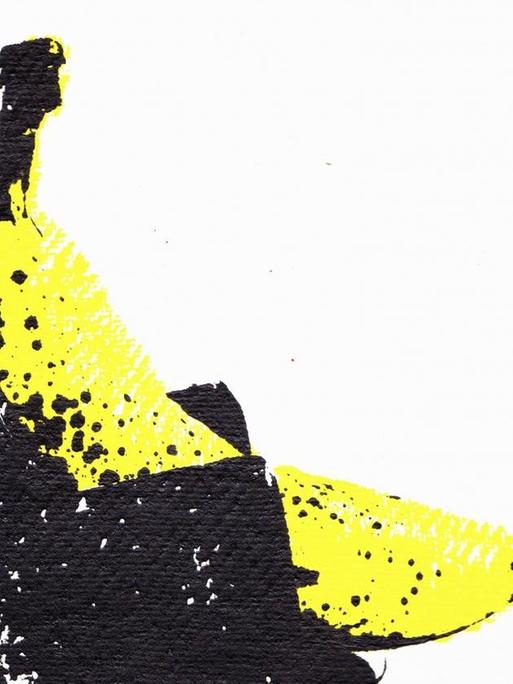Andreas Weber: "Indigenialität"
Nicolai Verlag, Berlin 2018
120 Seiten, 20 Euro
Hin zum Einklang mit der Natur
37:39 Minuten

Klimawandel und Artensterben seien fatale Folgen einer falschen Weltsicht, sagt der Philosoph Andreas Weber. Von indigenen Völkern könnten wir lernen, unsere Lebensgrundlagen besser zu schützen und im Einklang mit der Natur zu leben.
Zerstören wir die Natur und ruinieren das Klima, weil uns zu wenig bewusst wird, wie viel Gewalt wir damit uns selbst antun? "Wir brauchen dringend eine neue Kosmologie, eine neue umfassende Weltsicht", sagt der Philosoph und Biologe Andreas Weber. "Hier ist der Mensch, hier sind seine Kultur, sein Geist und seine Sprache, und da sind die Dinge der Natur – diese Trennung funktioniert nicht mehr."
Eine Geschichte der Ausbeutung
Der Gegensatz von Kultur und Natur ist tief verwurzelt in der Geschichte der Zivilisation. Er reicht zurück bis in die Anfänge von Ackerbau und Viehzucht. Unsere moderne Lebensweise beruht bis heute darauf. Aber Weber erkennt in der ideellen Trennung von Mensch und Umwelt, Kultur und Natur den Keim einer tiefgreifenden Entfremdung. Diese westliche Weltsicht lege das Fundament für ein Ausbeutungsverhältnis, so Weber:
"Das ist der Gründungsmythos des Kapitalismus, dass Menschen rationale Akteure sind, die mit den Dingen, die sie als Ressourcen behandeln, so haushalten, dass es ihnen immer besser gehen kann, und dass vielleicht am Ende das ewige Leben winkt, die Unsterblichkeit in der Sicherheit materieller Güter. Wir sehen, dass diese Behandlung der Welt dazu führt, dass diese Welt zugrunde geht."

Lernen von der Weltsicht indigener Gemeinschaften: der Philosoph und Biologe Andreas Weber© Niklas Marc Heinecke
In seinem Essay "Indigenialität" stellt Weber diesem westlichen Weltverhältnis das Modell einer existenziellen Verbundenheit mit der Natur gegenüber: "Indigenialiät heißt, sich als aktiven Teil eines sinnvollen Ganzen zu verstehen und so zu handeln, dass die eigene Lebensqualität die des Ganzen steigert."
Der Mensch im Netzwerk des Lebens
"Ich bin das Land – und das Land ist ich", schreibt etwa die australische Aborigine-Autorin Margaret Kemarre Turner. Damit bringe sie eine Weltsicht jenseits des Natur-Kultur-Dualismus auf den Punkt, die von vielen Stammesgesellschaften geteilt werde, sagt Weber:
"Es ist nicht so, dass der Mensch auf der einen Seite steht, und der bewohnt eine Umgebung, sondern der Einzelne ist aus diesem Land entstanden und seine seelische Identität findet sich so in dem Land wieder, dass er sich als eine Form von Expression, eine Spielart, eine Ausdrucksweise dieses Landes denkt."
Auch Fruchtfliegen haben Gefühle
Solche, dem Animismus nahe stehenden Vorstellungen von einer beseelten Natur, die den Menschen mit einschließt, werden inzwischen auch von der Wissenschaft gestützt. Lange Zeit habe die westliche Sicht auf Mensch und Natur unter dem Einfluss des Philosophen René Descartes gestanden, der Tieren gar kein eigenes Seelenleben zugestand, so Weber. Neuere Experimente zeigten jedoch, dass selbst Bienen und Fruchtfliegen über komplexere innere Empfindungen verfügen, als Wissenschaftler bisher angenommen hatten:
"Diese ursprüngliche Idee: Eigentlich hat bloß der Mensch eine Seele oder ein Innenleben und der Rest ist stumme Maschinerie, das findet von Seiten der Biologie immer weniger Zuspruch."
Geben ist menschlicher als Raffen
Aber was ließe sich inmitten der technischen Zivilisation unserer Gegenwart überhaupt von einer indigenen Weltsicht lernen? Weber sieht darin zunächst einen heilsamen Weg aus der Entfremdung von unserer eigenen Natur. "Das Indigene", schreibt er, "ist der unterdrückte Teil unseres eigenen echten Menschseins".
Dieses verschüttete Erbe wiederzuentdecken, bedeute einen Gewinn von Lebendigkeit, erklärt Weber im "Sein und Streit"-Gespräch: "Wir begreifen, dass wir Körper sind, die fühlen, die Bedürfnisse haben, die nicht vom Funktionieren in einem kriegerischen System des Zusammenraffens abhängen, sondern dass wir geben können und geben möchten."
Ökonomie der Gegenseitigkeit
Damit verbunden ist für Weber auch die Vision eines alternativen Wirtschaftens. Viele traditionelle Stammeskulturen praktizierten ein "Zusammenleben in Gegenseitigkeit", in Webers Augen ein Vorbild für eine Ökonomie der Commons:
"In ihr werden die Zusammenhänge des Haushaltens nicht als der Austausch von Dingen zwischen Akteuren gedacht, sondern letztlich gibt es ein großes gemeinsames Ganzes, in dem die Akteure auch Teil der Ressource sind und die Ressource sich immer auch in die Akteure verwandelt."
Solche Formen der Gemeinwohlökonomie oder Allmende-Wirtschaft, wie sie auf moderne Weise auch in der Online-Enzyklopädie Wikipedia verwirklicht seien, hält Weber für wegweisend in Richtung einer westlichen "Indigenialität".
Wirtschaften mit der Natur - nicht gegen sie
Das beste Beispiel für ein Commons-System sei "ein langfristiges Wirtschaften in einer Natur, die dadurch nicht ärmer wird". Daran knüpft Weber auch konkrete politische Forderungen:
"Ich wünsche mir, dass die Politik das in Gesetze gießt, was richtig und wichtig ist. Dazu gehört, dass es keine andere Landwirtschaft mehr gibt als ökologische, dazu gehört, dass wir selbstverständlich unsere fossilen Brennstoffe weglegen - so schnell wir können."
Im Grunde wisse man längst, was richtig sei, sagt Weber. Aber unsere Lebensweise stehe oft im Widerspruch zur Erfahrung der eigenen Lebendigkeit und kappe unsere Verbindung zur Natur.
Deshalb plädiert Weber dafür, "dass unser Bildungssystem die Welt des Herzens und der Seele mit inkludiert und nicht weiter kolonialisiert als Torwächter des rein Rationalen, wie das im Augenblick ist". Denn die Ideologie der Trennung von Kultur und Natur sei noch längst nicht überwunden.
(fka)
Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:
Kommentar zur Wahl in Österreich: Expertokratie ist auch keine Lösung
Gleich wie die Wahl in Österreich heute ausgeht, eins ist sicher: Die Regierung der Experten geht zu Ende. Schade eigentlich, denken sich manche Österreicher. Wäre es nicht besser, sie auf Dauer zu stellen? Andrea Roedig ist da skeptisch.
Philosophie des Singens: Die Seele der Gedanken spüren
Singen macht nicht umsonst glücklich – wer singt, erfährt die Seele der vertonten Gedanken. Deshalb hören jetzt auch die Geisteswissenschaften genau hin: Gerade ist die erste "Philosophie des Singens" erschienen. Christian Berndt hat sie gelesen.