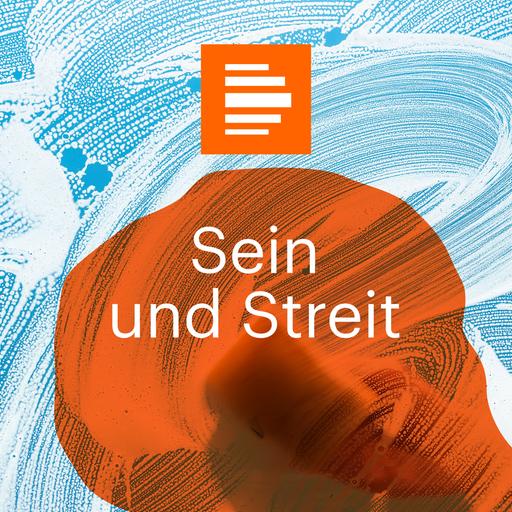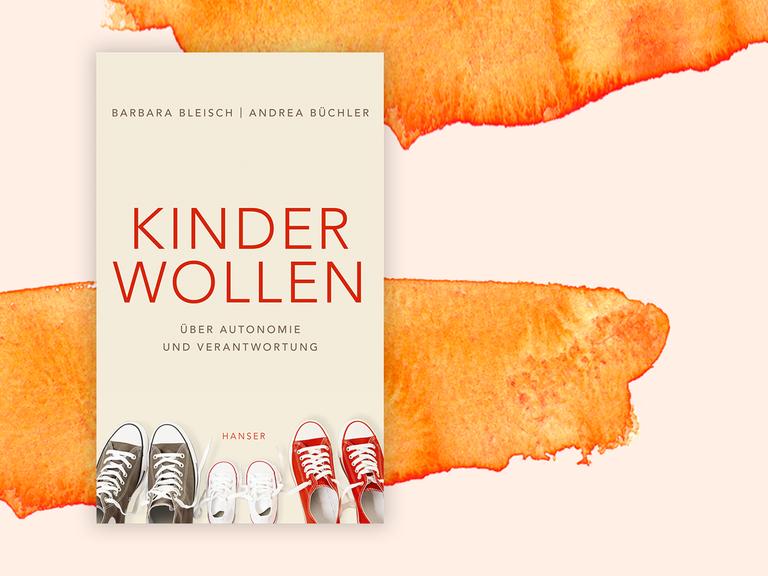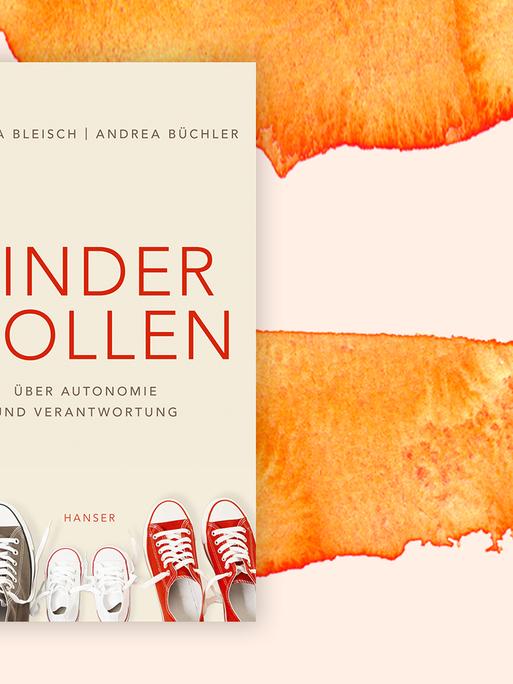Barbara Bleisch und Andrea Büchler: Kinder wollen. Über Autonomie und Verantwortung
Hanser Verlag, München 2020
304 Seiten, 22 Euro
Catherine Newmark: Warum auf Autoritäten hören?
Dudenverlag, Berlin 2020
128 Seiten, 14 Euro
Wie das Neue auf das Alte wirkt
41:38 Minuten

Was weiß die Philosophie von Schwangerschaft und Geburt? Erstaunlich wenig, so die Philosophinnen Barbara Bleisch und Catherine Newmark. Dabei verwandle die Ankunft eines Kindes auch dessen Eltern in völlig neue Menschen.
Alles auf Anfang. Noch einmal ganz von vorn beginnen. Der Impuls, dem Leben eine andere, bisher nicht gekannte Perspektive zu eröffnen, spiele wohl für den Kinderwunsch vieler Menschen eine wichtige Rolle, meint die Schweizer Philosophin und Moderatorin Barbara Bleisch, selbst Mutter zweier Kinder. Sie hat in vielen Publikationen über das Verhältnis von Eltern und Kindern nachgedacht.
Eltern als verkappte Extremisten
Nicht umsonst habe der Philosoph Dieter Thomä einmal geschrieben, "Elternschaft sei etwas für verkappte Extremisten", sagt Bleisch. "Was gibt es Größeres oder extremer Neues als einen neuen kleinen Menschen zu schaffen?" Welche Erfahrungen machen Menschen, die zu Eltern werden, mit dem Neuen, und wie wirkt es auf das Alte zurück? Wird man beim Gebären vielleicht in gewisser Weise selbst wiedergeboren? Und welche Verantwortung tragen wir eigentlich gegenüber dem Neuen?
Die mehr und mehr von Tabus befreite Möglichkeit, über Sexualität und Familienplanung zu sprechen, und die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln tragen dazu bei, dass heute immer mehr Kinder als "Wunschkinder" geboren werden. Dennoch stelle sich die Frage, inwiefern von einer Entscheidung für Elternschaft überhaupt die Rede sein könne, meint die Berliner Philosophin und Publizistin Catherine Newmark.
Was es tatsächlich für das tägliche Leben bedeute, Eltern zu werden und mit Kindern zu leben, könne sich im Vorhinein niemand vorstellen, sagt Newmark, die ebenfalls zweifache Mutter ist. Kinder zu bekommen sei letztlich immer ein Schritt ins Ungewisse, eine "Entscheidung als rationale Abwägung von Gründen und Gegengründen" sei dabei nur eingeschränkt möglich, "weil wie eben keine volle Information über das haben, wofür wir uns entscheiden."
Leben mit Kind: eine transformative Erfahrung
Mehr noch: Werdende Eltern könnten auch nicht vorhersehen, wie das Leben mit Kindern ihre eigene Persönlichkeit verändere, fügt Barbara Bleisch hinzu. Elternschaft sei ein Paradebeispiel für das Phänomen, das die amerikanische Philosophin L. A. Paul als "transformative Erfahrung" bezeichne, sagt Bleisch. "Wir entscheiden uns für etwas, wovon wir nicht wissen, ob wir es mögen werden, und wir wissen nicht, wer wir selber sein werden."

Kindern helfen, das Nest zu verlassen: Barbara Bleisch© Picture Alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt
Barbara Bleisch versteht Geburt und Elternschaft als eine "Erfahrung des radikal Unverfügbaren", die im eklatanten Widerspruch zu dem allgegenwärtigen Bemühen unserer Gesellschaft stehe, Risiken zu vermeiden und zu kontrollieren: Als Eltern könnten wir niemals sicher sein, wie es unserem Kind "nachher in seinem Leben ergehen wird, obwohl wir radikal für dieses Kind verantwortlich sind."
Autonomie und Schwangerschaft
Angesichts der einschneidenden Erfahrungen, die das Leben mit Kindern mit sich bringt, ist es erstaunlich, wie wenig sich die abendländische Philosophie viele Jahrhunderte lang mit Fragen der Schwangerschaft und Geburt beschäftigt hat. So sei die traditionelle Philosophie im Grunde nicht in der Lage, den Zustand der Schwangerschaft gedanklich zu fassen, sagt Catherine Newmark, da er den Status eines autonomen Subjekts eklatant in Frage stelle.
Demgegenüber habe die französische Philosophin Luce Irigaray deutlich gemacht, "dass man im Zustand der Schwangerschaft – für eine Zeitlang zumindest – überhaupt nicht unterscheiden kann zwischen den beiden Wesen, weil sie miteinander verbunden sind und es keinen von dem Körper der schwangeren Frau unabhängigen Fötus gibt und der Leib der Mutter wiederum in diesen Fötus involviert ist." Wie die Subjektivität von werdender Mutter und Embryo unter dieser Voraussetzung neu zu denken wäre, sei noch einiger philosophischer Anstrengung wert, so Newmark.
Interessenkonflikte von Mutter und Fötus
Gerade wenn es um das Recht auf Abbruch einer Schwangerschaft gehe, bewegten sich die Diskussionen bis heute häufig noch in der Tradition der antiken Zeugungslehre des Aristoteles, erklärt Catherine Newmark. Dieser habe die Auffassung vertreten, "dass der Embryo zur Gänze aus dem väterlichen Samen herauskommt". Die Mutter sei dagegen "einfach ausgeblendet" und "als bloße Materie" angesehen worden.

Entscheiden, ohne alles zu wissen: Catherine Newmark© Johanna Ruebel
In philosophischen Debatten um den Beginn des Lebens werde dem Embryo oft vom Moment der Zeugung an bereits ein "Interessen-Status zugesprochen", ergänzt Barbara Bleisch. Dabei werde meist "von vornherein eine Konfliktsituation insinuiert, sodass man dieses Wesen schützen kann – notabene schützen vor dem Zugriffsrecht der Frau", betont Bleisch. "Das ist es, was zum Beispiel die Feministin Antje Schrupp kritisiert hat: Wir müssten sehr viel mehr eben aus Beziehungs-Sicht über diese Menschwerdung nachdenken."
Eine der wenigen Würdigungen von Schwangerschaft und Geburt in der klassischen Philosophie ist der Begriff der "Mäeutik", der Philosophie als "Hebammenkunst", wie sie dem antiken Denker Sokrates zugeschrieben wird: Er habe es verstanden, seinem Gegenüber Erkenntnisse durch geschickte Fragen zu erschließen. In der modernen Philosophie hat Hannah Arendt mit dem Begriff der "Natalität" oder "Gebürtlichkeit" den Gedanken stark gemacht, dass jedes Kind die Chance eines radikalen Neuanfangs verkörpert.
Aufbruch ins Neue: wie Kinder flügge werden
Aber ist diese Utopie des "Alles neu" überhaupt je einlösbar? Erhält nicht jedes Kind eine wegweisende Prägung durch die spezifischen Verhältnisse, in die es hinein geboren wird, und die es sich selbst nicht aussuchen kann? Tatsächlich laste das Alte schwer auf den Schultern jedes heranwachsenden Menschen, räumt Barbara Bleisch ein. "In diesem Spannungsfeld leben wir unser Leben."
Einerseits seien wir in unserer Identität sehr stark unserer Herkunft verpflichtet, "und andererseits wollen wir uns emanzipieren, also vom Einflussbereich der Eltern lossagen. Zu den wichtigsten Aufgaben von Eltern gehöre daher die Aufgabe, "das Neue in unseren Kindern zu sehen und zu nähren und ihnen die Möglichkeit zu geben, flügge zu werden", sagt Bleisch: "Davon zu fliegen, das Nest irgendwann zu verlassen."
In jüngster Zeit wurden aus philosophischen Kreisen auch immer wieder Stimmen laut, die dafür plädieren, gar keine Kinder zu bekommen, denn gerade Kinderlosigkeit sei Ausdruck eines verantwortungsbewussten Verhaltens. Manche "Anti-Natalisten" begründen diese Haltung damit, dass unsere von ökologischer Krise, Hunger, Ungerechtigkeit und kriegerischen Konflikten geprägte Gegenwart gar keine lebenswerte Existenz für kommende Generationen mehr ermögliche.
Abgründe des Anti-Natalismus: Kinder als Klimakiller?
Andere machen im Zeichen der Klimaerwärmung geltend, dass jedes neu geborene Kind die CO2-Bilanz seiner Eltern massiv verschlechtern und die Überhitzung des Planeten noch beschleunigen würde. Dieses Argument weist Barbara Bleisch jedoch entschieden zurück:
"Wenn wir erst einmal beginnen, Kinder nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül zu vermessen, ist eine schiefe Ebene nicht mehr weit, die nachfragt: Welche Kinder lohnen wirklich? Welches Leben ist wirklich lohnenswert? Und auf diese Bahn wollen wir ja wirklich auf gar keinen Fall geraten."
Im Übrigen setze die Sorge um den Fortbestand eines lebenswerten Planeten ja auch die Existenz von Menschen voraus, die in seinem Sinne ethisch handeln könnten, sagt Catherine Newmark:
"Für wen machen wir denn Ethik, wenn nicht für Menschen? Natürlich auch für andere Spezies, vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch für die Natur als Ganze, für den Planeten, aber doch vorwiegend für den Menschen. Und wenn wir den Menschen abschaffen, haben wir das Problem gelöst. Aber dann brauchen wir auch keine Ethik mehr."
(fka)
Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:
Philosophische Utopien und Visionen: Die Kraft gefährlicher Gedanken
Die Welt verändert sich nur durch neue Ideen. Manche von ihnen sind aber so verrückt, dass sie kaum je wahr werden können. Wir brauchen sie trotzdem, kommentiert Andrea Roedig.