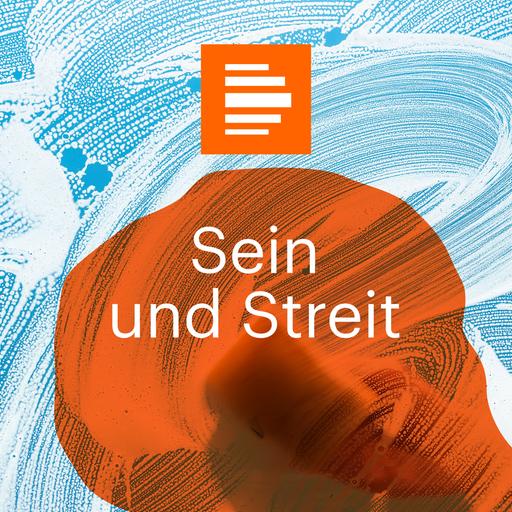Philosophie der Zeitenwende

Trotz all der dunklen Wolken: Gibt es vielleicht auch einen Silberstreif am Horizont? © Getty Images / George Pachantouris
Wie lässt sich Gegenwart denken?
37:21 Minuten

Ukrainekrieg, Energieengpass, Inflation: Die Ereignisse überschlagen sich. Erleben wir gerade eine Zeitenwende? Wenn ja, woran genau können wir sie festmachen? Lässt sich Gegenwart überhaupt denken, und was sagt die Philosophie dazu?
Die Pandemie ist noch nicht überwunden, Klimawende und Demokratiekrise bleiben zwei Dauerbrenner, da brechen schon der Krieg in der Ukraine und die nächste Wirtschaftskrise über uns herein. Der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger beobachtet eine "Verdichtung von verschiedenen Krisen, die gleichzeitig übereinander schwappen".
Am Ende der Nachkriegszeit
Mit dem Tod der Queen steht für Eilenberger die Frage im Raum, ob sich damit „der Nachkrieg als Epoche schließt, weil diese Gestalt 70 Jahre lang eine Konstanz dieser Nachkriegsepisode gebildet hat“.
Weitere Hinweise darauf erkennt Eilenberger in der russischen Teilmobilmachung und im Antisemitismusstreit um die Documenta 15, der Bruchstellen in unserer Erinnerungskultur offenbare: Der Streit habe an den in Deutschland seit Langem bestehenden Konsens gerührt, "dass Auschwitz als singuläres Ereignis ein Zentrum der Selbstbeschreibung bilden sollte".

Walter Benjamins "Engel der Geschichte", inspiriert von Paul Klees Gemälde "Angelus Novus", blickte auf die Trümmer der Geschichte. Vor unseren Augen türmen sich außerdem die Katastrophen-Szenarien einer bedrohlichen Zukunft auf.© picture alliance / Heritage Images / Fine Art Images
Philosophin und Publizistin Simone Miller sieht die Menschheit ebenfalls an der Schwelle eines fundamentalen Wandels: Der Klimawandel und die gegenwärtige Energiekrise machten unmissverständlich klar, dass unsere auf fossile Kraftstoffe gestützte Lebensweise an ein Ende komme.
Aus für das Fortschritts-Credo
Für Miller steht damit ein wesentliches Fundament der bürgerlichen Demokratien in Frage. Das Credo des Fortschritts durch Rationalität und Wachstum, das Versprechen, durch technische Innovationen für immer mehr Menschen ein immer besseres Leben zu ermöglichen, ist unglaubwüdig geworden, betont Miller:
"Wir haben es geschafft, in nur 150 Jahren die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit in existenzielle Gefahr zu bringen", sagt Miller. Ob es unseren westlichen Demokratien gelingen wird, die Transformation zu einer klimaneutralen Lebensweise zu schaffen, sei völlig ungewiss.
Doch wie gut kann Philosophie die Gegenwart eigentlich erfassen? Ist es ihr überhaupt möglich, eine verlässliche Diagnose der eigenen Zeit zu erstellen und einen Epochenbruch als solchen zu erkennen, wenn er sich gerade erst vollzieht?
Hoffnung in düsteren Zeiten
Die Philosophin und Publizistin Catherine Newmark gibt zu bedenken: "Gegenwart hat das Problem, dass sie breit ist, man kann sie nicht fassen. Geschichte hat das Problem, dass sie arm ist: Wir haben zwar mehr den Rückblick, wir können die Entwicklungen sehen im Großen und Ganzen, aber uns fehlen jegliche Art von Details."
Weil es keinen Standpunkt von außen gibt, stellt sich in der Philosophie immer die Frage nach dem Maßstab der Erkenntnis. Zum Beispiel die Frage: Von welchem "Wir" gehen wir aus, wenn wir Gegenwart denken und nach Auswegen aus den drängenden Krisen suchen? Ist dieses "Wir" partikular aufgefasst und zielt auf spezifische Identitäten, oder gehen wir von einem globalen oder universalen "Wir" aus, das in der Lage ist, eine Art Weltgemeinschaft zu stiften?
Neben erkenntnistheoretischen Fragen, geht die Diskussion auch auf die Frage ein, ob die akademische Philosophie in Deutschland dem Anspruch, Gegenwart zu denken, heute gerecht wird oder nicht. Und sie fragt nach philosophischen Ansätzen, die in düsteren Zeiten Hoffnung machen.