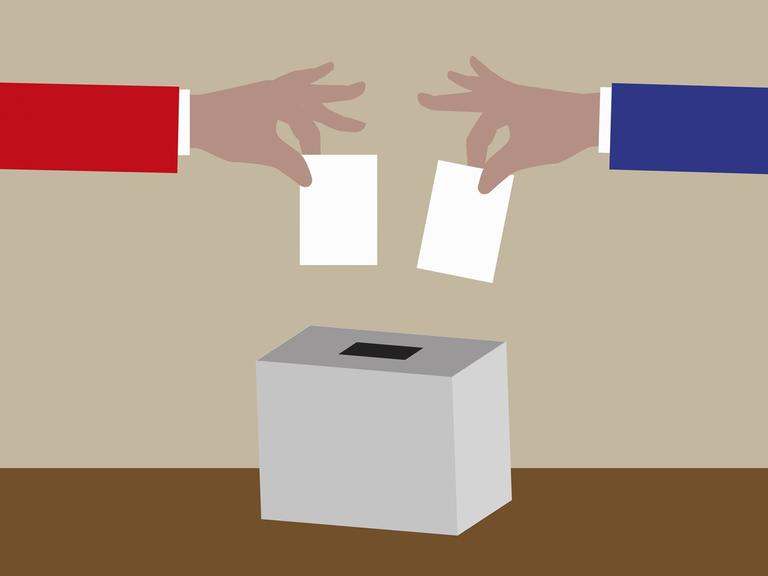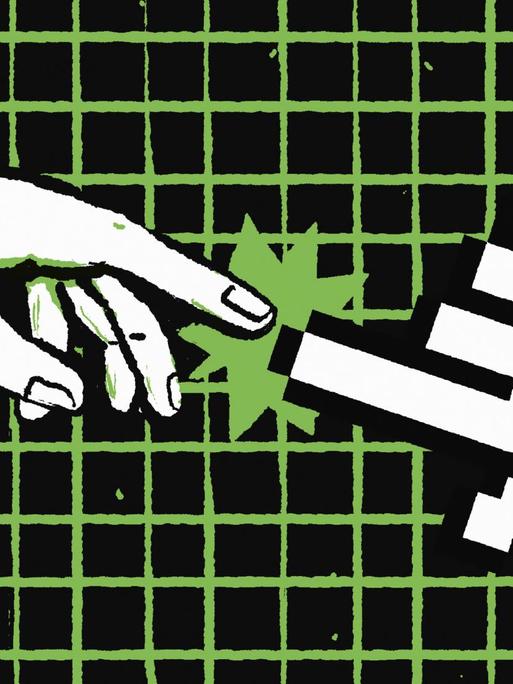Lisa Herzog, Jahrgang 1983, ist Professorin für Philosophie an der Universität Groningen. Bereits ihre Disseration (2011) wurde mehrfach ausgezeichnet. 2016-2019 war sie Inhaberin der Professur für Political Philosophy and Theory an der Hochschule für Politik München. In diesem Jahr erhielt sie den Deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik. Ihr Aufsatz "Politische Demokratie und Wirtschaftsdemokratie" erschien im Sammelband "Die Zukunft der Demokratie" (Dietz-Verlag); zuvor erschien "Die Rettung der Arbeit. Ein Aufruf" (Hanser Berlin).
Demokratisiert die Unternehmen!
29:35 Minuten

Solange die Wirtschaftswelt von demokratischen Prozessen ausgenommen bleibt, ist die Demokratie nicht vollendet. Die Philosophin Lisa Herzog will Arbeitenden mehr Rechte gegenüber den Kapitalgebern einräumen. Denn Macht braucht Kontrolle, sagt sie.
Wenn in der Politik das Prinzip der Demokratie gilt – warum dann nicht auch in der Wirtschaft? Warum können Regierungen, aber keine Manager demokratisch zur Verantwortung gezogen werden? Ist es mit dem Ethos einer demokratischen Gesellschaft vereinbar, dass manche Menschen Macht über andere haben – ohne dass sie von ihnen jemals zur Rechenschaft gezogen werden können?
Ungleichgewichte und demokratische Kontrolle
Die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog von der Universität Groningen wirbt für eine Wirtschaftsdemokratie. Sie will "die Macht-Ungleichgewichte, die in der Wirtschaft herrschen, durch demokratische Kontrolle eindämmen".
Das könne auf verschiedenen Wegen geschehen. Zum Beispiel könnten die Arbeitenden eines Unternehmens in die wirtschaftlichen Entscheidungen einbezogen werden. Das bedeute nicht zwangsläufig, dass es keine Hierarchien mehr gebe. Aber diese sollten – wie auch in der Politik – demokratisch kontrolliert werden. Chefs werden in diesem Modell gewählt und bei Bedarf auch wieder abgewählt.
Genossenschaften und betriebliche Mitbestimmung
Lisa Herzog ermuntert dazu, mit verschiedenen Formen der Wirtschaftsdemokratie zu experimentieren. In Deutschland gebe es bereits reiche und erfolgreiche Erfahrungen - zum einen mit Genossenschaften, zum anderen mit betrieblicher Mitbestimmung. Die Wirtschaftstheorie besage: "Auf dem globalen Markt müssten diejenigen Unternehmen, die rein von der Kapitalseite her betrieben werden, alle anderen im Wettbewerb verdrängen." Das täten sie aber nicht: "Das macht mich optimistisch, dass es in dieser Richtung auch noch weitergehen könnte."
Eine weitere Hoffnung der Vertreter einer Wirtschaftsdemokratie lautet, dass über demokratisch organisierte Unternehmen insgesamt die Beteiligung aller Gesellschaftsschichten wächst. Aktuell ist das politische Engagement in Deutschland sozial sehr ungleich verteilt. Wirtschaftsdemokratie könnte mehr materielle Gleichheit schaffen – und demokratisches Verhalten zu einem "Way of Life" (John Dewey) werden.
(sf)
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Über die Hälfte der Menschen in Deutschland ist unzufrieden damit, wie die Demokratie hierzulande funktioniert. Das besagt eine Studie. Am unzufriedensten sind diejenigen, die sich selbst der Arbeiter- oder Unterschicht zuordnen. - Es gibt verschiedene Ansätze, Ideen, der Demokratie auf die die Beine zu helfen. Über einen hat Lisa Herzog gerade einen Aufsatz veröffentlicht. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Groningen in den Niederlanden. Und sie hat in diesem Jahr übrigens auch den deutschen Preis für Philosophie und Sozialethik gewonnen.
Die Demokratie schwächelt. Das ist kein neuer Befund. Das Stärkungsmittel, das Sie verschreiben wollen, heißt "Wirtschaftsdemokratie". – Was verstehen Sie denn darunter, erstmal ganz grob gesagt?
Lisa Herzog: Ganz allgemein ist damit der Gedanke gemeint, dass auch im wirtschaftlichen Bereich die Prinzipien, die wir im politischen Bereich für die richtigen halten, nämlich demokratische, zum Ausdruck kommen. Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, aber der Grundgedanke ist: Wenn es Macht gibt, die von einigen Personen über andere Personen ausgeübt wird, dann sollen sich diejenigen, die die Macht haben, dafür auch demokratisch zur Verantwortung ziehen lassen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie sind von Haus aus Philosophin und Sozialwissenschaftlerin. Es ist ja erstaunlich, dass Sie sich ins Gebiet der Wirtschaft vorwagen. – Wie sind Sie denn da hingelangt?
Herzog: Ich habe von Anfang an beides studiert und dann auch in der Forschung verfolgt. Und ich bin zu dem Thema Wirtschaftsdemokratie eigentlich indirekt gekommen. Ich habe mich lange mit Märkten beschäftigt und mit der Frage, wie Märkte politisch eingehegt und gestaltet werden können. Dann passierte unter anderem die Finanzkrise und mir ist klar geworden, unser Wirtschaftssystem besteht ja nicht nur aus atomistischen Märkten, wo einzelne Individuen miteinander tauschen, sondern es gibt auch sehr große hierarchische Strukturen, nämlich große Unternehmen. Und in diesen Unternehmen herrschen ganz andere Prinzipien als in Märkten, nämlich klassischerweise Hierarchien.
In meiner Habilitation habe ich mich dann damit beschäftigt, wie man die moralischen Herausforderungen dieser hierarchischen Strukturen verstehen und ihnen besser begegnen kann. Ich habe da mit sehr basalen moralischen Prinzipien angefangen, also, keine Schädigung, gegenseitiger grundlegender Respekt, solche Dinge, und bin dann durch die Beschäftigung mit verschiedenen Phänomenen und Dimensionen von Unternehmen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir versuchen sollten, die Macht-Ungleichgewichte, die in der Wirtschaft herrschen, durch demokratische Kontrolle einzudämmen.
In Deutschland ist das ja auch schon einigermaßen angelegt in der Praxis vieler Unternehmen, als wir Betriebsräte haben, als wir Arbeitnehmermitbestimmung in den Aufsichtsräten haben. Also, wir haben gar nicht den "reinen" Kapitalismus wie ihn die Lehrbücher beschreiben, sondern haben eigentlich eine Mischform. Und die Frage ist, ob man das nicht noch weiter vorantreiben könnte.
Demokratie als "Way of Life"
Deutschlandfunk Kultur: Da gäbe es jetzt viele Ansatzpunkte nachzufragen, ich bleibe erst mal auf dem einen Gleis. Denn wenn ich Ihren Aufsatz richtig verstanden habe, dann sind Sie nicht nur interessiert an einer Wirtschaftsdemokratie, weil Sie eben finden, dass auch Unternehmen demokratischer organisiert sein sollten, sondern weil Sie sich davon Effekte für die gesamte Demokratie erhoffen. Diese Studie, die ich eingangs zitiert habe, die ist übrigens von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben, spricht davon, dass die Menschen unzufrieden sind mit dem Funktionieren der Demokratie, nicht mit der Staatsform Demokratie an sich. Die hat weiterhin die höchsten Zustimmungswerte.
Aber was könnte daran eine Wirtschaftsdemokratie ändern?
Herzog: Es gibt verschiedene Hypothesen, was für positive Effekte sich ergeben könnten, wobei ich gar nicht sagen will, dass das die alleinseligmachende, alleinige Richtung ist, in die man gehen soll. Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Aber wir reden ja jetzt über Wirtschaftsdemokratie und ich gehe mal auf die zwei wichtigsten Mechanismen ein.
Das eine ist, dass wir sehr hohe soziale Ungleichheit haben. Soziale Ungleichheit geht oft auch damit einher, wie unterschiedlich das politische Engagement ist. Jemand, der sehr wenig verdient, deswegen möglicherweise noch einen Nebenjob braucht, hat vielleicht gar nicht die Möglichkeit, sich politisch sehr stark einzubringen. Wir haben in Deutschland noch ziemlich starke Habitus-Unterschiede zwischen verschiedenen Schichten. Die Hoffnung wäre, dass durch eine Wirtschaftsdemokratie einfach generell mehr Gleichheit, auch mehr materielle Gleichheit, herbeigebracht werden könnte.
Ein zweiter Punkt ist aber mindestens genauso wichtig: Da bin ich unter anderem von John Dewey inspiriert, dem amerikanischen Pragmatisten, der davon sprach, dass Demokratie eigentlich "a way of life", also eine Lebensform sein soll, die wir in unterschiedlichen sozialen Sphären einüben und wo wir die Art und Weise, wie wir als Demokraten miteinander umgehen, einüben können und lernen, was es bedeutet, mit anderen zu diskutieren, Kompromisse zu finden, auch mal eine Kampfabstimmung zu haben. Die Vorstellung ist, wenn wir das in unserem Alltag ständig erleben würden, es uns dann auch leichter fallen würde, uns politisch im klassischen Sinne demokratisch einzubringen.
Was wir derzeit beobachten, ist ja, dass demokratische Mitwirkung sehr stark von bestimmten Berufsgruppen ausgeht. Im Bundestag sitzen klassischerweise zum Beispiel sehr viele Juristen und auch generell sehr viele studierte Leute. Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass man in bestimmten Berufen und mit einer bestimmten Ausbildung viel besser in die Lage versetzt wird, diese diskursiven Methoden, diese Art zu diskutieren, mit schriftlichen Vorlagen umzugehen usw. einzuüben als in anderen Berufen. Die Hoffnung der Wirtschaftsdemokratie-Vertreter lautet, wenn das weiter ausgeweitet würde, dass dann auch die demokratische Beteiligung in alle Gesellschaftsschichten hinein erreicht werden könnte.
Deutschlandfunk Kultur: Aber das ist nur eine Hoffnung. Dafür gibt es keine empirischen Belege, oder?
Herzog: Das ist schwierig empirisch zu belegen, weil es ja kein Land gibt, in dem wir eine durchgehende Wirtschaftsdemokratie, so wie sie in der Diskussion verstanden wird, haben. Deswegen ist es in dem Sinne eine Hypothese. Das Problem ist natürlich: Wie können wir anhand von einzelnen Beispielen etwas verstehen, was letztlich die Systemfrage stellt. Also, wo es darum geht, wie sich ein System insgesamt verändern kann.
Der Arbeitsmarkt ist kein Markt wie jeder andere
Deutschlandfunk Kultur: Was sich auf jeden Fall empirisch belegen lässt, ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und politischem Engagement.
Ich hatte im Sommer hier in Tacheles ein Gespräch mit dem Politologen Armin Schäfer, in dem es um die Schieflage der Demokratie ging. Wir haben eine sozial ungleiche Wahlbeteiligung: Es sind die sozial Privilegierten, die wählen gehen, die wiederum sozial Privilegierte wählen, eben die Akademiker - Sie sprachen das an -, in manchen Fraktionen sitzen nur noch Akademiker. Und die machen dann wiederum Gesetze für die sozial Privilegierten.
Aber jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an mit der Wirtschaftsdemokratie. Wir sind es in der westlichen Welt gewohnt, dass die politischen Systeme demokratisch organisiert sind, demokratisch kontrolliert werden, die Ökonomie aber nicht, also dass die hierarchisch organisiert ist. Da ist ein Chef oder eine Chefin - und die bestimmen. Im Rahmen von Recht und Gesetz entscheiden die Eigentümer oder die Manager über die Unternehmenspolitik.
Herzog: Ja, wir sind sehr gewohnt, von diesem Modell auszugehen, dass die Politik demokratisch die Rahmenordnung setzt. Und innerhalb dieser Rahmenordnung können die einzelnen Akteure für sich frei entscheiden und ihre Gewinne maximieren oder ihren eigenen Nutzen maximieren als Konsumentinnen und Konsumenten. Und der Markt regelt das dann irgendwie.
Deutschlandfunk Kultur: Und das Recht.
Herzog: Genau. Das Recht wird von der demokratischen Politik gesetzt. Derzeit ist der Rechtsrahmen so, dass den Eigentümern von Unternehmen relativ viel Macht zugestanden wird.
Allerdings gehört zu diesem vorherrschenden Bild auch die Vorstellung, dass Arbeitende - also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer -, wenn ihnen etwas an den Entscheidungen ihrer Unternehmen nicht gefällt, einfach den Job wechseln können. Diese Vorstellung davon, wie Unternehmen funktionieren, kommt aus der amerikanisch geprägten Mainstream-Ökonomie. Die Vorstellung lautet: Ich kann mir im Laden aussuchen, welche Obst- und Gemüsesorten ich kaufe. Und auf dem Arbeits-"Markt" kann ich mir aussuchen, welchen Job ich habe.
Das ist ein Modell, das der Lebensrealität einer großen Zahl von Menschen überhaupt nicht entspricht. Die sind auf ihren Job angewiesen. Die können sich vielleicht überlegen, einen anderen Job in einer anderen Firma zu finden. Aber da sind die Hierarchien oft genauso geprägt. Deswegen ist dieses Argument, dass der Arbeitsmarkt ein Markt wie jeder andere sei, schon mal problematisch.
Und dann lautet die Frage: Könnten wir nicht die Regeln für Unternehmen auch so gestalten, dass es mehr Mitspracherechte für diejenigen gibt, die da die Arbeit machen?
Und die Spannung, die dann sofort aufgeworfen wird, ist immer die mit den Eigentumsrechten der sogenannten Eigentümer der Unternehmen. Ich sage der "sogenannten", weil man unterscheiden muss zwischen unterschiedlichen Rechtsformen von Unternehmen. Ein kleiner Familienbetrieb ist strukturell gesehen einfach was sehr anderes als eine große Aktiengesellschaft.
Hierarchien begünstigen Missbrauch
Deutschlandfunk Kultur: Ich habe trotzdem noch nicht verstanden: Was spricht denn Ihrer Ansicht nach gegen Hierarchien in der Wirtschaftswelt?
Herzog: Oh, da könnte ich jetzt ganz viele Dinge anführen. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass wir Hierarchien komplett abschaffen könnten, einfach weil wir oft für die Koordination der Arbeitsschritte unterschiedlicher Menschen Hierarchien brauchen.
Aber gegen unkontrollierte Hierarchien spricht zum Beispiel, dass es sehr viel Missbrauchspotenzial gibt. Es stellt sich auch die Frage: Ist es mit den Werten, mit dem Ethos einer demokratischen Gesellschaft vereinbar, dass manche Leute Macht über andere haben, für die es keinerlei Möglichkeit gibt, sie dafür zur Verantwortung zu ziehen, wie sie mit dieser Macht umgehen?
Es gibt auch funktionale Gründe, wieso Hierarchien problematisch sein können. Zum Beispiel können Hierarchien sehr schädlich sein, wenn es darum geht, dass man Feedback von unten braucht. Es gibt im Englischen diesen schönen Spruch: "The boss only gets the good news", also, beim Chef oder der Chefin kommen nur die guten Nachrichten an.
Wenn ich zum Beispiel im Unternehmen viel Veränderung haben, zum Beispiel durch neue Technologien, dann muss ich das Wissen aller Beteiligten einbringen können in diesen Prozess. Dann können Hierarchien auch aus einer ganz funktionalen, sozusagen rein effizienzbasierten Logik heraus problematisch sein.
Die Kompetenz der Betroffenen
Deutschlandfunk Kultur: Die Verfechter von Hierarchien sagen gerade für solche Fälle das Umgekehrte voraus. Finn-Rasmus Bull, ein Soziologe von der Uni Heidelberg sagt zum Beispiel: "Disruption braucht Hierarchie", also Entscheidungen, die Altes über Bord werden und Neues wagen. Denn das würden die Beteiligten von sich aus nicht machen.
Mir ist aus meinem eigenen beruflichen Erfahrungsfeld eingefallen: Ich glaube, dass nicht viele Zeitungsjournalisten zum Beispiel freiwillig Online-Journalisten geworden sind.
Also, für grundlegende Veränderungen, lautet die These, braucht es jemanden, der das von oben bestimmt und sagt: "Da müsst ihr durch!"
Herzog: Ich sehe das Argument und ich sehe auch, dass es viele Phänomene gibt, die man aus der eigenen Erfahrung anführen könnte, wieso das plausibel erscheint. Ich bin trotzdem nicht ganz sicher, ob’s immer stimmt. Hier sind zwei Argumente, wieso es doch vielleicht anders sein könnte.
Eines ist: Die Modelle von Wirtschaftsdemokratie, die im Moment in der Philosophie diskutiert werden, gehen davon aus, dass es weiterhin Märkte geben wird. Das heißt, Unternehmen werden weiterhin auch auf Märkten um die Gunst der Kunden konkurrieren, vielleicht nicht in allen Branchen, so wie wir das derzeit haben, und besser reguliert usw., aber es gibt weiterhin Märkte. Dann kann man sich ja vorstellen, dass diejenigen, die zum Beispiel in einer Zeitungsredaktion arbeiten, durchaus sehen, wo der Hase hin läuft, und vielleicht sogar erkennen, dass sich was ändern muss. Das ist das eine.
Das andere ist: Ich hatte ja schon gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen Hierarchien, aber ich bin gegen Hierarchien, bei denen es keinerlei Schutzmechanismen und keinerlei accountability, wie es Englischen so schön heißt, gibt. Auch ein gewählter Chef kann vielleicht Dinge durchsetzen.
Natürlich kann man sich fragen: Wer ist sozusagen der bad cop, der die schlechten Nachrichten überbringt, die harten Entscheidungen trifft? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, dass diejenigen, die selber betroffen sind, dazu überhaupt nicht in der Lage wären – vor allem, wenn ihnen klar ist, es gibt da einen Markt, es gibt eine Wirklichkeit da draußen. Und es stehen unsere eigenen Jobs auf dem Spiel.
Hierarchie braucht Kontrolle
Deutschlandfunk Kultur: Das sind verschiedene Modelle. Das eine ist, es gibt basisdemokratische Entscheidungsprozesse und dann auch Entscheidungen, die von allen gefällt und dann vielleicht auch getragen werden. Das andere ist: Wir haben eine gewählte Chefin, die dann alle vier Jahre zur Verantwortung gezogen wird und neu gewählt wird - oder nicht. Das ist dann so wie mit der Bundeskanzlerin, die nun nicht direkt gewählt wird. Ich weiß nicht, ob sich da so viel ändern würde.
Herzog: Es würde sich in den Unternehmen, wo die Dinge einigermaßen gut laufen bei diesem repräsentativen Modell vielleicht nicht so viel ändern. Aber da, wo die Dinge schlecht laufen, gäbe es die Möglichkeit, Chefs, die in eine komplett falsche Richtung laufen, abzuwählen.
Das ist so ein Minimalstandard. Der wird auch von bestimmten Demokratietheorien so ähnlich für die Politik verwendet: dass man zumindest schlechte Führungsgruppen abwählen kann. Das wäre für manche wirtschaftliche Unternehmen vielleicht schon eine ganze Menge.
Deutschlandfunk Kultur: Die Frage ist dann: Was sind schlechte Führungsgruppen? Ich denke jetzt auch an internationalen Wettbewerb. Die Ansichten darüber, wer eine schlechte Führungsperson ist, gehen ja auseinander. Ist eine gute Führungsperson jemand, dessen Team sich sehr wohl fühlt, aber das Unternehmen macht Verluste? Oder ist eine gute Führungsperson diejenige, die leider die Hälfte der Belegschaft rausschmeißt, aber Gewinne macht? Von wem sollte die dann wiedergewählt werden?
Herzog: Sie wollen jetzt wahrscheinlich auf den Punkt hinaus, dass immer die Frage nach den internationalen Kapitalmärkten im Hintergrund steht.
Erstmal geht’s drum, dass diejenigen, die selber die Arbeit machen, sehen, wie die Person agiert. Schlecht kann auch heißen, dass jemand einfach vom Geschäft wenig versteht und irrationale, eitle, manchmal sogar narzisstische Entscheidungen trifft. Darauf könnten sich dann die Kapitaleigner und die Arbeitenden vielleicht sogar einigen in manchen Fällen.
Wenn man das ausschließt, gibt’s natürlich die Frage: Wessen Interessen sollen gewinnen? Und es gibt unterschiedliche Modelle, wie man damit umgehen kann. Eines finde ich sehr sehr interessant für große Aktiengesellschaften, das ist ein repräsentatives Modell. Es kommt von Isabelle Ferreras, einer belgischen Soziologin, die vorgeschlagen hat, man könnte mit einem Zweikammer-System arbeiten: eine Kammer für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine für die Anteilseignerinnen und Anteilseigner.
Deutschlandfunk Kultur: Oberhaus und Unterhaus.
Herzog: Genau, so was in diese Richtung. Und die müssten sich dann jeweils einigen. Damit würde ein gewisser Interessensausgleich sichergestellt.
Basisdemokratie in Unternehmen
Deutschlandfunk Kultur: Bevor wir auf die zwei Kammern zu sprechen kommen, die mich sehr an die Montan-Mitbestimmung erinnern, zur Basisdemokratie.
Gemeinsame Entscheidungsfindung dauert länger. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und es besteht auch die Gefahr, dass Entscheidungen der Belegschaft eher mit Rücksicht auf die Belegschaft gefällt werden. Nur, ein Unternehmen will im Allgemeinen Gewinn machen und muss sich an den Kunden, an den Wünschen der Umwelt orientieren - und nicht an den Wünschen der Belegschaft.
Herzog: Wenn wir davon ausgehen, dass wir so ein gemischtes Modell haben, in dem es Märkte gibt und innerhalb der Unternehmen demokratische Strukturen, dann weiß ja auch die Belegschaft, dass sie sich an den Interessen von Kundinnen und Kunden orientieren muss. Andererseits kann man sich auch die Frage stellen, vielleicht je nach Branche, je nach Bereich, ob nicht für manche Formen von Unternehmen oder auch Public Private Partnerships bestimmte Kundengruppen - oder zum Beispiel beim Krankenhaus Patientengruppen - mit in die Gruppe derjenigen aufgenommen werden sollten, die demokratisch Entscheidungen treffen. Das ist die eine Sache.
Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, ist: Dauert das nicht alles viel zu lange? Ist es nicht zu aufwendig?, usw. Ich denke, es gibt mindestens zwei Antworten. Die eine ist, dass langwierige Entscheidungen oft auch die besseren Entscheidungen sind, wenn wirklich alle Perspektiven mit eingebunden sind, so dass die Umsetzung später entsprechend effizienter ist, weil man schon unterschiedliche Dinge vorher diskutiert, vorher abgeklopft hat. Man muss ja immer den gesamten Prozess sehen, nicht nur: wie komme ich von der Herausforderung zu einer Entscheidung, sondern auch, wie passiert danach die Umsetzung und ist die erfolgreich? Wenn man das zusammen betrachtet, dann stellt sich die Frage, ob Prozesse, die die Betroffenen stärker mit einbinden, nicht insgesamt gesehen effizienter sind.
Der zweite Teil einer Antwort ist, dass uns die Technik möglicherweise auch Hilfestellungen bieten kann. Denn es gibt inzwischen sehr viele interessante digitale Tools, die man dafür einsetzen kann, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, aber doch schneller, als wenn alles über Papier oder in Meetings gemacht werden muss. Zum Beispiel kann man online abstimmen, Texte können online schnell kommentiert werden, Präferenzäußerungen online gesammelt werden – da gibt’s wirklich interessante Möglichkeiten.
Viele Unternehmen experimentieren derzeit ja auch mit solchen Ansätzen. Die tun das nicht unbedingt, weil sie basisdemokratisch sein wollen, sondern weil sie glauben, dass das effizient sein kann. Aber möglichweise ist das auch eine "List der Vernunft", mit Hegel gesprochen, dass darüber auch Praktiken etabliert werden und man Erfahrungen sammeln kann, die dann auch anders verwendet werden könnten.
Genossenschaft statt Zeitvertrag
Deutschlandfunk Kultur: Wir haben die Frage der Verantwortung noch gar nicht angesprochen. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es immer mehr Freelancer, also Menschen, die auf Honorarbasis arbeiten. Es gibt immer mehr befristete Verträge. Ich würde spontan denken, das passt nicht besonders gut zur wirtschaftlichen Mitbestimmung.
Wer trägt denn die Risiken der getroffenen Entscheidungen, wenn diejenigen, die zum Beispiel für eine riskante Strategie votiert haben, das Unternehmen schon längst wieder verlassen haben?
Herzog: Das stimmt. Das ist ein Problem. Aber ich glaube, dass wir uns generell mit dieser Frage, was heutzutage noch Arbeitsverträge sind und wie langfristig sie gestaltet sind, in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Denn wenn wir in eine Situation hineineinlaufen, in der immer mehr Leute nur noch auf Honorarbasis vollkommen unplanbar beschäftigt sind, dann ist das für Demokratie, glaube ich, auf viele Weisen problematisch.
Aber ich denke, dass es da Modelle geben kann, dass zum Beispiel diejenigen, die über Plattformen an bestimmten Dingen zusammen arbeiten, dass die zum Beispiel genossenschaftlich solche Plattformen betreiben. Es gibt das Modell des platform cooperativism aus den USA. Wenn wir zum Beispiel eine Plattform für Putzdienstleistungen haben, dann sollen die Daten nicht irgendeinem anderen Unternehmen gehören. Dann sollten auch die Regeln nicht von einem anderen Unternehmen bestimmt werden. Und die Gewinne sollen auch wirklich an diejenigen gehen, die die eigentliche Arbeit machen.
Und deswegen ist das ein Modell, das ich sehr, sehr spannend finde, man sagt: Lasst uns versuchen, eine eigene Genossenschaft zu haben. Und dann sind die Risiken auch wieder internalisiert sozusagen.
Gefragt sind Phantasie und Experimente
Deutschlandfunk Kultur: Genossenschaften gibt es ja bereits, in Deutschland haben sie auch eine recht lange Tradition. Die Mitglieder einer Genossenschaft sind zugleich die Eigentümer und auch die Kunden der Genossenschaft. Aber, Frau Herzog, warum kann ich mir Amazon oder auch Mercedes nicht als Genossenschaft vorstellen?
Herzog: Wahrscheinlich, weil da der Kapitalbedarf doch erheblich ist und die Frage ist, ob das leistbar wäre. Ich kann mir das auch nicht gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir, wenn wir über Wirtschaftsdemokratie reden, davon ausgehen sollten, dass es ein Modell gibt, das für alle Firmen in allen Branchen, mit allen Größen gleichermaßen passt, sondern da kann es unterschiedliche Ansätze geben. Ich glaube, dass sehr viele Modelle besser wären als vieles von dem, was wir derzeit sehen.
Bei einem Unternehmen wie Amazon wäre ein Zweikammersystem gut vorstellbar. Bei einem Unternehmen wie Facebook wäre die Frage, ob man nicht neben den Angestellten auch die Nutzer mit einbinden müsste. Denn sie sind ja diejenigen, die auf der Plattform aktiv sind, durch die Geld verdient wird. Da brauchen wir institutionelle Phantasie, um uns vorstellen zu können, wie unterschiedliche Formen aussehen könnten.
Und ich glaube, wir brauchen auch Experimente mit unterschiedlichen Modellen, weil man sich zwar theoretisch alles überlegen kann, aber wie es dann in der Praxis läuft, das kann man doch nicht alles vorher antizipieren.
Vorbild Montan-Mitbestimmung
Deutschlandfunk Kultur: Es gibt ja schon einige Erfahrungen, wie gesagt, in Deutschland das ganze System von betrieblicher und Unternehmens-Mitbestimmung. Und die einzige Form, die Ihren Vorstellungen von einer echten wirtschaftlichen Mitbestimmung entspricht, ist die Montan-Mitbestimmung, also die für die Kohle- und Stahlindustrie.
Herzog: Die gibt’s immer weniger.
Deutschlandfunk Kultur: Genau. 0,2 Prozent aller Beschäftigten arbeiten da noch. Dort gibt im Grunde genommen das Zweikammersystem. Da sitzen gleich viele Vertreter von – Sie würden sagen – Kapital und Arbeit im Aufsichtsrat zusammen und entscheiden. Und den Vorsitz hat eine neutrale Person inne, nicht wie bei den anderen Aktiengesellschaften.
Heute nur noch 0,2 Prozent aller Beschäftigten, aber es waren ja mal mehr. Sind eigentlich die Erfahrungen dieser Montan-Mitbestimmung jemals ausgewertet worden? Wissen Sie das?
Herzog: Ich weiß spontan von keiner Studie, die sich genau mit diesem Aspekt beschäftigt, was nicht heißt, dass es die nicht gibt. Denn das wird in verschiedenen Disziplinen behandelt. Ich habe versucht viel zu lesen, aber ich habe wahrscheinlich nicht alles gelesen. Aber eine Sache ist schon interessant, und zwar die, dass nach der reinen Lehrbuchökonomie das, was in der Montan-Industrie stattgefunden hat, und auch das, was in der – sagen wir – "normalen deutschen Mitbestimmung" stattfindet, dass es nämlich zumindest einen gewissen Anteil an Arbeitnehmermitbestimmung gibt, eigentlich nicht stattfinden dürfte.
Die Theorie sagt: Auf dem globalen Markt müssten diejenigen Unternehmen, die rein von der Kapitalseite her betrieben werden, alle anderen im Wettbewerb verdrängen. – Das tun sie nicht! Das macht mich optimistisch, dass es in dieser Richtung auch noch weitergehen könnte.
Wo stehen die Gewerkschaften?
Deutschlandfunk Kultur: Wir sollten aber auch nicht vergessen zu sagen, dass Betriebsräte in Deutschland nur Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte bei sozialen und personellen Angelegenheiten haben. Sie haben kein Mitspracherecht bei den wirtschaftlichen Fragen, bei unternehmerischen Fragen, bei ökonomischen Entscheidungen. Und in Großunternehmen ab 2.000 Beschäftigte ist die Hälfte des Aufsichtsrates mit Arbeitnehmern besetzt, aber im Konfliktfall entscheidet der Aufsichtsratsvorsitzende oder die und die kommt eben von der Kapitalseite.
Aber wo Sie das so optimistisch stimmt, Frau Herzog, dann müssten Ihre natürlichen Verbündeten ja eigentlich die Gewerkschaften sein.
Herzog: Ja. Ich glaube, dass viele in den Gewerkschaften auch in so eine Richtung denken. - So wie ich es geschildert habe, geht die Nutzung neuer Technologien mit einem gewissen Optimismus einher. Aber es gibt natürlich auch sehr viele potenzielle Gefahren bei der Nutzung neuer Technologien, unter anderem den Datenschutz der Arbeitenden.
Mein Eindruck ist, dass in den Gewerkschaften die negativen Seiten oft sehr viel stärker gesehen werden als die positiven, gerade, wenn es um neue Arbeitsformen geht, die mit Flexibilität einhergehen. Da lautet die Frage: Was sehen die Gewerkschaften als positiv und was sehen sie eher als Gefahr?
Deswegen organisieren sich die Angestellten mancher neuer Unternehmensformen komplett jenseits der klassischen Gewerkschaftsarbeit. Und diese unterschiedlichen Stränge müssten, glaube ich, wieder zusammengeführt werden, damit diejenigen, die zum Beispiel in irgendwelchen Onlinegruppen sich für die Fahrer von Fahrdiensten organisieren, auch den Status und die Rechte von Gewerkschaften bekommen können.
Deutschlandfunk Kultur: Aber ich weiß gar nicht, ob die Frage der verschiedenen Online-Tools so entscheidend ist. Gut, man kann leichter in Kontakt treten, man muss die Leute nicht per Brief einladen zu irgendwelchen Treffen. Aber ist das wirklich die Hürde, um die es geht?
Herzog: Es ist das Gegenargument gegen einen Einwand, den Sie vorhin auch angeführt haben, nämlich, dass demokratische Verfahren immer zu aufwendig und zu langwierig wären.
Es geht um Machtfragen
Deutschlandfunk Kultur: Aber da geht’s um die Entscheidungsfindung. Und ich glaube nicht, dass die Frage ist, mache ich jetzt ein Kreuz auf einem Zettel oder doodele ich und gebe da mein Votum ab, sondern es geht ja trotzdem darum, dass Menschen im Idealfall ins Gespräch kommen und miteinander überlegen: Was ist jetzt die bestmögliche Lösung?
Herzog: Das stimmt. Ich wollte auch gerade sagen, es geht nicht nur um diese Instrumente, aber wir sollten auch nicht übersehen, was da positiv möglich ist. Letztlich geht’s um Machtfragen. Diese Machtfragen werden nicht allein durch irgendwelche digitalen Innovationen entschieden werden, sondern das ist letztlich eine Frage von politischem Kampf, politischer Auseinandersetzung. Wo wollen wir mit der Arbeitswelt hingehen?
Derzeit sehen wir sehr viele divergente Bewegungen. Man sieht auch, wenn Leute zum Beispiel auf solchen Plattformen als Freelancer arbeiten, dass sie sich dann vielleicht irgendwie austauschen in irgendwelchen Online-Foren, sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen, aber dass nicht die Art von Solidarität entsteht, die historisch in den großen Arbeitskämpfen immer enorm wichtig war. Das dürfte eine der ganz großen Herausforderungen sein, wie es gelingen kann, in einer sehr viel fragmentierteren Arbeitnehmerschaft die Art von Solidarität zu erzeugen, die dann bei politischen Kämpfen wirkmächtig werden könnte. Das ist sicher eine der ganz großen Fragen hier.
Ist Mitbestimmung wirklich gewollt?
Deutschlandfunk Kultur: Der soziale Zusammenhalt, der durch Arbeit gestiftet wird - darum geht es ja auch in Ihrem Buch "Rettung der Arbeit".
Noch einmal kurz zurück zu den Gewerkschaften. Ich habe immerhin gefunden, dass der Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di vor vier Jahren einen Beschluss zur Wirtschaftsdemokratie gefasst hat. Da steht auch drin: Wir leben nur in einer halben Demokratie. Und: die Demokratie darf nicht vorm Werkstor Halt machen. Dieser Antragt wurde dann angenommen als "Material zur Weiterleitung an den Bundesvorstand". Seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Modelle hin oder her, man kann festhalten: Demokratie lebt von Teilhabe. – Was macht Sie denn sicher, dass die Beschäftigten mehr Mitsprache am Arbeitsplatz wollen?
Herzog: Das ist eine gute Frage. Die Hauptkritik, die mir oft entgegenschlägt, ist: "Die Leute wollen einfach nur ihren Job machen und dann wieder heim gehen." – Ich glaube, dass wir Modelle brauchen, in denen es für Leute - vielleicht auch nur für bestimmte Phasen ihres Lebens - okay ist, wenn sie ihren Job machen und dann heimgehen und sich zum Beispiel um die Familie oder Hobbys oder ein politisches Amt in der Freizeit kümmern. Aber ich glaube, dass es nicht generell stimmt, dass Menschen überhaupt nicht mitreden wollen. Denn es geht schließlich um die ganz alltäglichen Strukturen ihrer Arbeit. Da verbringen sie acht Stunden oder mehr täglich. Da kennen sie sich auch aus. Das heißt, da können sie sich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein einbringen, denn sie wissen, wovon sie reden.
Manchmal frage ich mich, ob diese Haltung, "die Leute wollen einfach nur ihren Job machen", nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Wenn die Leute jahrelang erleben, dass sie sich nicht einbringen können, zumindest in bestimmten Jobs, dann resignieren sie vielleicht, werden zynisch. Und dann heißt es, die Leute würden sich nicht einbringen wollen.
Aber wenn man ihnen die Gelegenheit gäbe, dass es wirklich Wirkung hat sich einzubringen, dass das nicht nur in irgendwelchen Papieren steht und dann in Schubladen landet, sondern dass es wirklich Veränderungen bringen kann, dann könnte das, glaube ich, bei sehr vielen Leuten die Motivation stärken.
Deutschlandfunk Kultur: Ja, es ist ein schwieriger Kreis. Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, erhoffen Sie sich von der Wirtschaftsdemokratie eine Belebung der Demokratie insgesamt. Und die Wirtschaftsdemokratie wiederum braucht eine lebendige Demokratie als Voraussetzung.
Herzog: Das stimmt. Ja.
Hilfe für demokratische Firmen
Deutschlandfunk Kultur: Gibt es denn irgendwo auf der Welt Beispiele für eine gelingende Wirtschaftsdemokratie, die über Startups mit dreißig Mitarbeitern hinausgeht?
Herzog: Ein Beispiel, das in der Diskussion sehr oft angebracht wird - keine komplette Wirtschaftsdemokratie, aber doch sehr eindrucksvoll - ist die Mondragón Genossenschaft im Baskenland, die dort eine ganze Reihe von Betrieben mit Zehntausenden von Beschäftigten betreibt.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Wie viel besser ist es wirklich? Aber gibt es nicht diese Struktur, dass irgendwelche internationalen Unternehmen von der Arbeit, die vor Ort gemacht wird, die Gewinne abschöpfen und irgendwo hinbringen, sondern das Geld bleibt vor Ort und kann die lokale Wirtschaft wieder ankurbeln.
Deutschlandfunk Kultur: Aber es scheinen doch – zumindest bisher – alle Beispiele, Modelle, die es gibt, immer nur auf einer lokalen Ebene zu funktionieren, also nicht für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen.
Herzog: Jein. Zumindest diese Genossenschaften und auch viele deutsche Genossenschaften stehen durchaus im Wettbewerb. Es stimmt, dass es bisher eher kleine Nischen sind. Und die Frage ist dann natürlich auch: Gibt’s systematische Hindernisse dafür, dass solche Unternehmen eher klein bleiben? Oder liegt’s dran, dass wir derzeit in einem System leben, in dem andere Firmenformen dominieren? Müsste man vielleicht demokratischeren Firmen eine Art Anstoß geben, zum Beispiel durch Steuernachlässe, damit mehr Unternehmen sich in demokratische Firmen umwandeln könnten? Da gibt’s unterschiedliche Erklärungsansätze. Vielleicht müssten sich auch die Kapitalmärkte stärker verändern.
Aber ich halte es durchaus für vorstellbar, dass weite Teile des Wirtschaftssystems von unterschiedlichen Formaten demokratischer Firmen bestritten werden.