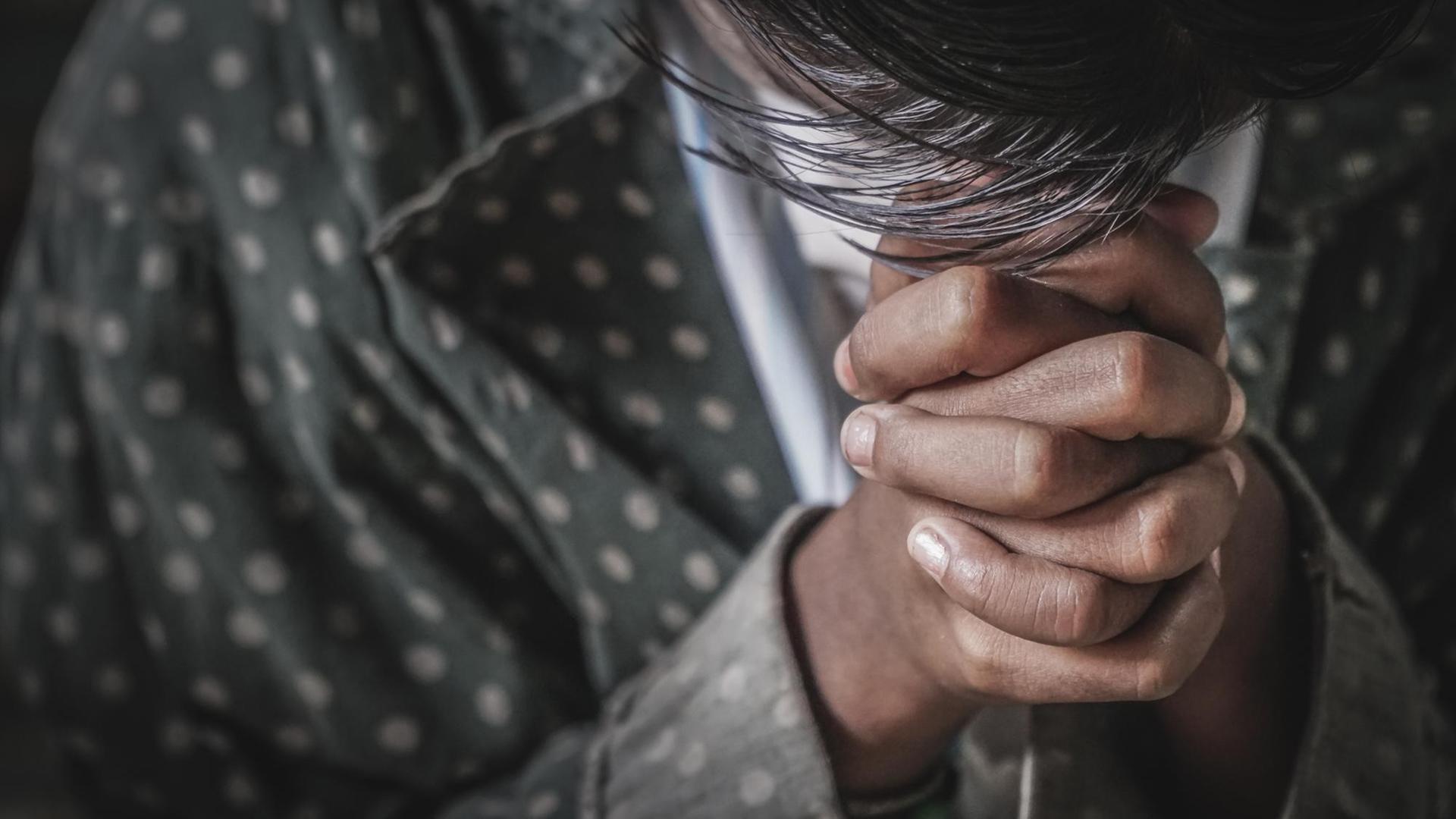Wie soll ich das nur verzeihen? Diese Frage stellen sich viele von uns im Laufe ihres Lebens. Etwa wenn wir uns von einem geliebten Menschen hintergangen oder im Stich gelassen fühlen. Oft geben uns andere dann den Rat, zu verzeihen – um innere Ruhe zu finden und mit einer Sache abzuschließen, in der wie selbst vielleicht im Zorn einen Schritt zu weit gegangen sind und zu hart geurteilt haben. Aber ist das wirklich immer der beste Weg? Haben wir manchmal nicht sogar die Pflicht, hart zu bleiben? Was ist zum Beispiel, wenn das Gegenüber keinerlei Reue zeigt?
Mit diesen Fragen hat sich Susanne Boshammer beschäftigt, Professorin für Philosophie an der Universität Osnabrück. In ihrem Buch: "Die zweite Chance. Warum wir (nicht alles) verzeihen sollten" nennt sie verschiedene Gründe dafür, weshalb wir dem Impuls zu verzeihen nicht in jedem Fall nachgeben sollten.
Eine Frage der Selbstachtung
"Ich glaube, beim Verzeihen geht es nicht nur darum, dass man wieder mit sich ins Reine kommt und dass man seine Wut hinter sich lässt", sagt Boshammer. "Wenn wir jemandem verzeihen, erlauben wir dem anderen, dass er sich das, was er uns angetan hat, nicht mehr zum Vorwurf macht. Wir helfen ihm oder ihr also gewissermaßen dabei, das eigene Gewissen zu entlasten. Und ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen wir das nicht tun sollten oder jedenfalls nicht zu voreilig."
Susanne Boshammer forscht zu Ethik und Politischer Philosophie an der Universität Osnabrück.© Susanne Boshammer
Für die Frage, ob wir jemandem verzeihen können oder sollten, sei zum Beispiel ganz entscheidend, ob dieser Schritt mit unserer Selbstachtung vereinbar sei, so Boshammer: "Wenn wir Menschen, die in einer bestimmten Weise mit uns umgegangen sind, entgegenkommen, dann können wir nicht mehr in den Spiegel gucken. Das heißt, wir müssen hier hart bleiben, damit wir uns selbst noch respektieren können, wenn es die oder der oder andere schon nicht getan hat."
Auf der anderen Seite sei Selbstachtung auch etwas, das wir durch den Akt des Verzeihens gewinnen können. Hier gelte es die richtige Balance zu finden und unmissverständlich klar zu machen, "dass die andere Person mich so hätte nicht behandeln dürfen."
"Den Sünder lieben und die Sünde hassen"
"Wenn das Verzeihen im Bewusstsein meiner eigenen Rechte geschieht, also wenn es wirklich ein Verzeihen ist und nicht ein Akt der Nachsicht oder des Entschuldigens", so Boshammer, "dann kann das ein Akt der Größe sein, der es uns ermöglicht, rauszugehen aus diesem Bild von uns selbst als einem Opfer von Unrecht."
Weshalb sollten wir überhaupt bereit sein zu verzeihen? Oft wird dafür das Argument der menschlichen Schwäche ins Feld geführt: Der oder die andere sei ja "auch nur ein Mensch" und mithin ebenso anfällig, Fehler zu machen, wie wir selbst. Das sei schon richtig, sagt Susanne Boshammer, aber wesentlicher erscheine es ihr zu betonen, dass die Person, die uns verletzt habe, "immerhin ein Mensch" sei – "und das heißt: immer mehr als das, was sie tut. Wir alle sind mehr als das, was wir tun." Der Kirchenvater Augustinus habe dafür die Formel geprägt: "Ihr sollt den Sünder lieben, aber die Sünde hassen."
Kluger Umgang mit dem eigenen Groll
Hat das Verzeihen auch eine gesellschaftliche Dimension? Susanne Boshammer glaubt nicht daran, dass Kollektive gemeinschaftlich verzeihen können. Aber: "Was sie können, ist ihre Vergangenheit gemeinsam reflektieren und den Beschluss fassen, die Zukunft von dieser Vergangenheit nicht bestimmen zu lassen." Insofern sei das Grundprinzip des Verzeihens "von vitaler Bedeutung, sowohl für das Politische als auch für das Soziale."
Aller Mühe und Umsicht zum Trotz könnten wir mit unserem Wunsch zu verzeihen an Grenzen stoßen, gibt Boshammer zu bedenken. Dann komme es darauf an, sich einzugestehen, "dass wir uns damit überfordern", so die Philosophin. "Aus Gründen der Klugheit" sollten wir uns jedoch damit bescheiden, "aus unserem Groll nichts zu machen, was die Welt schlechter macht, als sie vorher war."
Susanne Boshammer: "Die zweite Chance. Warum wir (nicht alles) verzeihen sollten"
Rowohlt Verlag, Hamburg
erscheint am 21. Juli 2020
240 Seiten, 25 Euro
Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:
Selbstdarstellung in der Politik: Der Kopf des Königs ist nicht gefallen
Herrenchiemsee, Pferdeweide, Bootskulisse: Spitzenpolitiker inszenieren sich in diesem Sommer mal herrschaftlich, mal hautnah, aber immer ziemlich großartig. Wieso setzen sie in einer Demokratie auf royale Gesten, fragt sich Nils Markwardt.
Philosophische Flaschenpost: Frantz Fanon und die Last der Sprache
Je besser man eine Sprache spricht, desto freier kann man sich zeigen. Das stimmt nicht immer. Unsere Sprache kann auch Mittel der Kolonisierung sein, das zeigte der Theoretiker Frantz Fanon. Auch heute noch zeuge unsere Sprache davon, betont der Berliner Kulturwissenschaftler Onur Erdur, der Fanons Flaschenpost für uns öffnet.