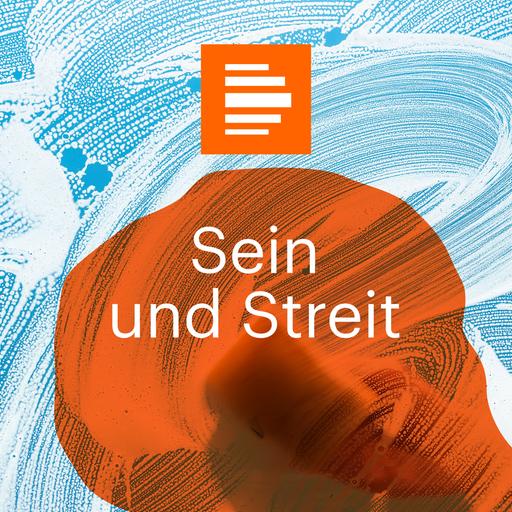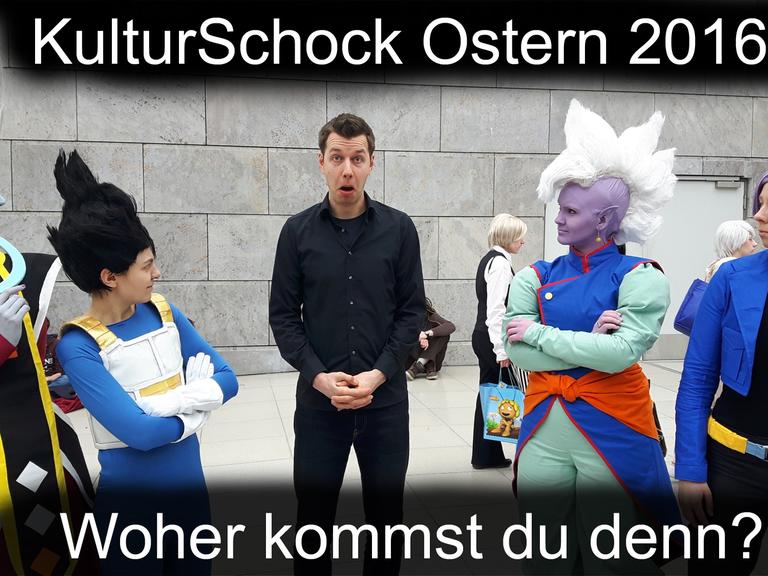Die Freude wird stärker, je größer das Leiden vorher war

Karfreitag ist der Tag der Trauer und wird gefolgt vom Fest der Freude, Ostern. Die Freude ist aber ein Gefühl, was philosophisch wenig reflektiert ist. Zu unrecht, findet Eva Weber-Guskar und holt das nach.
Die höchsten christlichen Feiertage sind, wenn man sie etwas abstrakter betrachtet, jeweils mit einem Gefühl verbunden. Weihnachten ist das Fest der Liebe, Karfreitag ist der Tag der Trauer und Ostern ist das Fest der Freude. Es wäre sicher nicht unplausibel, in diese christlichen Feste den Kern einer Typologie menschlicher Emotionen hineinzulesen. Dabei entsprechen diese drei zentralen Feste gut den aus der Philosophie seit der Antike bekannten Grundaffekten, auf denen die anderen Gefühle aufbauen. Während klassisch auch noch die Furcht dazu gehört, konzentrierte sich Spinoza genau auf drei: Freude, Trauer und Begierde - wobei Begierde als ein Streben zu verstehen ist, das andernorts auch mit Liebe identifiziert wird.
Bemerkenswert ist aber, dass ausgerechnet die Freude philosophisch am wenigsten reflektiert wurde. Das mag daran liegen, dass sie nicht nur ein Grundaffekt ist, den man einfach als selbstverständlich hinnimmt, sondern dass sie darüber hinaus auch so unproblematisch erscheint. Zum einen fühlt sich Freude für jeden gut an. Das unterscheidet sie von der Trauer. Über Strategien zur deren Bewältigung wurde schon deutlich mehr nachgedacht. Und zum anderen ist Freude mit etwas Positivem verbunden, das über das rein Angenehme hinausgeht und mit komplexeren Werten zu tun hat.
Man freut sich über Dinge, die man wertvoll findet
An Ostern freuen sich die Christen über die Auferstehung ihres Messias und auch einfach über den Besuch der Kinder oder Eltern. Die Neo-Aristotelikerin Philippa Foot hat in diesem Sinn betont, dass der Begriff des Guten der Freude vorausgehe. In dieser Perspektive kann man sich über nichts freuen, was man nicht zugleich auf einer reflektierteren Ebene wertvoll findet. Dadurch unterscheidet sich Freude von reiner Lust und steht dem Bereich des ethisch Guten nahe. Wenn man weiß, was Freude ist, so weiß man, dass sie gut ist, scheint es. Und Punkt.
Ist Freude aber wirklich ganz so harmlos und durchweg positiv? Dass es nicht ganz so einfach ist, dass zeigt die Osterfreude letztlich selbst, wenn man sie nicht isoliert, sondern als Teil der dazu gehörigen Erzählung betrachtet. Ohne den Karfreitag, den Tag von tiefster Trauer, stärkstem Schmerz und größter Verzweiflung, ohne diese Trauer gäbe es die Osterfreude nicht. Jesus musste am Kreuz sterben und hinabsteigen in das Reich des Todes, um dann auffahren zu können in den Himmel.
Ostereiersuche als DAS Spiel der Freude?
Das versinnbildlicht den größeren allgemeinen Zusammenhang gut: So basal Freude sein mag, so sehr ist sie auch abhängig vom Kontrast. Je stärker der Kontrast, um so stärker die Freude. Ihr Hintergrund ist Trauer oder Leid, Anstrengung oder Entbehrung. Wir freuen uns über Heilung nach einer Krankheit, aber kaum über unsere Gesundheit, so lange wir noch keine Krankheit erfahren haben. Wir freuen uns über Erfolge umso mehr, je härter der Weg dahin war.
Zudem dauert Freude nicht an, sie ist an Momente und Ereignisse gebunden. Freude ist ein Peak im Auf und Ab der Gefühle, des Wohl und Wehes im Leben. Für ein glückliches Leben im Sinne eines umfassend guten Lebens braucht es Momente der Freude, aber die sind immer mit Tiefen dazwischen erkauft.
Übrigens ist der Ursprung des Ostereiersuchens nicht sicher geklärt. Womöglich ist es einfach DAS Spiel der Freude, ein reiner Freude-Auslöser. Erst die Mühsal des Suchens; unter Büsche kriechen und in Beeten wühlen. Dann die zweifache Freude: über das süße Geschenk und den Erfolg des Findens.