Plädoyer für einen unverkrampften Patriotismus
Der Nationalstolz in seiner häufigsten Form ist das Produkt fremden Übermuts. Das deutsche Einheitsstreben begann, als Napoleons Armeen das Heilige Reich zerdeppert hatten. Im Pariser Exil schrieb Heinrich Heine seine bitter-gemütvollen Verse auf Deutschland.
Der Fall des Matthias Matussek liegt so: Er fiel unter die Briten. Ein paar Jahre als Auslandskorrespondent in London und die Erfahrung, dass englische Folklore auch heute noch die tägliche Niederwerfung Hitlers in den Spalten der Boulevardblätter verlangt, genügten, um ihn, den originalsozialisierten Maoisten und Internationalisten zum glühenden Patrioten zu wenden.
Die auf der Insel erlittene Demütigung rächt Matussek, wie es sich für einen Publizisten gehört, mit einem Buch. Von England und den Engländern handelt dieses Buch jedoch nur insofern, als sie die Sehne bilden für ein fröhliches Bogenschießen auf bestimmte deutsche Haltungen, wie sie, sagen wir es vereinfacht, überall dort stark vertreten sind, wo der Geist seit dreißig Jahren in öder Gleichförmigkeit weht. In ihrem ersten Schrecken darüber, dass sich einer der ihren als "konservativ" outet – und zwar sage und schreibe der Kulturchef des "Spiegel" – haben die Kollegen in den Feuilletons noch keine feste Position bezogen: Sollen sie Matussek als rechten Bösewicht bekämpfen oder als harmlosen Idioten verspotten?
Matusseks Provokation beginnt schon mit dem von ihm gewählten Buchtitel: "Wir Deutschen" – eindeutig ist das ein politisches Sprachvergehen. "Die Deutschen"! Jahrzehntelang bevorzugte, wer immer sich auf der Höhe der Zeit glaubte und über Deutschland räsonierte, den Blick von außen auf die Gattung der lieben Landsleute zu werfen, so als gehöre er nicht dazu. Mochten Ausländer über diese "folie allemande" auch den Kopf schütteln: Die "Nie–wieder–Deutschland-Generation" der Achtundsechziger brauchte für ihr selbstgewisses Urteil über die Väter die bedingungslose Distanzierung von der Horde, die Zeugung durch den Heiligen Geist eingeschlossen.
Mit seiner Titel-Formel vollzieht Matussek die Wiedereinbürgerung in die Geschichte des eigenen Volkes, Stolz auf deren Gutes, Haftung für deren Schreckliches all inclusive. Mag sein, dass dazu im Jahre 2006 nicht mehr so viel Mut gehört. Gescheite Linke wie der Grünen-Vordenker und ehemalige Fischer-Freund Hubert Kleinert halten es schon lange für einen Fehler, dass man den Patriotismus den Rechten überlassen habe. Und wer außer unserem Nobelpreisträger Günter Grass hängt noch der Vorstellung an, Generationen von Deutschen von Luther bis Bismarck hätten nichts anderes getan, als für Auschwitz zu trainieren? Die Hiebe, die Fischer und die Seinen bei Matussek abbekommen, haben insoweit etwas Leichenfledderisches.
Für den Autor waren sie, die Achtundsechziger, Fabrikanten eines nationalen Selbsthasses, der nur die andere Seite einer kolossalen Selbstüberhebung darstellte:
"Im Grunde ist der Deutsche bis zur Generation Fischer nur ein eher vergeblicher Versuch der Germanen zur Menschwerdung. Erst den Fischers, die eine gute Schuld und einen guten Wein auf Anhieb erkennen, ist dieser Zivilisationsschritt gelungen."
Eine spitze Feder schreibt Matussek und niemals ist sie verletzender, als wenn er sie gegen die alten Kumpane wendet. Darin ist er Heine gleich, den er zu Recht als Erfinder des modernen Feuilletonjournalismus bewundert. So wie Heine als Lohnschreiber der "Allgemeinen Zeitung" die Boulevards von Paris nach Eindrücken durchkämmte, so beamt sich Matussek in seinem Buch durch Deutschlands Regionen. Was da herauskommt, ist eine Sammlung pointilistischer Splitter. Diese fügen sich, da und dort etwas gewaltsam, zum Gesamturteil: Das Land ist besser, als es denkt.
Fündig wird Matussek vor allem in Berlin. Im "White Trash" an der Schönhauser Allee begegnet er schrillen Typen, einige davon echt "retro". Er begegnet der Enkelin von Baldur von Schirach, die im Geiste ihren Großvater mit sich rumschleppt, oder einem düsteren, rechtsgewirkten Künstler, der sich von seinem achtundsechziger Vater befreien will und nornenhaft über Verfall und Amerikanisierung unkt.
Matusseks leichter, ironischer Stil schafft ein überwiegend heiteres Genrebild, das Widersprüchlichkeiten nicht als Makel empfindet. Deutschland ist eben vielschichtig. Da gibt es eine Menge, die im Beharrungs-Iglu verweilen. Da gibt es andererseits Aufbruchstimmung und neues Bürgerengagement, exemplarisch vorgeführt bei Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Da gibt es die für Matussek viel versprechende Angela Merkel und die ambivalente CDU, die mit der Lichtgestalt Kirchhof in den Wahlkampf zog und mit Profalla herauskam.
"Die Milieus vermischen sich in Deutschland. Aus der lähmenden Konsensdemokratie wird zusehends die entscheidungsfreudige Demokratie der deutschen Einheit, die das Schicksal des Landes im Auge hat. Sie sucht noch nach Ausdrucksformen, aber sie will, dass beides möglich ist: die emanzipatorischen Errungenschaften und der neue Pragmatismus, Kosmopolitentum und nationales Interesse, individuelle Wahl von Lebensentwürfen und die Stärkung der Familie. Ganz lässig entscheidet in diesem neuen Deutschland eine Schule darüber, dass auf dem Pausenhof nur noch Deutsch gesprochen werden soll. Früher hätte es da wutzitternde Auftritte der Grünen-Abgeordneten Roth gegeben und Attacken auf die ’reaktionäre Leitkultur’ der deutschen Rechten."
Es hat sie gegeben, die wutzitternden Auftritte von Frau Roth. Und längst nicht alles ist so heiter und entspannt, wie Matussek hier und da behauptet. Was sollte er sonst auch mit seiner wunderbaren Befähigung anstellen, das politisch Korrekte zu unterminieren? Unkorrekt ist Nationalstolz bei uns noch immer. Aber für Matussek ist es Zeit, dass sich das ändert.
"Es wird Zeit, denn unter dem dschihadistischen Ansturm islamischer Welt- und Wertvorstellungen, dieser Kriegserklärung an die westliche Kultur und ihre permissiven Gesellschaften, wäre es nicht schlecht zu wissen, wofür man selber geradesteht. Was es ist, was man da verteidigen möchte. Das Recht auf billigen Zahnersatz? Oder geht das tiefer?"
Wenig kann Matussek mit dem Aufgehen des Nationalen in Europa anfangen. Für ihn war das EU-Europa stets eine deutsche Ausflucht. Es ist die globale Entgrenzung, die zwangsläufig, laut Matussek, zu einem Comeback des Nationalen führen wird.
"'Nike' tragen alle. Ist es nicht Zeichen durchaus progressiver Widerborstigkeit, dass wir nach nationaler Identität fragen, wo uns die weltweit aufgestellten Produktionsstrategen doch das Bedürfnis genau dafür auszutreiben versuchen? So sind die Gründe der Rückkehr ins Nationale durchaus vielschichtig. Sie sind reaktionär, progressiv, trivial, subversiv, aber sie wirken."
Kluge Beobachtungen und aufschlussreiche Paradoxien finden sich viele in Matusseks Buch, daneben auch verzichtbare Kapitel. Sein Versuch einer Rede ans Vaterland gehört dazu wie auch ein weiterer reichlich schräger Versuch, nämlich den Arminius-Stoff für einen positiven National-Mythos herzurichten. Die eingeflochtenen Gespräche unter anderem mit Harald Schmidt, Sarah Kuttner oder Heidi Klum müssen nicht alle gefallen. Herausragend dagegen der Dialog mit Klaus von Dohnanyi über das Bildungsbürgertum.
Zur Lektürepflicht wird "Wir Deutschen" durch das, was sich wie ein roter Faden durch die 352 Seiten des Buches zieht: Die Neugier auf das, was hinter den Klischees steckt, und der Mutwille, die Entdeckungen ans Licht zu ziehen, ohne zweite, dritte und vierte Gedanken. Wer an Ketzerei Gefallen findet, muss Matusseks Buch lesen.
Matthias Matussek: Wir Deutschen - Warum die anderen uns gern haben können
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006
Die auf der Insel erlittene Demütigung rächt Matussek, wie es sich für einen Publizisten gehört, mit einem Buch. Von England und den Engländern handelt dieses Buch jedoch nur insofern, als sie die Sehne bilden für ein fröhliches Bogenschießen auf bestimmte deutsche Haltungen, wie sie, sagen wir es vereinfacht, überall dort stark vertreten sind, wo der Geist seit dreißig Jahren in öder Gleichförmigkeit weht. In ihrem ersten Schrecken darüber, dass sich einer der ihren als "konservativ" outet – und zwar sage und schreibe der Kulturchef des "Spiegel" – haben die Kollegen in den Feuilletons noch keine feste Position bezogen: Sollen sie Matussek als rechten Bösewicht bekämpfen oder als harmlosen Idioten verspotten?
Matusseks Provokation beginnt schon mit dem von ihm gewählten Buchtitel: "Wir Deutschen" – eindeutig ist das ein politisches Sprachvergehen. "Die Deutschen"! Jahrzehntelang bevorzugte, wer immer sich auf der Höhe der Zeit glaubte und über Deutschland räsonierte, den Blick von außen auf die Gattung der lieben Landsleute zu werfen, so als gehöre er nicht dazu. Mochten Ausländer über diese "folie allemande" auch den Kopf schütteln: Die "Nie–wieder–Deutschland-Generation" der Achtundsechziger brauchte für ihr selbstgewisses Urteil über die Väter die bedingungslose Distanzierung von der Horde, die Zeugung durch den Heiligen Geist eingeschlossen.
Mit seiner Titel-Formel vollzieht Matussek die Wiedereinbürgerung in die Geschichte des eigenen Volkes, Stolz auf deren Gutes, Haftung für deren Schreckliches all inclusive. Mag sein, dass dazu im Jahre 2006 nicht mehr so viel Mut gehört. Gescheite Linke wie der Grünen-Vordenker und ehemalige Fischer-Freund Hubert Kleinert halten es schon lange für einen Fehler, dass man den Patriotismus den Rechten überlassen habe. Und wer außer unserem Nobelpreisträger Günter Grass hängt noch der Vorstellung an, Generationen von Deutschen von Luther bis Bismarck hätten nichts anderes getan, als für Auschwitz zu trainieren? Die Hiebe, die Fischer und die Seinen bei Matussek abbekommen, haben insoweit etwas Leichenfledderisches.
Für den Autor waren sie, die Achtundsechziger, Fabrikanten eines nationalen Selbsthasses, der nur die andere Seite einer kolossalen Selbstüberhebung darstellte:
"Im Grunde ist der Deutsche bis zur Generation Fischer nur ein eher vergeblicher Versuch der Germanen zur Menschwerdung. Erst den Fischers, die eine gute Schuld und einen guten Wein auf Anhieb erkennen, ist dieser Zivilisationsschritt gelungen."
Eine spitze Feder schreibt Matussek und niemals ist sie verletzender, als wenn er sie gegen die alten Kumpane wendet. Darin ist er Heine gleich, den er zu Recht als Erfinder des modernen Feuilletonjournalismus bewundert. So wie Heine als Lohnschreiber der "Allgemeinen Zeitung" die Boulevards von Paris nach Eindrücken durchkämmte, so beamt sich Matussek in seinem Buch durch Deutschlands Regionen. Was da herauskommt, ist eine Sammlung pointilistischer Splitter. Diese fügen sich, da und dort etwas gewaltsam, zum Gesamturteil: Das Land ist besser, als es denkt.
Fündig wird Matussek vor allem in Berlin. Im "White Trash" an der Schönhauser Allee begegnet er schrillen Typen, einige davon echt "retro". Er begegnet der Enkelin von Baldur von Schirach, die im Geiste ihren Großvater mit sich rumschleppt, oder einem düsteren, rechtsgewirkten Künstler, der sich von seinem achtundsechziger Vater befreien will und nornenhaft über Verfall und Amerikanisierung unkt.
Matusseks leichter, ironischer Stil schafft ein überwiegend heiteres Genrebild, das Widersprüchlichkeiten nicht als Makel empfindet. Deutschland ist eben vielschichtig. Da gibt es eine Menge, die im Beharrungs-Iglu verweilen. Da gibt es andererseits Aufbruchstimmung und neues Bürgerengagement, exemplarisch vorgeführt bei Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Da gibt es die für Matussek viel versprechende Angela Merkel und die ambivalente CDU, die mit der Lichtgestalt Kirchhof in den Wahlkampf zog und mit Profalla herauskam.
"Die Milieus vermischen sich in Deutschland. Aus der lähmenden Konsensdemokratie wird zusehends die entscheidungsfreudige Demokratie der deutschen Einheit, die das Schicksal des Landes im Auge hat. Sie sucht noch nach Ausdrucksformen, aber sie will, dass beides möglich ist: die emanzipatorischen Errungenschaften und der neue Pragmatismus, Kosmopolitentum und nationales Interesse, individuelle Wahl von Lebensentwürfen und die Stärkung der Familie. Ganz lässig entscheidet in diesem neuen Deutschland eine Schule darüber, dass auf dem Pausenhof nur noch Deutsch gesprochen werden soll. Früher hätte es da wutzitternde Auftritte der Grünen-Abgeordneten Roth gegeben und Attacken auf die ’reaktionäre Leitkultur’ der deutschen Rechten."
Es hat sie gegeben, die wutzitternden Auftritte von Frau Roth. Und längst nicht alles ist so heiter und entspannt, wie Matussek hier und da behauptet. Was sollte er sonst auch mit seiner wunderbaren Befähigung anstellen, das politisch Korrekte zu unterminieren? Unkorrekt ist Nationalstolz bei uns noch immer. Aber für Matussek ist es Zeit, dass sich das ändert.
"Es wird Zeit, denn unter dem dschihadistischen Ansturm islamischer Welt- und Wertvorstellungen, dieser Kriegserklärung an die westliche Kultur und ihre permissiven Gesellschaften, wäre es nicht schlecht zu wissen, wofür man selber geradesteht. Was es ist, was man da verteidigen möchte. Das Recht auf billigen Zahnersatz? Oder geht das tiefer?"
Wenig kann Matussek mit dem Aufgehen des Nationalen in Europa anfangen. Für ihn war das EU-Europa stets eine deutsche Ausflucht. Es ist die globale Entgrenzung, die zwangsläufig, laut Matussek, zu einem Comeback des Nationalen führen wird.
"'Nike' tragen alle. Ist es nicht Zeichen durchaus progressiver Widerborstigkeit, dass wir nach nationaler Identität fragen, wo uns die weltweit aufgestellten Produktionsstrategen doch das Bedürfnis genau dafür auszutreiben versuchen? So sind die Gründe der Rückkehr ins Nationale durchaus vielschichtig. Sie sind reaktionär, progressiv, trivial, subversiv, aber sie wirken."
Kluge Beobachtungen und aufschlussreiche Paradoxien finden sich viele in Matusseks Buch, daneben auch verzichtbare Kapitel. Sein Versuch einer Rede ans Vaterland gehört dazu wie auch ein weiterer reichlich schräger Versuch, nämlich den Arminius-Stoff für einen positiven National-Mythos herzurichten. Die eingeflochtenen Gespräche unter anderem mit Harald Schmidt, Sarah Kuttner oder Heidi Klum müssen nicht alle gefallen. Herausragend dagegen der Dialog mit Klaus von Dohnanyi über das Bildungsbürgertum.
Zur Lektürepflicht wird "Wir Deutschen" durch das, was sich wie ein roter Faden durch die 352 Seiten des Buches zieht: Die Neugier auf das, was hinter den Klischees steckt, und der Mutwille, die Entdeckungen ans Licht zu ziehen, ohne zweite, dritte und vierte Gedanken. Wer an Ketzerei Gefallen findet, muss Matusseks Buch lesen.
Matthias Matussek: Wir Deutschen - Warum die anderen uns gern haben können
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006
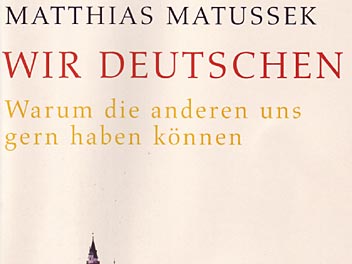
Matthias Matussek: "Wir Deutschen" (Coverausschnitt)© S. Fischer Verlag