Wir wiederholen eine Sendung vom 01. Juni 2019.
Demokratie in Schieflage
29:29 Minuten
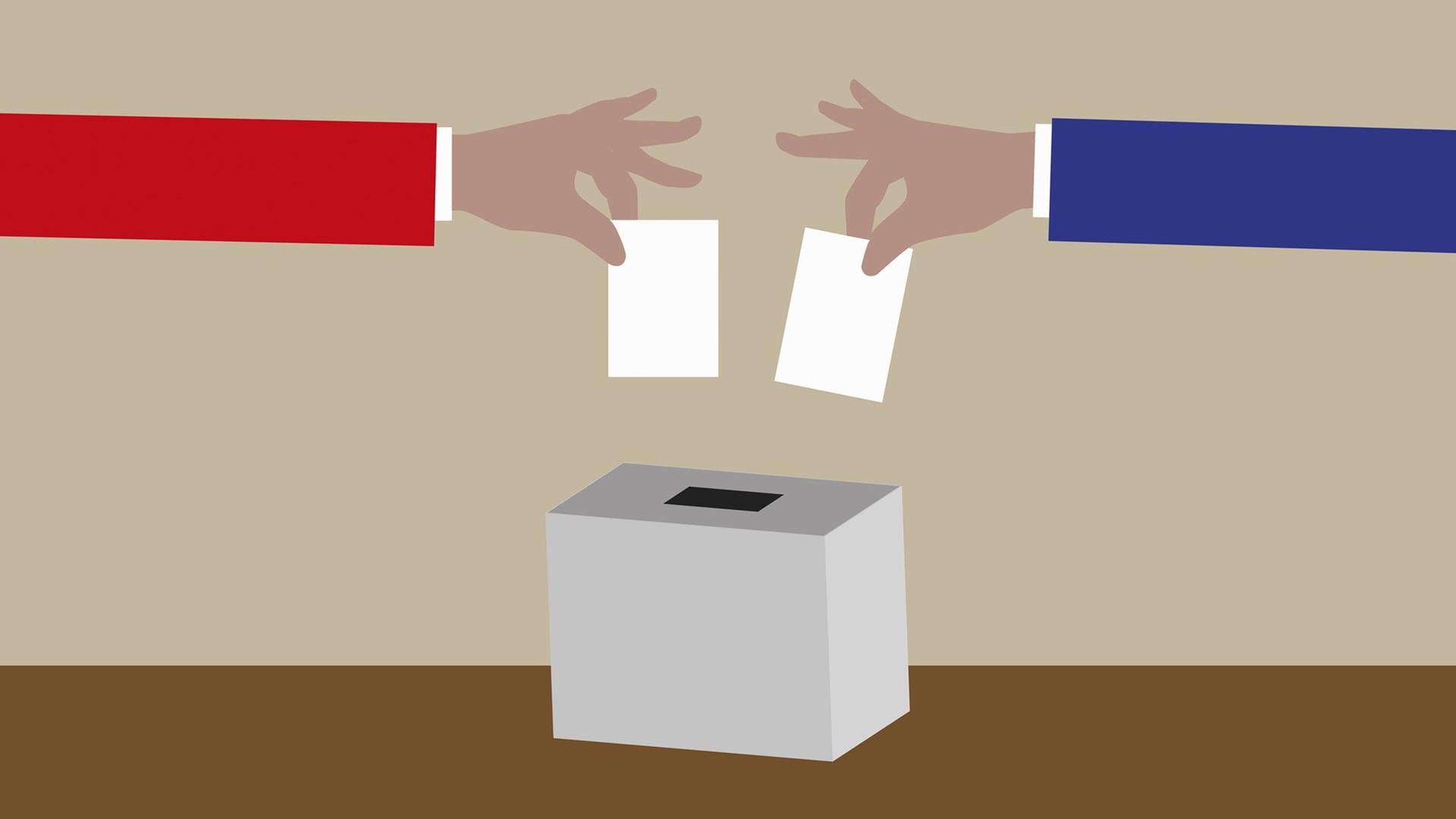
Unsere Demokratie hinkt: Vor allem die sozial Privilegierten gehen wählen und im Bundestag sitzen fast nur noch Akademiker. Das führe zu Gesetzen, die letztlich vor allem den Wohlhabenden nutzen, warnt der Politologe Armin Schäfer.
Bei der Europawahl 2019 haben im ärmsten Kölner Stadtteil 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, in den reichsten Stadtteilen fast 80 Prozent – ein Unterschied von 50 Prozentpunkten. Das ist eines von vielen Beispielen für die sozial ungleiche Wahlbeteiligung in Deutschland. Der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Universität Münster spricht von einem "sehr engen systematischen Zusammenhang" zwischen der sozialen Lage der Menschen und ihrer Wahlbeteiligung.
Kritisch betrachtet Schäfer auch die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, die ein hohes Maß an Homogenität aufweise. "Mehr als 80 Prozent der Abgeordneten haben studiert, in einzelnen Fraktionen sind es fast 90 oder 100 Prozent. Das heißt, dort ist niemand, der irgendwann mal sein Geld im Dienstleistungssektor verdienen musste oder am Band stand. Der klassische Arbeiter schafft es schon lange nicht mehr ins Parlament. Aber auch neue Berufe – unterhalb der Akademiker – schaffen es nicht mehr ins Parlament."
Und das hat wiederum Folgen, die die sozial ungleiche Wahlbeteiligung verstärkt. Armin Schäfer konnte mit einem Team nachweisen, "dass die Entscheidungen, die der Bundestag zwischen 1980 und der Gegenwart getroffen hat, viel stärker mit den Präferenzen von Menschen übereinstimmen, denen es besser geht, als mit denen von Menschen, denen es schlechter geht". Wenn also bestimmte Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern daraus die Lehre ziehen, dass ihre Anliegen nicht berücksichtigt werden, so habe das einen rationalen Kern.
(sf)
________________________________________________________________________________________________________________________
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Jahrelang war die Wahlbeteiligung in Deutschland gesunken, doch bei den Europawahlen 2019 war sie Wahlbeteiligung wieder gestiegen. Wie auch bei der jüngsten Bundestagswahl 2017, und bei vielen Landtagswahlen.
Erleben wir also eine Trendumkehr, was die Wahlbeteiligung angeht?
Erleben wir also eine Trendumkehr, was die Wahlbeteiligung angeht?
Armin Schäfer: Um zu erkennen, ob eine dauerhafte Trendumkehr stattgefunden hat, ist es noch ein bisschen früh, aber tatsächlich stimmt es, dass seit einigen Jahren die Wahlbeteiligung wieder steigt. Es gibt einen Faktor, den wir in der Politikwissenschaft ganz gut kennen: Polarisierung, also, wenn mehr gestritten wird, wenn Themen hoch politisiert sind, dann steigt auch die Wahlbeteiligung. Das beobachten wir seit einiger Zeit.
Deutschlandfunk Kultur: Wir können die Sache so betrachten, dass wir mit diesem Anstieg der Wahlbeteiligung in Deutschland einen Anstieg der Stimmen für die AfD erleben, die gab es ja vorher nicht. Also könnte man daraus schließen, dass die AfD es schafft, die bisher Politikverdrossenen oder Abstinenten zu mobilisieren.
Schäfer: Das wäre ein bisschen zu einfach. Ein Teil der Mobilisierung läuft über die AfD, aber auch dadurch, dass Themen angesprochen werden, die sonst vielleicht nicht kontrovers diskutiert würden. Und dann findet auch eine Gegenmobilisierung statt. Das bedeutet nicht nur, dass diejenigen wählen gehen, die vorher vielleicht nicht wählen waren und jetzt der AfD ihre Stimme geben. Es werden auch Menschen motiviert zu wählen, die nicht gewählt haben und jetzt denken, "wir müssen aber uns gegen die AfD positionieren", so dass also eine Mobilisierung in zwei Richtungen stattfinden kann und nicht nur die AfD profitiert.
Niedrige Wahlbeteiligung zeigt Unzufriedenheit an
Deutschlandfunk Kultur: Aber Sie als Politikwissenschaftler und als Demokrat, nehme ich mal an, freuen sich doch erstmal darüber, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt, oder?
Schäfer: Das ist auf jeden Fall positiv für die Demokratie, wenn die Wahlbeteiligung steigt, weil wir wissen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eine Mischung aus Desinteresse, aber auch Unzufriedenheit normalerweise ausdrückt.
Deutschlandfunk Kultur: Aber warum ist die niedrige Wahlbeteiligung so ein Problem? Es gibt ja auch die These – Sie haben "Desinteresse" gesagt, man kann es anders übersetzen: Die Leute sind zufrieden, bleiben auf dem Sofa liegen und denken, warum soll ich wählen gehen, ist alles prima, so wie es ist.
Schäfer: Ganz lange hatte man das angenommen. Die damalige Forschung ging davon aus, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil Menschen vielleicht aus Zufriedenheit sagen, "ach, es muss sich ja gar nichts ändern". Und deshalb gehen sie nicht wählen. Aber nach und nach haben immer mehr Arbeiten in der Politikwissenschaft gezeigt, dass das so nicht stimmt.
Wenn man auf Umfragen geblickt hat, wer zufrieden und unzufrieden ist mit der Funktionsweise der Demokratie, mit der Regierung, dann stellte man fest, dass diejenigen zu Hause bleiben am Wahltag, die besonders unzufrieden sind, und nicht die, die zufrieden sind.
Deutschlandfunk Kultur: Das klingt ja erstmal ziemlich paradox, oder?
Schäfer: Das hängt damit zusammen, ob Menschen glauben, dass die Stimmabgabe an ihrer Unzufriedenheit was ändern könnte oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, es ändert nichts, dann ist man unzufrieden und bleibt zu Hause.
Zusammenhang mit Einkommen und Bildungsgrad
Deutschlandfunk Kultur: Mehrere Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, auch Ihre Studien, Herr Prof. Schäfer, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und Bildungsgrad und Wahlbeteiligung oder politischem Engagement im weitesten Sinne. Also: je niedriger das Einkommen, je niedriger der Bildungsabschluss, desto niedriger auch die Wahlbeteiligung. Ich glaube, das heißt in Ihrem Jargon "asymmetrische Mobilisierung der Wähler". – Aber warum ist das so? Wählen gehen kostet weder etwas, noch ist es besonders kompliziert.
Schäfer: Einerseits ist es richtig, dass die Wahlbeteiligung sehr ungleich geworden ist über die Zeit, und die Kosten oder der Aufwand fürs Wählen sind vielleicht geringer als bei anderen Formen des politischen Engagements. Tatsächlich ist es auch so, dass wir bei diesen anderen Formen sich zu engagieren eher noch größere Unterschiede beobachten. Aber selbst bei Wahlen, die vielleicht gar nicht so aufwendig sind, sehen wir sehr große Unterschiede.
Aber einfach ist Wählengehen nun auch wieder nicht. Man muss eine Menge wissen. Man muss sich vorab informieren über die Unterschiede zwischen den Parteien. Man muss politisch interessiert sein. Man muss vielleicht von anderen auch angestoßen werden, die sagen: "Hey, geh doch wählen". Und das verteilt sich eben sehr ungleich in der Bevölkerung, ob diese Faktoren vorliegen oder nicht.
Und wenn wir Bildungsgrad oder Einkommensgruppen angucken, finden wir systematische Unterschiede in den Voraussetzungen, die Menschen mitbringen, ob sie zur Wahl gehen oder nicht.
Deutschlandfunk Kultur: Aber die Wahlbeteiligung – ich rede jetzt von Bundestagswahlen in der alten Bundesrepublik – lag doch mal um die 80 Prozent.
Schäfer: In den 70er Jahren haben in der Bundesrepublik sogar über 90 Prozent der Menschen gewählt. Und dann ist die Wahlbeteiligung langsam abgesackt auf über 80 Prozent. Und schrittweise ist sie mit kleineren Aufs und Abs immer weiter gefallen bis auf 70 Prozent. Jetzt haben wir einmal bei der letzten Bundestagswahl 2017 einen Anstieg gesehen auf ungefähr 76 Prozent, was immer noch weit unterhalb dessen ist, was in den 70er Jahren als normal gegolten hätte.
Sozial ungleiche Wahlbeteiligung
Deutschlandfunk Kultur: Ja, das stimmt, aber immerhin fast so viel wie 1949. – Aber nochmal zurück zu meinem Punkt 80er Jahre: Weder waren die Menschen damals reicher als heute, noch hatten sie höhere Bildungsabschlüsse als heute – im Gegenteil. Trotzdem waren die Wahlbeteiligungen viel höher.
Schäfer: Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Einerseits sind die Menschen im Durchschnitt heute höher gebildet, jedenfalls, was die formalen Schulabschlüsse angeht, und das Durchschnittseinkommen ist auch gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch Unterschiede größer geworden: Die Ungleichheit der Einkommen ist angestiegen. Und für Menschen zählt nicht nur, wie viele Ressourcen sie individuell haben, sondern sie vergleichen sich auch mit dem, was in einer Gesellschaft normal ist, so dass wir also immer nicht nur das absolute Niveau betrachten müssen, sondern auch den Unterschied zu anderen Gruppen.
Deutschlandfunk Kultur: Wie haben Sie denn überhaupt diesen Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und sozialem Status erhoben?
Schäfer: Es gibt zwei Wege, wie man sich das anschauen kann. Das eine ist einfach über Umfragedaten, davon gibt es sehr viele, wo Menschen befragt werden, ob sie an der letzten Wahl teilgenommen haben oder ob sie in Zukunft wählen wollen. Da wird in der Regel eben auch erhoben: Was ist der höchste Schulabschluss? Welchen Beruf übt man aus? Wie hoch ist das Haushaltseinkommen? Und wenn man diese Informationen hat, kann man sich anschauen: Gibt es einen systematischen Unterschied zwischen denjenigen, die nur Hauptschulabschluss haben und ihrer Wahlbeteiligung, und denjenigen, die vielleicht Abitur haben oder studiert haben? – Das ist der eine Weg über Umfragen.
Der andere ist, sich räumliche Unterschiede anzugucken, indem man beispielsweise eine Stadt nimmt und sich anschaut: Wie hoch waren die Wahlbeteiligungsunterschiede innerhalb dieser Stadt zwischen den Stadtteilen. Da gibt es reichere Gegenden und ärmere Gegenden und man kann überprüfen, ob es einen systematischen Zusammenhang gibt zwischen dem, wie gut es Menschen in einem Stadtteil geht und der Wahlbeteiligung. Und in der Tat ist dieser Zusammenhang sehr, sehr eng.
Riesige Unterschiede zwischen arm und reich
Deutschlandfunk Kultur: Das heißt, Sie können quasi anhand von Wahlbeteiligungsdaten auf einen Blick erkennen, ob es sich um einen ärmeren oder reicheren Stadtteil handelt? Ist der Unterschied so groß?
Schäfer: Der Unterschied ist riesig. Nehmen wir die Europawahl vom vergangenen Sonntag: In der Stadt Köln haben im ärmsten Kölner Stadtteil 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben und in den reichsten Stadtteilen fast 80 Prozent. So groß sind die Unterschiede. Und wenn Sie von zwei Stadtteilen wissen, wie hoch die Arbeitslosenquote ist oder in welchem der beiden Stadtteile die Arbeitslosenquote höher ist, dann können Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch vorhersagen, wo die Wahlbeteiligung höher oder niedriger ausfällt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, dass diejenigen nicht wählen gehen, die sich davon nichts erhoffen. Jetzt sagt Ihr Kollege, der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer: "Jemand, der nicht zur Wahl geht, darf danach auch nicht über die Politik motzen. Er hätte es selbst in der Hand gehabt, etwas zu ändern."
Schäfer: Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Erstmal: Die einzelne Stimmabgabe ändert natürlich nicht sofort irgendetwas. Und es gibt eben systematische Gründe, warum Menschen sich entscheiden, entweder zur Wahl zu gehen oder zu Hause zu bleiben. Die haben auch was mit dem sozialen Umfeld zu tun, und die haben mit den Erfahrungen der Menschen zu tun. Die lassen sich nicht so einfach überwinden, um zu sagen, "na ja, selbst schuld, und das ist eine rein individuelle Entscheidung". Da fließt schon etwas mehr ein.
Wir wissen, dass Familie, Freundeskreise, Wohngegenden einen Einfluss darauf haben, wie sich Menschen politisch verhalten und eben auch, ob sie zur Wahl gehen oder nicht.
Deutschlandfunk Kultur: Genau, da sind wir nochmal beim Vergleich mit den 80er Jahren in Hinblick auf Reichtum und Bildungsabschluss. Denn danach müsste man ja annehmen, dass heute, wo so viele junge Menschen wie noch nie Abitur machen, so viele junge Menschen wie noch nie ein Hochschulstudium machen, dass gerade heute besonders unter den Jüngeren die Wahlbeteiligung besonders hoch ist und unter den Älteren - weniger vermögenden, weniger gebildeten - geringer. Aber es ist genau umgekehrt.
Schäfer: Tatsächlich fällt die Wahlbeteiligung bei den Jüngeren immer schon niedriger aus als bei den Älteren. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, bei den heute Jüngeren sind die Unterschiede nach Bildung oder nach Einkommen oder nach Beruf besonders groß. Bei denjenigen, die heute jung sind und möglicherweise nur einen Hauptschulabschluss haben, ist die Wahlbeteiligung extrem gering. Diejenigen, die Abitur machen oder studieren, die haben immer noch eine relativ hohe Wahlbeteiligung. Da sind die Unterschiede auch zu den Älteren gar nicht so riesig.
Soziale Einbindung fehlt
Deutschlandfunk Kultur: Aber ich verstehe immer noch nicht richtig, warum die Hauptschulabsolventen 1972 zur Wahl gegangen sind, aber nicht 2017.
Schäfer: Ja. Wir reden von sozialer Integration, um das zu erklären. Das eine ist eben: Wie gut ist man ausgebildet, welchen Schulabschluss hat man? Das andere ist, in welche Art von Netzwerken ist man eingebunden? Früher gab es eine stärkere Einbindung in Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen, die auch dafür gesorgt haben, Leute zu mobilisieren. Selbst Menschen, die vielleicht relativ politikfern oder nicht so interessiert waren, haben über solche Netzwerke und Organisationen den entscheidenden Anstoß bekommen, doch noch wählen zu gehen.
Heute haben diese Gruppen oder diese Organisationen an Einfluss verloren. Weniger Menschen gehen in die Kirche, weniger Menschen werden Mitglieder in Vereinen, in Organisationen, in Gewerkschaften. Das bedeutet: Weil diese Einbindung in solche Netzwerke zurückgeht, werden die individuellen Ressourcen wichtiger. Die individuellen Ressourcen haben zwar im Durchschnitt zugenommen, sind aber gleichzeitig auch relativ ungleich verteilt.
Deutschlandfunk Kultur: Das erklärt dann wiederum, warum hoher sozialer Status mit politischem Engagement, nicht zuletzt über Wahlen, und geringer sozialer Status mit geringem politischem Engagement einhergehen. – Habe ich Sie da richtig verstanden?
Schäfer: Diejenigen, die viele Ressourcen haben und sich ohnehin stark für Politik interessieren, die sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand sie mobilisiert, ihnen einen Anstoß gibt, an Wahlen teilzunehmen. Diejenigen aber, die weniger interessiert sind, etwas politikferner sind, denen hilft es, wenn im sozialen Umkreis, im Freundeskreis, etwa in der Familie oder eben über Vereine, Kirchen etc. der Anstoß kommt: Ach, geh doch wählen, engagiere dich doch hier auch bei einer Partei. – Und das findet weniger statt als in der Vergangenheit und erklärt deswegen auch die größeren Unterschiede.
Wählen und Nichtwählen sind ansteckend
Deutschlandfunk Kultur: Dass das Umfeld daran beteiligt ist, ich glaube, das kennen wir alle. Mir ging es ehrlich gesagt am vergangenen Sonntag so, dass ich dachte: Ach Mensch, das Buch ist so interessant und das Sofa so gemütlich. Dann habe ich gedacht, was werden meine Freunde, meine Familie sagen? Das geht gar nicht! Das wäre tatsächlich eine Normverletzung gewesen, glaube ich.
Schäfer: Genau. Dazu kann man zwei Sachen sagen. Einerseits ist schon diese Norm ungleich verteilt. Wer für sich selbst sagt, wählen gehört einfach dazu, eine gute Bürgerin oder ein guter Bürger zu sein, diese Person wird tatsächlich wählen gehen. Und mir geht es da wie Ihnen. Wenn ich in meinem Freundeskreis sage, "ich habe nicht gewählt" - nun bin ich auch noch Professor für Politikwissenschaft - dann sagen alle: "Das gibt’s doch nicht!" – Aber es gibt eben Gruppen und Freundeskreise, wo die Norm fast schon das Gegenteil ist, wo man gefragt wird, "was, du warst wählen, warum machst du denn so was?" – oder es überhaupt nie Thema ist. Das ist noch wahrscheinlicher.
Es gibt Forschung aus den USA, die sagt: Wählen ist ansteckend, aber Nichtwählen ist eben auch ansteckend.
Deutschlandfunk Kultur: Dann blicken wir mal auf die unmittelbaren Folgen, nämlich auf diejenigen, die gewählt werden von denjenigen, die wählen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sollen das Volk vertreten. So steht es im Grundgesetz Artikel 38. Sie sollen nicht einen Querschnitt der Bevölkerung bilden, das steht da nicht. Und das haben sie bekanntlich auch noch nie, wenn man sich allein die Anzahl der Frauen und Männer in den verschiedenen Legislaturperioden ansieht, dann wissen wir das.
Sie, Herr Schäfer, stören sich besonders an der hohen Quote der Akademiker im Bundestag. Ich glaube, es gibt kaum noch Menschen, die nicht Akademiker sind, die Bundestagsabgeordnete sind. – Warum stört Sie das?
Schäfer: Darüber gibt es auch eine ganz lange, jahrzehntealte Diskussion. Was bedeutet eigentlich Repräsentation? Oder: Was sind die Voraussetzungen von Repräsentation? Lange Zeit war die Mehrheitsmeinung in der politischen Theorie, dass es nicht primär wichtig ist, wer im Parlament sitzt, sondern wie vielfältig die Ideen sind, die dort vertreten werden. Dann kam aber ein neuer Diskurs auf, insbesondere auch von weiblichen Politikwissenschaftlerinnen, die gesagt haben: "Glauben wir wirklich, dass es völlig irrelevant ist, ob Frauen im Parlament überhaupt vertreten sind?" Wenn wir nur zwei, drei Jahrzehnte zurückgehen, dann gab es damals viele Länder, in denen höchstens zehn Prozent der Abgeordneten weiblich waren.
Daraus entwickelte sich die Vorstellung, dass es für die Art von Entscheidungen und für die Art, wie über Themen diskutiert wird und ob über Themen diskutiert wird, wichtig ist, wer die Menschen sind, die im Parlament sitzen. Inzwischen ist es bei der Frage, ob Frauen im Parlament vertreten sein sollten, eine Selbstverständlichkeit. Kaum jemand würde noch sagen, nein, das ist nicht nötig, dass Frauen im Parlament sind.
Die Frage kann man natürlich weiter spinnen. Was bedeutet es denn, wenn bestimmte soziale Gruppen überhaupt nicht mehr im Parlament auftauchen oder andersrum, wenn es eine relativ homogene Gruppe ist, die alle dieselbe Art von Bildungsabschluss haben und ähnliche Lebensverläufe?
Fast nur Akademiker im Bundestag
Deutschlandfunk Kultur: So wie zum Beispiel Universitätsprofessoren und Journalisten.
Schäfer: Genau. Aber der Unterschied zwischen unseren Berufsgruppen und den Parlamentariern ist, dass wir nicht stellvertretend für andere handeln müssen. Wir sind nicht aufgefordert, das Volk zu repräsentieren, sondern ich soll möglichst gut unterrichten und gute Forschung machen und Sie führen gute Interviews. Das ist unser Job. Wir müssen nicht andere repräsentieren.
Es ist die Frage, ob Abgeordnete gut in der Lage sind, bestimmte Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden, die sie selbst vielleicht nie erlebt haben, von denen sie nur vom Hörensagen wissen. Und es ist nicht nur der Unterschied in der Zusammensetzung des Parlaments zu der Bevölkerung insgesamt, sondern das hohe Maß an Homogenität. Mehr als 80 Prozent der Abgeordneten haben studiert, in einzelnen Fraktionen sind es fast 90 oder 100 Prozent. Das heißt, dort ist niemand, der irgendwann mal sein Geld im Dienstleistungssektor verdienen musste oder am Band stand. Der klassische Arbeiter schafft es schon lange nicht mehr ins Parlament. Aber auch neue Berufe – unterhalb der Akademiker – schaffen es nicht mehr ins Parlament.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gerade von der hohen Homogenität gesprochen, Herr Schäfer, die die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufweisen. Aber welche Folgen hat sie? Man kann das natürlich beklagen und sagen, das ist ja sehr traurig, dass da jetzt keine Arbeiter, keine Menschen aus dem Dienstleistungsgewerbe, keine Friseurinnen sitzen, aber hat das auch Folgen für die Politik, die gemacht wird?
Schäfer: Das ist ein ganz neuer Forschungszweig, in dem man genau dieser Frage nachspürt. Zuerst gab es die Forschungsarbeiten in den USA, jetzt gibt es eine Reihe von anderen Ländern, in denen das erforscht wurde, auch in Deutschland. Das habe ich mit einem Team untersucht. Und tatsächlich finden wir, dass die Entscheidungen, die der Bundestag zwischen 1980 und der Gegenwart getroffen hat, viel stärker mit den Präferenzen von Menschen übereinstimmen, denen es besser geht, als mit denen von Menschen, denen es schlechter geht.
Wir haben nicht nur eine ungleiche Wahlbeteiligung und eine ungleiche Zusammensetzung der Parlamente, sondern wir beobachten zusätzlich auch noch, dass die Entscheidungen eher diejenigen repräsentieren, die eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen oder die sich eher im Parlament wiederfinden.
Gesetze für die Wohlhabenden
Deutschlandfunk Kultur: Wie haben Sie das gemessen? Das klingt, als wenn da Ihr eigener politischer Standpunkt mit einfließen würde.
Schäfer: Dann wäre es keine gute politikwissenschaftliche Forschung, wenn das vor allen Dingen meine persönliche Meinung wäre, sondern wir haben Umfragen herausgesucht, die seit 1980 gemacht wurden. Wir haben insgesamt über 700 Umfragen untersucht, in denen es um ganz konkrete Sachfragen geht, in denen die Menschen gefragt wurden: "Sind Sie für diese Politikänderung oder sind Sie gegen diese Politikänderung?" Und da das Umfragen sind, kann man auch anschauen: Wie viele waren für diese Politikänderung in der höchsten Einkommensgruppe oder in der niedrigsten Einkommensgruppe oder unter den Arbeiterinnen oder den Beamten? So kann man vergleichen, wer in der Bevölkerung wollte diese Politikänderung und wer war eher dagegen.
Wenn wir diesen ersten Schritt gemacht haben, können wir uns im zweiten Schritt angucken: Welche Entscheidung wurde tatsächlich getroffen? Und für diese über 700 Fragen konnten wir dann im Einzelnen recherchieren, was der Bundestag entschieden hat.
Wenn man das beides macht, wer will was und was entscheidet der Bundestag, dann findet man ein Muster. Dieses Muster ist, dass der Bundestag viel häufiger Entscheidungen getroffen hat, die mit den Wünschen derjenigen übereinstimmen, die ein höheres Einkommen haben, ein höheres Bildungsniveau oder mit Berufsgruppen mit höherem sozialem Status.
Deutschlandfunk Kultur: Aber das ist doch im Grunde genommen logisch, weil das diejenigen sind, die gewählt haben.
Schäfer: Ja, man kann das so sagen, aber umso mehr wird es eben ein dringliches Problem, wenn die Wahlbeteiligung so ungleich ist und das nicht einfach nur individuelles Kalkül Einzelner ist, sondern auch wieder auf soziale Ungleichheit zurückzuführen ist.
Deutschlandfunk Kultur: Die SPD hat sich in letzter Zeit bemüht, denjenigen entgegenzukommen, die nicht so häufig wählen. Sie hat den Mindestlohn eingeführt, die Rente mit 63, sie tritt jetzt für eine Grundrente ein. Richtig gut bekommen ist es ihr nicht.
Schäfer: Wir reden aber von Trends, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, Unterschiede, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Vielleicht gibt es jetzt einen gewissen Erkenntnisprozess in einzelnen Parteien, aber ich würde annehmen, dass es relativ lange dauert, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Vertrauen zu zerstören, ist leichter, als Vertrauen wieder aufzubauen. Und einzelne Entscheidungen werden dieses Grundmuster auch nicht ändern, stattdessen müsste über einen längeren Zeitraum eine andere Art von Politik gemacht werden. Dann ändert sich vielleicht auch das Muster der ungleichen Wahlbeteiligung wieder, wenn die Menschen das Gefühl haben, ja, es wird auch für uns Politik gemacht.
Wahlpflicht ist nicht überall anerkannt
Deutschlandfunk Kultur: Wir können mal in die Länder gucken, wo die Wahlbeteiligung höher ist. Soweit ich das verstanden habe, gibt es da zwei Faktoren. Der eine ist ganz simpel: Es gibt eine Wahlpflicht, wenn man nicht wählen geht, dann muss man Bußgeld zahlen oder was auch immer. Der zweite Faktor: Wenn eine Gesellschaft weitgehend egalitär ist, also sozial ausgewogen, wie zum Beispiel Dänemark, dann ist die Wahlbeteiligung auch ohne eine Wahlpflicht sehr hoch.
Bevor wir hier eine egalitäre Gesellschaft hinbekommen, vergehen wahrscheinlich ein paar Jahre. Fangen wir mal mit der einfacheren Lösung an, mit der Wahlpflicht. Wäre das ein Mittel der Wahl, Herr Schäfer, dass wir in Deutschland die Wahlpflicht einführen, damit sich dann wieder alle beteiligen?
Schäfer: Das Problem ist: In Ländern, wo es die Wahlpflicht gibt, ist sie auch anerkannt und in der Bevölkerung ziemlich beliebt. In Ländern, wo es die Wahlpflicht nicht gibt, ist die Mehrheit der Bevölkerung eher dagegen. Man empfindet, dass Wählen zu gehen ein Recht ist und keine Pflicht, man sollte dazu nicht gesetzlich gezwungen werden. Deswegen ist die Zustimmung auch in Deutschland zur Einführung einer Wahlpflicht sehr gering.
Das ist insbesondere dann der Fall, wenn viele Menschen der Politik misstrauen und das Ansehen von Politikerinnen und Politikern gering ist. In dieser Situation ist es besonders schwierig zu sagen, "aber ihr müsst jetzt wählen gehen", weil die Menschen das Gefühl haben, man würde sie zwingen, für eine bestimmte Partei abzustimmen. Also, die Situation ist ein bisschen verfahren. Man hätte eine Wahlpflicht wahrscheinlich viel einfacher einführen können, als sie nicht nötig war, weil die Wahlbeteiligung ohnehin hoch war. Jetzt ist die Wahlbeteiligung niedrig und das Ansehen der Politik insgesamt eher gering. Und es ist sehr schwierig, eine Wahlpflicht einzuführen.
Deutschlandfunk Kultur: Das hätte dann vielleicht sogar eher den umgekehrten Effekt.
Schäfer: Ja. Wir haben viele Beispiele von Ländern, die irgendwann die Wahlpflicht hatten und sie dann abgeschafft haben. Da kann man relativ genau feststellen, dass die Wahlbeteiligung dann zurückgeht und sie auch sehr stark ungleich wird direkt in der nächsten Wahl nach der Abschaffung. Es gibt aber kaum Beispiele, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, wo die Wahlpflicht eingeführt wurde. Insofern müssen wir ein bisschen darüber rätseln. Was würde denn passieren, wenn man das jetzt durchsetzt gegen den Widerstand großer Teile der Bevölkerung?
Soziale Gleichheit hebt die Wahlbeteiligung
Deutschlandfunk Kultur: Dann gucken wir auf die zweite Variante: Egalitäre Gesellschaft gab es ja mal mehr oder weniger in der alten Bundesrepublik wie auch in der alten DDR. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch eine Mehrheit in Deutschland bekäme für das Ziel einer egalitären Gesellschaft.
Schäfer: Interessant ist jedenfalls im internationalen Vergleich, dass ein Land wie Dänemark, wie Sie es richtig gesagt haben, eine relativ hohe Wahlbeteiligung hat, ohne die Menschen dazu zu zwingen. Das kann man systematisch untersuchen, und tatsächlich gibt es neben vielen anderen Faktoren, die die Wahlbeteiligung beeinflussen, einen systematischen Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und der Höhe der Wahlbeteiligung und damit auch der Wahlbeteiligungsungleichheit.
Allerdings droht ein Teufelskreis, dass Länder, die eine niedrige Wahlbeteiligung haben, die noch dazu sozial ungleich ist, genau nicht die Art von Politik bekommen, die die Gleichheit erhöhen würde. Also: Wie werden wir dänischer unter der Voraussetzung, dass die Wahlbeteiligung nicht gleich ist, sondern dass wir wissen…
Deutschlandfunk Kultur: …dass die Dänen hier nicht wählen …
Schäfer: … genau, dass bei uns nur bestimmte Gruppen, zumindest in sehr viel höherem Ausmaß wählen gehen als andere. Und wir wissen, dass der Bundestag eher deren Präferenzen umsetzt, als die Präferenzen derjenigen, die vielleicht von mehr Gleichheit stärker profitieren würden.
Wahlenthaltung ist nicht irrational
Deutschlandfunk Kultur: Ja, aber mich lässt trotzdem dieses Paradox nicht los. Es sind doch gerade die ärmeren Menschen, die ein Interesse daran hätten, sich politisch zu engagieren, weil sie viel mehr auf einen gut funktionierenden Staat, auf gute Gesetzgebung, gute Infrastruktur angewiesen sind, also auf gute öffentliche Schulen, die nichts kosten, auf einen guten Öffentlichen Nahverkehr, der bezahlbar ist, und so weiter. Reiche Menschen können sich das alles auch privat leisten, Privatschulen oder schicke Autos oder was auch immer.
Das heißt: Wer weniger Ressourcen hat und sich nicht politisch beteiligt, handelt im Grunde genommen gegen seine eigenen Interessen. – Was kann man tun, um den Menschen das klarzumachen? Denn wir leben in einer Demokratie, jeder hat ja das Recht, nicht zu wählen. Wie jeder von uns das Recht hat, sich zu Tode zu saufen oder zu rauchen oder was auch immer.
Schäfer: Ganz häufig wird so darüber nachgedacht, als wäre es irrational, dass bestimmte Menschen nicht mehr wählen gehen. Und natürlich, in der Summe, kollektiv schadet es bestimmten Gruppen, wenn sie nicht wählen gehen. Wenn aber stimmt, was wir in unserer Forschung gezeigt haben, dass die Responsivität - so nennt man das in der Politikwissenschaft - des Bundestages, auf wen reagiert die Gesetzgebung, ungleich ist, dann lehrt das Bürgerinnen und Bürger auch etwas. Es lehrt bestimmte Gruppen, dass ihre Anliegen nicht umgesetzt werden oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden als die anderer.
Deutschlandfunk Kultur: Insofern ist es nicht irrational, sondern rational anzunehmen: "Na ja, wir sind denen doch sowieso egal. Für uns tut ihr nichts"?
Schäfer: Genau. Man kann zeigen, dass diejenigen, die den Bundestag - oder generell die Parlamente - als nicht responsiv wahrnehmen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht wählen zu gehen oder für Protestparteien zu stimmen.
Man kann sagen, dass das rational ist, weil sie tatsächlich korrekt beobachten, dass die Entscheidungen der Parlamente ungleich sind und aus dieser Beobachtung die Schlussfolgerung ziehen, dass das Wählen sich vielleicht für sie nicht so richtig lohnt. Das Problem ist, dass diese Haltung das eigentliche Problem natürlich weiter verschärfen kann.
Deutschlandfunk Kultur: Das ist ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Nochmal an Sie die Frage, Herr Prof. Schäfer, bitte lösen Sie das Problem unserer Demokratie: Was können wir tun, damit die Wahlbeteiligung auch wieder sozial repräsentativer wird?
Schäfer: Das ist immer eine Frage, die mir Kopfschmerzen bereitet, weil es keine einfache Antwort oder eine einfache Lösung gibt.
Ein Gegensteuern ist schwierig
Deutschlandfunk Kultur: Geben Sie ruhig eine komplizierte Antwort, Hauptsache Antwort.
Schäfer: Wir lernen aus dem internationalen Vergleich, dass manche Länder das besser hinkriegen als andere. Man kann zumindest mal die Diskussion über die Wahlpflicht führen. Auch wenn die ersten Reaktionen darauf sicher negativ sind, aber vielleicht setzt sich über Zeit doch durch, dass sie gar nicht so unvernünftig sein könnte, andere Länder haben sie auch: Australien, Luxemburg, Belgien, viele südamerikanische Länder.
Zum anderen muss, glaube ich, ein Lernprozess innerhalb der Parteien stattfinden. Der hat zum Teil, glaube ich, schon begonnen, weil die Parteipolitiker merken, dass das Gefühl, sie seien für bestimmte Gruppen nicht mehr da, ihnen schadet. Besonders stark wird diese Diskussion inzwischen in der SPD geführt, wo man das Gefühl hat: Wir haben unsere frühere Kernwählerschaft verloren, die glauben nicht mehr, dass wir wirklich für sie handeln. Dann wird vielleicht drüber nachgedacht, welche Politikvorschläge man umsetzen kann, um an diesem Problem etwas zu ändern. So könnte ein Wandel stattfinden auf der Ebene: Welche Art von politischen Inhalten verfolgen wir? In anderen Ländern hat das eine Zeit lang stattgefunden.
Bei der Labour Party in Großbritannien wurde eine Zeit lang ganz intensiv diskutiert: Wie können wir an die Menschen, die uns jetzt sehr fernstehen, wieder herankommen und sie für uns gewinnen, so dass sie auch mitarbeiten in der Partei? Wie schaffen wir es, nicht nur Akademiker an uns zu binden, die aktiv sind und sich wählen lassen?
In der Mitgliedschaft muss man gezielt Leute rekrutieren, ansprechen. Wir wissen, dass es kein zufälliger Prozess ist, wer in einer Partei aktiv wird und vor allem wer für Ämter kandidiert. Das hat sehr viel mit Rekrutierung zu tun, und Rekrutierung hat sehr viel mit innerparteilichen Netzwerken zu tun. Menschen suchen eher Menschen, die ihnen selbst ähnlich sind. Aber das kann man auch transparent und bewusst machen. Und dann kann eine Partei überlegen, ob es bewusste Gegenstrategien gibt.
Besser Wut als Resignation
Deutschlandfunk Kultur: Es wird ja in diesem Zusammenhang viel über mehr direkte Demokratie diskutiert, mehr Bürgerversammlungen in Stadtteilen, mehr Bürgerbeteiligung. Ist das ein Weg, das politische Engagement zu steigern?
Schäfer: Je kleinräumiger direkte Beteiligung stattfindet, desto besser ist es. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie können direkt etwas in dem Stadtteil, in dem sie leben, verändern, dann könnte das einen Effekt haben. Direkte Demokratie per se, beispielsweise wenn man Volksabstimmungen auf Bundesebene einführt, hätte wahrscheinlich keinen sehr großen Effekt – im Gegenteil: Wir wissen, dass bei Volksabstimmungen tendenziell häufig die Beteiligung noch niedriger ist. Und eine niedrige Beteiligung ist eben in der Regel auch eine ungleiche Beteiligung.
Direkte Demokratie auf Bundesebene einzuführen, würde das Problem nicht lösen. Es könnte einen Effekt haben, mehr Mitsprachemöglichkeiten vor Ort zu schaffen, aber dann auch substanzielle Mitsprachemöglichkeiten und nicht nur Pro-Forma-Verfahren, wie wir sie häufig im Moment beobachten.
Deutschlandfunk Kultur: Aber sind es da nicht auch immer dieselben, die sich engagieren? Man gucke zum Beispiel mal in die Schulen, in die Elternbeiräte.
Schäfer: Ja, die Gefahr droht immer. Es gibt diese berühmten Bürgerhaushalte, die irgendwann überall eingeführt werden. Die kommen aus Südamerika, aus Brasilien, dort waren sie sehr erfolgreich, auch Menschen an die Politik heranzuführen, die dafür nicht prädestiniert waren. Und dann hat man das übernommen und in Europa, auch in Deutschland eingeführt, aber auf sehr eigenartige Art und Weise. Nämlich: Es konnte in diesen Bürgerhaushalten häufig nicht viel entschieden werden.
Ich habe mir das selber in Köln mal angeguckt. Da ging es im Wesentlichen darum, dass die dort Anwesenden Sparvorschläge machen sollten, aber es gab kein eigenes Budget, über das man bestimmen konnte. Auf diese Art und Weise ist es keine substanzielle Beteiligung, sondern eine Pro-Forma-Beteiligung. Da gehen dann nur noch politische Freaks hin, die sich sowieso wahnsinnig für Politik interessieren und abends nicht anderes zu tun haben und sagen: Dann gehe ich da auch noch hin.
Aber wenn es wirklich um Entscheidungen geht, die Konsequenzen haben, beispielsweise für die Gestaltung des Spielplatzes vor Ort oder der Schule vor Ort, dann könnte es möglicherweise einen Effekt haben.
Deutschlandfunk Kultur: Wir haben jetzt ja eine ganze Weile über diejenigen gesprochen, die im Grunde genommen resigniert haben, die sich desinteressiert zeigen. Aber wir haben in der Vergangenheit auch viel Wut auf den Straßen gesehen, zum Beispiel bei Pegida-Demonstrationen oder auch in Chemnitz bei diesen schweren rassistischen Ausschreitungen.
Wir bekommen hier in Deutschlandfunk Kultur auch ab und zu mal Briefe von Hörern, die uns einen Bürgerkrieg voraussagen. Wie geht es Ihnen als Demokrat, Herr Schäfer? Was ist Ihnen lieber, diese Wut oder die Resignation?
Schäfer: Rassistische Exzesse oder die Verletzung demokratischer Spielregeln kann sich natürlich niemand wünschen. Doch Wut, die vorhanden ist, aber nicht sichtbar wird, weil die Menschen nicht wählen gehen oder nicht auf die Straße gehen, ist, glaube ich, auch gefährlich. Die Menschen sind ja nicht wütend geworden, weil sie demonstrieren, sondern sie demonstrieren, weil sie wütend sind. Und diese Menschen waren lange Zeit nicht sichtbar, aber es gab sie ja trotzdem.
Insofern glaube ich, für eine Demokratie ist es wichtig, dass Unzufriedenheit sichtbar wird und artikuliert wird, denn nur dann kann man versuchen, zumindest Teile dieser Gruppe zu erreichen. Dann kann die Politik darauf reagieren, dann können auch neue Parteien entstehen. Das gehört auch dazu, dass bestimmte Anliegen durch andere, neue Parteien artikuliert werden. Und möglicherweise lässt sich die Unzufriedenheit, die Wut dadurch ein Stück weit bearbeiten.
Armin Schäfer lehrt Politikwissenschaft an der Universität Münster. Er ist Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW). Veröffentlichung u.a.: "Der Verlust politischer Gleichheit. Warum die sinkende Wahlbeteiligung der Demokratie schadet", Campus Verlag, Frankfurt am Main.






