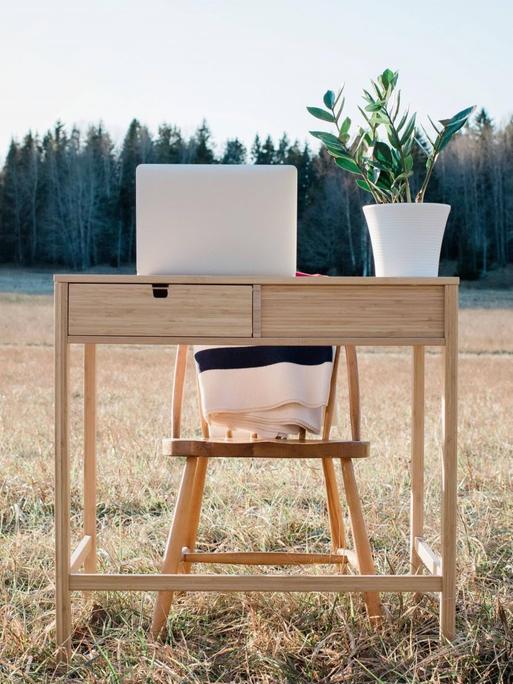In Hannover darf die Natur machen, was sie will
08:49 Minuten

Wenn auf Industriebrachen die Grillen zirpen und sich ehemalige Deponien renaturieren – dann könnte das Projekt "Städte wagen Wildnis" dahinterstecken. Das Beispiel Hannover zeigt, was passiert, wenn der Mensch der Natur die Regie überlässt.
"Das ist eine ehemalige Bodendeponie, gelegen zwischen der A2 und dem Mittellandkanal", erklärt Verena Butt. "Und das ist eine der zehn Flächen, die in der Stadt Hannover im Rahmen des Wildnisprojektes weiterentwickelt werden zugunsten von mehr Artenvielfalt und Naturerleben in der Stadt."
Die Landschaftsarchitektin ist Leiterin des hannoverschen Projektes "Städte wagen Wildnis". Sie erläutert: "An dieser Stelle wollen wir den experimentellen Ansatz wagen, zu gucken, was passiert, wenn wir nichts tun. Das heißt, wir lassen hier alles wachsen."
Ein Naturparadies offenbart sich hier allerdings noch nicht. Nur recht vorsichtig erobert sich die Natur den Raum der ehemaligen Deponie zurück, wo früher Bauschutt abgelagert wurde. Aber der erste Blick mag täuschen, erläutert Projektmitarbeiterin Solveig Hesse: "Das ist ganz interessant, weil hier viele im Boden nistende Insekten einen Lebensort finden."

Erzählen über das Projekt: Verena Butt und Solveig Hesse von "Städte wagen Wildnis" in Hannover.© Michael Hollenbach/Deutschlandradio
Zu entdecken sind hier auch unter anderem die Westliche Beißschrecke, die Blauflügelige Sandschrecke oder auch der Wiesengrashüpfer, der auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht. "Das Spannende an einer Fläche wie dieser ist, dass sie ständig im Wandel ist."
Auf die Kamille folgte die Goldrute
Zuerst war der Boden mit Kamille bedeckt, dann kam die Goldrute, eine eingewanderte Pflanze, die im Sommer mit ihren leuchtend gelben, vielen kleinen Blüten ins Auge fällt und die sich rasend schnell ausbreitet.
"Das ist auch das Spannende, dass man auf so einer Fläche stehen kann, und man hört die Autobahn rundherum und auch viele Flugzeuge am Himmel, und wenn man auf den Boden guckt, sieht man es kreuchen und fleuchen", schwärmt die Projektmitarbeiterin.
Solveig Hesse bietet normalerweise auch Führungen durch das "wilde Hannover" an. Hier zwischen der Autobahn und dem Mittellandkanal gab es eigentlich immer viele Schmetterlinge. Doch die letzten Jahre waren zu trocken.
Solveig Hesse bietet normalerweise auch Führungen durch das "wilde Hannover" an. Hier zwischen der Autobahn und dem Mittellandkanal gab es eigentlich immer viele Schmetterlinge. Doch die letzten Jahre waren zu trocken.
"Durch die Hitze und das fehlende Wasser gab es keine Schmetterlinge. Das heißt, wir mussten spontan Heuschrecken angucken. Damit kann man den Teilnehmern schön verdeutlichen, wie stark das Wetter und das Klima die Vegetation vor Ort beeinflussen", erläutert Hesse.
Auch eine Brache in der Stadt kann "Wildnis" sein
Das bundesweite Projekt trägt den Titel: "Städte wagen Wildnis". Aber was ist das überhaupt: "Wildnis"?
"Das ist ein kultureller Begriff, ein Begriff, der sich wandelt", erläutert die Landschaftsarchitektin Verena Butt. "Viele Leute denken an Urwälder oder Steppen und nicht an eine Brache in städtischer Umgebung. Wenn man zurückblickt, dann war Wildnis etwas Bedrohliches: Das waren eher die Bären und Wölfe. Erst mit der Verstädterung wurde Wildnis zu etwas Verklärt-Romantischem, weil es keine Bedrohung mehr war und man sich von ihr absetzen konnte."
In dem Projekt geht es vor allem darum, die Artenvielfalt auch in den Städten zu fördern und natürliche Erholungsräume auszuweiten. Zu dem Projekt gehört seit Neuestem auch ein Hörspaziergang. Das Audio kann man sich vor Ort aufs Smartphone herunterladen.
In dem Projekt geht es vor allem darum, die Artenvielfalt auch in den Städten zu fördern und natürliche Erholungsräume auszuweiten. Zu dem Projekt gehört seit Neuestem auch ein Hörspaziergang. Das Audio kann man sich vor Ort aufs Smartphone herunterladen.
"Und zwar läuft man 45 Minuten einen kleinen Rundweg entlang auf der Spitze vom Lindener Berg. Und an sechs Hörstationen kann man einiges über die Wildnis da erfahren und auch über die Historie von Linden", sagt Solveig Hesse.
Hörspaziergang mit quasselnder Assel
Geführt wird man auf diesem Hörspaziergang von der Assel Quassel. Eine große orangefarbene Assel findet man auch an allen Stelen, die an den jeweiligen Flächen auf das Projekt hinweisen.
"Wir haben uns für Asseln entschieden, weil wir was Außergewöhnliches haben wollten, so wie Wildnis auch außergewöhnlich ist in der Stadt. Wir fanden Asseln eigentlich gut, weil die Bodenlebewesen, die eigentlich übersehen werden, so wichtig sind für die Artenvielfalt und eben unsere Asseln in ganz groß zeigen, dass hier Wildnis ist."
Verena Butt und Solveig Hesse stehen im hannoverschen Stadtteil Badenstedt auf einer Weide, die seit sechs Jahren mehr oder weniger der Natur überlassen bleibt - "wo seither ganz extensiv nur wenige Wochen im Jahr mit wenigen Tieren eine Beweidung durchgeführt wird", sagt Butt.
Zuerst mit Rindern, doch die fraßen ausgerechnet jene Pflanzen, deren Wachstum man eigentlich fördern wollte. Nun kommen zwei Mal im Jahr einige Schafe.
Verena Butt und Solveig Hesse stehen im hannoverschen Stadtteil Badenstedt auf einer Weide, die seit sechs Jahren mehr oder weniger der Natur überlassen bleibt - "wo seither ganz extensiv nur wenige Wochen im Jahr mit wenigen Tieren eine Beweidung durchgeführt wird", sagt Butt.
Zuerst mit Rindern, doch die fraßen ausgerechnet jene Pflanzen, deren Wachstum man eigentlich fördern wollte. Nun kommen zwei Mal im Jahr einige Schafe.
"Das Besondere an der Fläche hier sind die vielen kleinen Schlehengebüsche", erklärt Solveig Hesse. "An der einen Seite ist eine lange Schlehenhecke. Schlehen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und andere Tiere."
Auch Kinder engagieren sich
Nicht weit von der Weide entfernt treffen sich die "Wildnisdetektive", eine Kindergruppe, die ebenfalls zu dem Projekt "Städte wagen Wildnis" gehört. Die 13-jährigen Björn und Noel sowie dessen achtjährige Schwester Emma sitzen auf einem Baumstamm vor einem kleinen Lagerfeuer.
- "Wir sammeln viel Müll auf, und wir erforschen Pflanzen."
- "Meistens Plastik und oft ist hier in der Fösse Brot und Brötchen, die irgendwelche reinwerfen."
- "Es gibt in der Wildnis immer viele Tiere, viele Vögel, besondere viele Eichelhäher und mehr Grünspechte als Buntspechte und viele Bodentiere: Spinnen, Ameisen, Regenwürmer."
- "Tausendfüßler, Kellerasseln und Schnecken."
- "Ich habe früher welche in der Klasse damit geärgert. Oder ich habe mal meine Lehrerin vor einer Spinne gerettet."
- "Meistens Plastik und oft ist hier in der Fösse Brot und Brötchen, die irgendwelche reinwerfen."
- "Es gibt in der Wildnis immer viele Tiere, viele Vögel, besondere viele Eichelhäher und mehr Grünspechte als Buntspechte und viele Bodentiere: Spinnen, Ameisen, Regenwürmer."
- "Tausendfüßler, Kellerasseln und Schnecken."
- "Ich habe früher welche in der Klasse damit geärgert. Oder ich habe mal meine Lehrerin vor einer Spinne gerettet."
Neben dem Treffpunkt der "Wildnisdetektive" fließt ein Bach – die Fösse – mit einer Besonderheit: "Die Fösse ist auch salzig, weil die von Natur aus auch salzig ist und es wird da leider auch viel von einer Fabrik reingeleitet. Und von den Kleingärten werden auch mal Stühle in die Fösse geworfen", klärt einer der Jungen auf.
Emma berichtet, wie sie den Salzgehalt der Fösse getestet haben: "Wir haben mal so Wasser aufgefangen, und das in den Löffel gemacht und dann Kerzen drunter gemacht und dann war da Salz drin."

Die "Wildnisdetektive" Emma, Noel und Björn© Michael Hollenbach/Deutschlandradio
Tier- und Pflanzenwelt an der Fösse
Der Bach ist sogar salziger als die Nordsee, sagt Verena Butt: "Das bedeutet auch, dass nicht viele Lebewesen mit den besonderen Bedingungen klarkommen. Was allerdings dazu führt, dass hier ganz besondere Tier- und Pflanzenarten vorkommen, die man hier sonst nicht treffen würde."
Zum Beispiel den Queller, die Strandaster, den Stranddreizack und die Salzbunge: "Das sind alles sehr salzliebende Pflanzen und das macht das zu einer Rarität und zu einer absoluten Besonderheit."
Zum Beispiel den Queller, die Strandaster, den Stranddreizack und die Salzbunge: "Das sind alles sehr salzliebende Pflanzen und das macht das zu einer Rarität und zu einer absoluten Besonderheit."
Entlang der Fösse wird zweimal im Jahr gemäht, damit sich hier auch Pflanzen entwickeln können, die viel Sonne brauchen. Für das Projekt hat man allerdings einen speziellen Kreiselmäher angeschafft.
"Und zwar wird bei den normalen Mähern das Mahdgut angesogen und zerkleinert und verbleibt dann auf der Fläche", erläutert Verena Butt. "Hier ist es so, dass wir einen Kreiselmäher haben, der das Gras abschneidet, und zusammengetragen wird – wie man das von der Heugewinnung kennt Uund das hat das Ziel, dass die Tiere langsam da rausweichen können."
Die Hannoveraner wollen mehr davon
Das Projekt "Städte wagen Wildnis" komme bei den Hannoveranern gut an, meint die Landschaftsarchitektin. "Wir waren uns erst nicht sicher, ob das auch als Verwahrlosung wahrgenommen werden könnte. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Wir haben eher die Rückmeldung, wir finden das schön, wir wollen davon mehr."
Das Projekt läuft Ende des Jahres aus. Doch mehr Wildnis wagen – das will Hannover auch in Zukunft.
Das Projekt läuft Ende des Jahres aus. Doch mehr Wildnis wagen – das will Hannover auch in Zukunft.