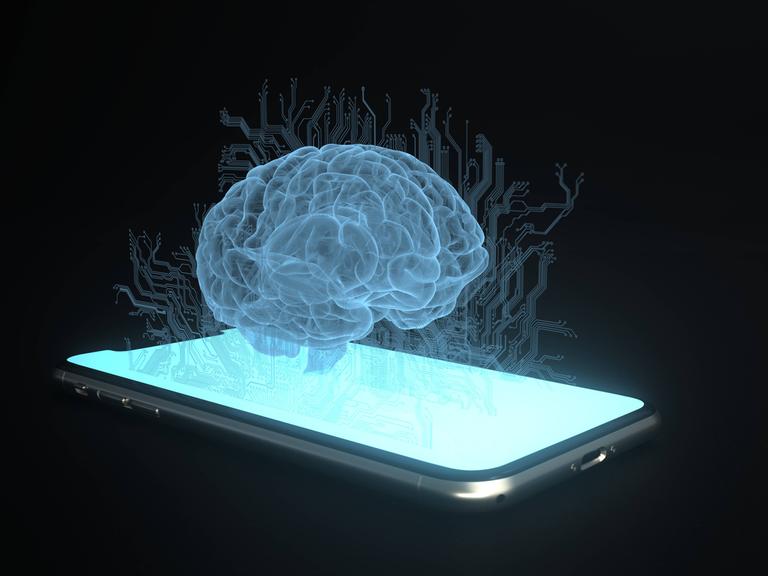Psychische Erkrankungen

Besonders Mädchen waren 2022 häufiger in stationärer Behandlung wegen psychischer Erkrankungen als 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. © imago / Ikon Images /Gary Waters
Mädchen sind besonders oft wegen Angststörungen in Behandlung

Depressionen, Angst- und Essstörungen: Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen haben seit der Corona-Pandemie stark zugenommen. Eine DAK-Studie zeigt nun: Die Behandlungszahlen vor allem bei Mädchen sind enorm gestiegen.
Der psychische Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist laut einer neuen Studie der DAK-Krankenkasse besorgniserregend. Besonders bei Mädchen nahmen Angst- und Essstörungen sowie Depressionen 2022 im Vergleich zu 2019 erheblich zu.
Die Corona-Pandemie wirkt nach, doch sie ist es nicht allein: Angesichts weiterer psychischer Belastungen durch Krisen wie den Krieg in der Ukraine und die Klimakatastrophe sehen Experten wachsende Zukunftsängste bei jungen Menschen – und warnen vor einer „Mental-Health-Pandemie“.
Umso wichtiger ist es, die Resilienz zu stärken und eine flächendeckende Prävention in Deutschland zu etablieren.
Was sind die zentralen Ergebnisse der DAK-Studie?
Für den DAK-Kinder- und Jugendreport 2023 wurden Krankenhausdaten von rund 786.000 Kindern und Jugendlichen in den Jahren 2018 bis 2022 ausgewertet. Vergleiche stellten die Forscherinnen und Forscher vor allem zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 an.
Deutlich mehr Angststörungen, Esstörungen und Depressionen
Im Jahr 2022 wurden ein Drittel mehr Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren mit einer Angststörung in Kliniken behandelt als 2019. Bundesweit hochgerechnet waren das rund 6.900 Mädchen – ein neuer Höchststand. Im Vergleich dazu waren die Fallzahlen zwischen 2018 und 2020 konstant, 2021 und 2022 nahmen sie der Studie zufolge kontinuierlich zu.
Essstörungen bei Mädchen nahmen ebenfalls auffallend zu: Die Krankenhäuser verzeichneten zwischen 2019 und 2022 einen Anstieg um 52 Prozent. Hochgerechnet bedeutet das: 3.900 Teenagerinnen wurden wenigstens einmal mit Essstörungen im Krankenhaus behandelt.
Stationär behandelte Depressionen stiegen bei Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren im Jahr 2022 um fast ein Viertel gegenüber 2019. Von 1.000 jugendlichen Mädchen wurden im Jahr 2022 14,5 Prozent wenigstens einmal mit Depressionen im Krankenhaus behandelt, heißt es in der Studie.
Essstörungen nach Wegfall fester Tagesstrukturen
Für Tobias Renner, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiater am Universitätsklinikum, sind die Ergebnisse keine Überraschung: „Die Daten der DAK decken sich auch mit Auswertungen anderer Krankenkassen und spiegeln absolut unseren klinischen Alltag wider. Wir haben einen enormen Anstieg zu verzeichnen.“
Insbesondere zu Essstörungen hört er von Jugendlichen oft mehrere Erklärungen: Danach machten ihnen während der Pandemie vor allem der Wegfall der Tagesstrukturen, von Sport und sozialen Kontakten zu schaffen. In der Entwicklung einer Essstörung hätten Betroffene wieder „Halt“ gefunden – zu einem „sehr hohen Preis“. Dazu habe auch der vermehrte Aufenthalt bei Social Media beigetragen. Dort seien sie mit Körperbildern und Influencern in Kontakt gekommen, die ihnen „sehr ungute Lebensstile“ vorgelebt hätten.
Insgesamt allerdings ergibt die DAK-Analyse, dass 2022 weniger Kinder und Jugendliche mit psychischen oder Verhaltensstörungen in Krankenhäusern behandelt wurden als noch vor der Pandemie: bei Teenagern 15 Prozent weniger, bei Schulkindern fast ein Viertel weniger.
Dahinter könnten die geringeren Kapazitäten an den Kliniken während der Pandemie stecken, vermutet Christoph Correll, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Berliner Charité.
Warum sind Mädchen stärker betroffen als Jungen?
Auffallend an der DAK-Studie ist insgesamt ein „Gender Gap“: Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren sind viel häufiger wegen psychischer Erkrankungen in Kliniken zur Behandlung als Jungen. So führt die Studie an, dass zum Beispiel von hochgerechnet 19.500 Jugendlichen mit einer stationären Behandlung wegen Depressionen drei Viertel Mädchen waren.
Dennoch seien Jungen nicht „unbeschadet“ durch die Pandemie gekommen, betont der Arzt Tobias Renner. Im Gegenteil: Auch bei ihnen stellt er eine deutliche Zunahme der Erkrankungen fest. Die Zahlen würden sogar wahrscheinlich unterschätzt, weil sich männliche Jugendliche weniger häufig Hilfe suchten.
Auch wenn man das nicht für jede Person verallgemeinern könne: Aber Jungen würden auf Problemlagen eher nach außen reagieren, erklärt Renner. Sie würden dann zum Beispiel aggressiv auftreten. Mädchen hingegen würden meist so genannte „internalisierende Störungen“ aufweisen, also eher Ängste und auch Depressionen entwickeln. Bei Essstörungen sei das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen schon immer zehn zu eins gewesen.
Eine Analyse zu ambulanten Behandlungen, die Verhaltens- und emotionale Störungen von Jungen eher widerspiegeln würden, steht noch aus.
Wird es nach der Pandemie besser?
Danach sieht es nicht aus. Der Soziologe Claus Hurrelmann sprach kürzlich von einer jungen Generation im „Dauerkrisenmodus“. Christoph Corell von der Berliner Charité spricht von einer „Mental-Health-Pandemie, deren Auswirkungen erst nach und nach sichtbar werden“.
"Während der Pandemie wurde viel auf die Belastungskonten von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen eingezahlt. Das ist nicht mit der Aufhebung der Pandemiemaßnahmen gelöscht", betont auch der Tübinger Arzt Tobias Renner.
Ob Krieg gegen die Ukraine oder Klimakrise: Nach Renners Ansicht bleiben neben der Pandemie oft andere Belastungsfaktoren für Kinder und Jugendliche außen vor. „Wir haben immer wieder auch große Krisen, die uns täglich bewegen, mit denen die Kinder und die Familien umgehen müssen. Sie da zu stärken, dass sie da krisenfester werden, sprich eine Resilienz entwickeln können, das ist eine Aufgabe, der wir nachgehen müssen.“
Welche Hilfen sind für psychisch kranke Kinder notwendig?
Neben der ärztlichen Versorgung sieht der Arzt Präventionsarbeit als besonders wichtig an, und zwar systemübergreifend: vom Gesundheitssystem über das Bildungssystem bis hin zu Bewegungsangeboten. „Es wird seit langer Zeit diskutiert, wir haben aber trotzdem keine umfassende flächendeckende Prävention zur Verfügung. Das ist alles regional.“
Es bleibt darüber hinaus das große Problem, dass die Wartezeiten für psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen gestiegen sind. Mitunter vergehen Monate, bis Betroffene die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Auch in der ambulanten Psychotherapie waren die Plätze schon vor Corona knapp. Inzwischen warten Kinder und Jugendliche doppelt so lange auf eine Therapie wie vor der Pandemie: im Durchschnitt sechs Monate, in ländlichen Regionen sogar ein Jahr, sagt der Leipziger Psychotherapeut Schmitz, der mit seinem Team über 300 Therapeutinnen und Therapeuten befragt hat.
Man darf ja nicht vergessen, dass man erst ins ambulante Versorgungssystem kommt, dauert teilweise ein Jahr. Wenn da festgestellt wird, es gibt eine stationäre Indikation, dann dauert es wieder ein Jahr. Und wir sehen Mädchen und Jungen mit wiederkehrenden Suizidgedanken, wir sehen Kinder und Jugendliche, die eine manifeste Essproblematik haben und die finden keine Versorgung. Und was das bedeutet für die Biografie der Kinder, aber für die Belastung der Eltern. Die werden schier verrückt, weil sie sehen, den Kindern geht es wahnsinnig schlecht und sie kriegen einfach keine Hilfe, das ist einfach.
Schnelle Hilfsangebote per Telefon
Man dürfe dennoch „absolut nicht zögern“, sich Hilfe zu holen, betont Tobias Renner. Regional gebe es viele Beratungsstellen neben dem Gesundheitssystem: „Wer Sorgen hat, soll sich unbedingt hier Beratung und Einschätzung holen.“ Er verweist auf niedrigschwellige Angebote, die Nummer gegen Kummer zum Beispiel.
Zudem kann man bei der Telefonseelsorge anrufen oder sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst wenden, den es in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt. Der Sozialpsychiatrische Dienst hilft in Krisensituationen und berät und vermittelt weitere Hilfe. Auch die Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Caritas und Diakonie bieten psychosoziale Beratung an. Im akuten Notfall, wenn schnelle Hilfe nötig ist, insbesondere bei konkreten Suizidgedanken, ruft man den ärztlichen Notdienst oder die 112 an oder geht in die nächstgelegene psychiatrische Klinik. In vielen Städten gibt es auch Krankenhäuser mit Krisen- oder speziellen Depressionsambulanzen.
bth