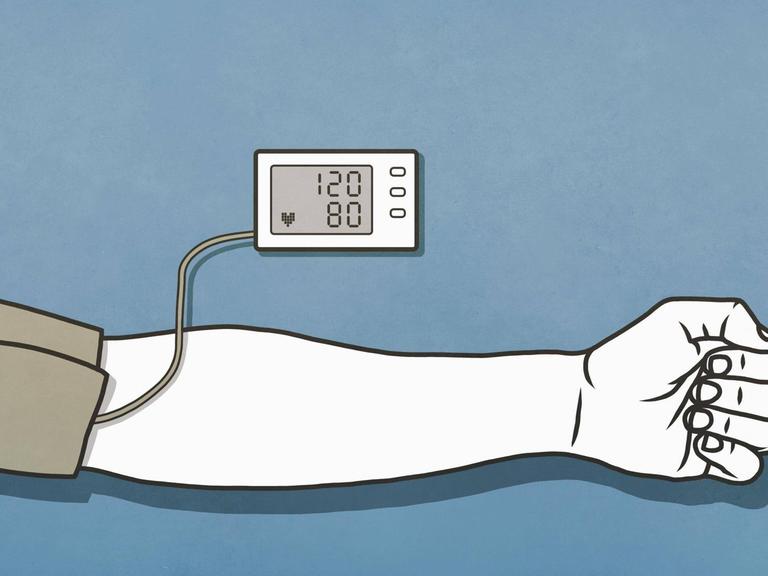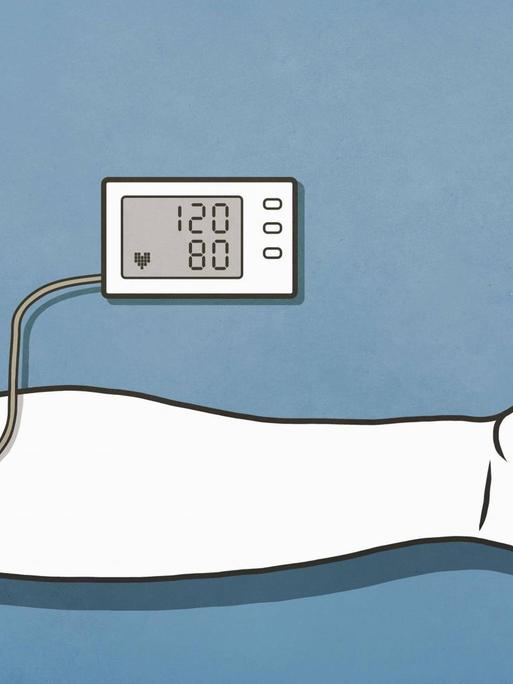Thorsten Padberg arbeitet als Verhaltenstherapeut, Dozent und Supervisor in Berlin. Er beschäftigt sich mit der Wirksamkeit und den gesellschaftlichen Auswirkungen von Psychotherapie, Psychiatrischer Diagnostik und Psychopharmaka. Zudem schreibt er als freier Journalist für verschiedene Medien sowie wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Zeitschriften. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Die Depressions-Falle. Wie wir Menschen helfen, statt sie für krank zu erklären“ (Verlag S. Fischer).
Psychische Krankheiten
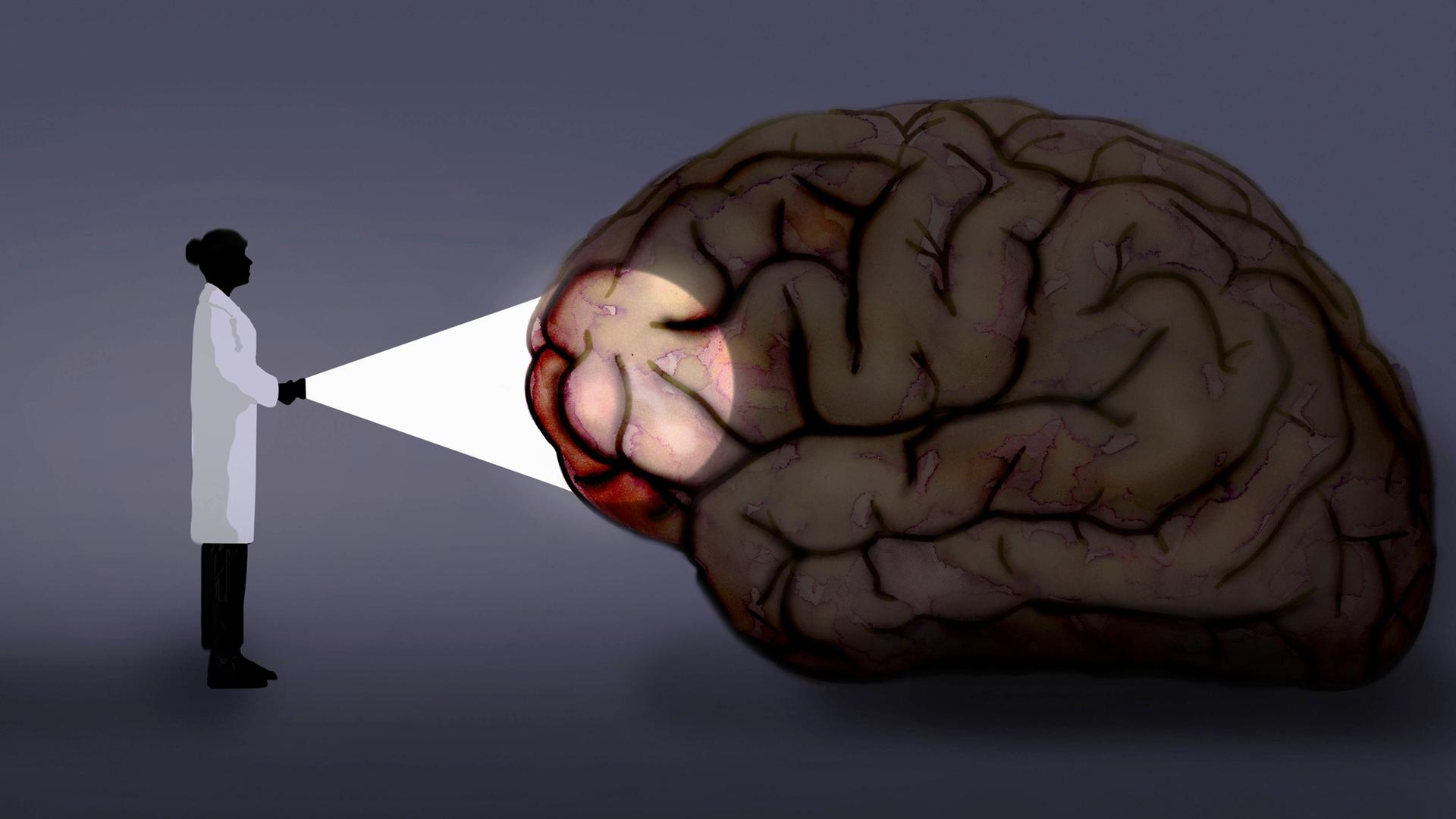
Kampagnen der letzten Jahrzehnte, die über psychische Probleme aufklären wollten, haben die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, sagt Thorrsten Padberg. © IMAGO / Ikon Images / Gary Waters
Aufklären statt dramatisieren
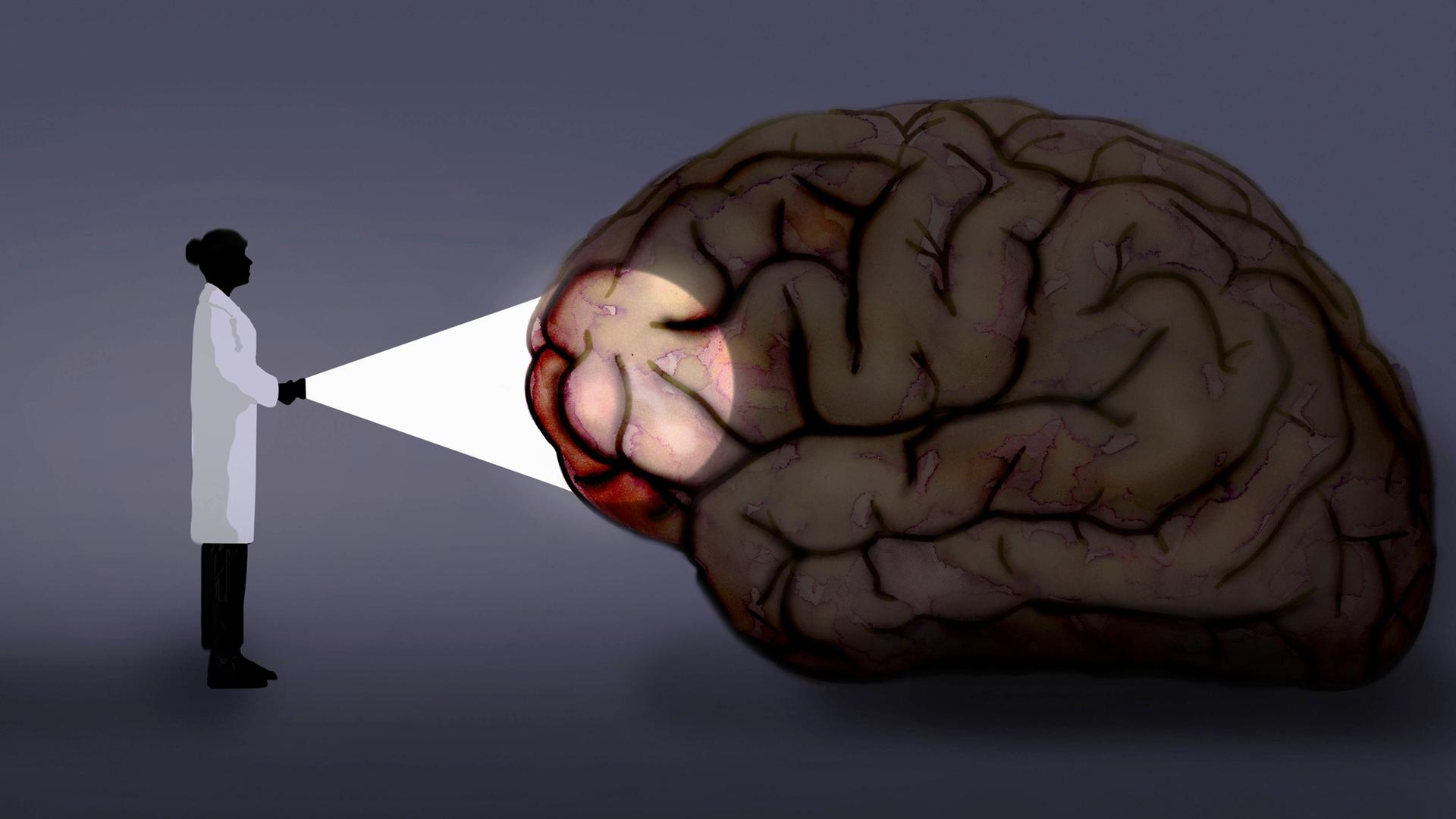
Betroffene unterstützen, Erkrankungen vorbeugen - das sind Ziele der Berichterstattung über psychische Störungen. Doch statt sachlich aufzuklären, folgt sie oft dem Muster "schlimmer, böser, kränker", kritisiert Verhaltenstherapeut Thorsten Padberg.
Eine Fernseh-Dokumentation berichtete unlängst ausführlich über eine Frau, die an einer „Dissoziativen Identitätsstörung“ leidet, also mit (in ihrem Fall zwölf) verschiedenen Persönlichkeiten lebt, die voneinander gar nichts wissen. Als Auslöser gelten schwerster sexueller Missbrauch bis hin zu satanistischen Ritualen. Im Beitrag heißt es, über 800.000 Deutsche litten an der gleichen Krankheit, wie immer leider unterdiagnostiziert. Geradezu unglaublich!
Der Beitrag wurde auf sozialen Medien weit verbreitet, viele durchaus seriöse Pressequellen fanden ihn sehenswert. Faszinierend war es ja auch wirklich, ihr beim sogenannten „Switch“ von einer reflektierten Vierzigerin zum Benehmen einer Vierjährigen zuzuschauen. Aber ist es auch hilfreich?
Diagnose umstritten, Zahl geschätzt
Denn die ganze Diagnose ist hoch umstritten. Die angeblich in die Hundertausende gehende Zahl der Betroffenen ist eine Schätzung, die von engagierten Aktivist*innen in die Welt gesetzt wurde. Die wolkig formulierten Fragebögen, mit denen die Störung „entdeckt“ wird, produzieren massenhaft Fehlbefunde. Manche fürchten, die Symptomatik würde durch eine wohlmeinende, aber fehlgeleitete Psychotherapie erst erzeugt. Warum werden solche Geschichten dennoch von den Medien verbreitet?
Wenn über psychische Störungen berichtet wird, geschieht das oft mit der Absicht, eine Lanze für die Betroffenen zu brechen und weiteren Erkrankungen vorzubeugen. Auf die seelische Gesundheit müsse man achten, heißt es, und für uns alle sei es wichtig, die Symptome psychischer Krankheiten gut zu kennen.
Wenn Aufklärung scheitert
Die Medien informieren deshalb und erzählen vom Leben der Betroffenen. Prominente bekennen sich zu ihren psychischen Problemen. Jede und jeder kann noch ein weiteres schmerzhaftes Detail hinzufügen. So weit so gut. Doch nicht alles, was psychologisch interessant ist, ist auch relevant. Und manches kann sogar schaden.
So haben die Kampagnen der letzten Jahrzehnte, die über psychische Probleme als „Krankheiten wie jede andere, die jeden treffen“ aufklären wollten, die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Weder minderten sie das mit ihnen verbundene Stigma, noch senkten sie die Raten der Betroffenen.
Nachdem zum Beispiel in Australien ein ganzes Jahrzehnt auf allen Kanälen für die höhere Akzeptanz von Depressionen getrommelt worden war, schossen die Raten besonders bei denjenigen in die Höhe, die von der Kampagne gut erreicht worden waren. Die Forscher schlossen daraus, so wenig wie möglich über Depressionen zu wissen, stelle — anders als erwartet — einen echten Schutzfaktor dar. Vielleicht wäre das mal eine Meldung wert?
Urteilsbildung der Betroffenen ermöglichen
Oder das: Jüngst entzogen Forscher*innen in Großbritannien der Idee, Depressionen würden durch einen Mangel des Hormons Serotonin erzeugt, den Boden. Während vom „Guardian“ bis zur „Times“ ganzseitige Feature zu lesen waren, wurde in Deutschland fast gar nicht darüber berichtet oder äußerst kritisch.
Vielleicht hielten die Redakteur*innen es für zu verwirrend, weil die meistverordneten Depressionsmedikamente „Serotoninwiederaufnahmehemmer“ heißen? Es erschien fast so, als wollten die beteiligten Redakteur*innen die Bevölkerung davor beschützen, sich allzusehr mit der Studienlage auseinandersetzen zu müssen. Freilich nehmen sie dadurch den Betroffenen die Möglichkeit, sich selbst ein Urteil über ihre Behandlung bilden zu können.
In der Berichterstattung über die psychische Gesundheit darf es nicht um schlimmer, böser, kränker gehen. Wer sich mit gutem Grund auf die Seite der Leidenden stellt, dient ihnen nicht unbedingt, indem er dieses Leiden dramatisiert. Menschen mit psychischen Problemen hilft man mit fundierten, sachlichen Informationen viel besser.