Dana Buchzik hat selbst Erfahrungen mit einer radikalen Gemeinschaft gemacht: Sie wurde in einer Sekte groß, aus der sie später ausstieg. Sie arbeitete als Kulturjournalistin und leitete die "No Hate Speech"-Kampagne. In Workshops und Beratungsgesprächen erklärt sie, wie mit Hass und Verschwörungserzählungen umgegangen werden kann.
Ihr Buch "Warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren – und wie wir sie zurückholen können“ ist im Rowohlt Verlag erschienen.
Umgang mit Radikalisierung
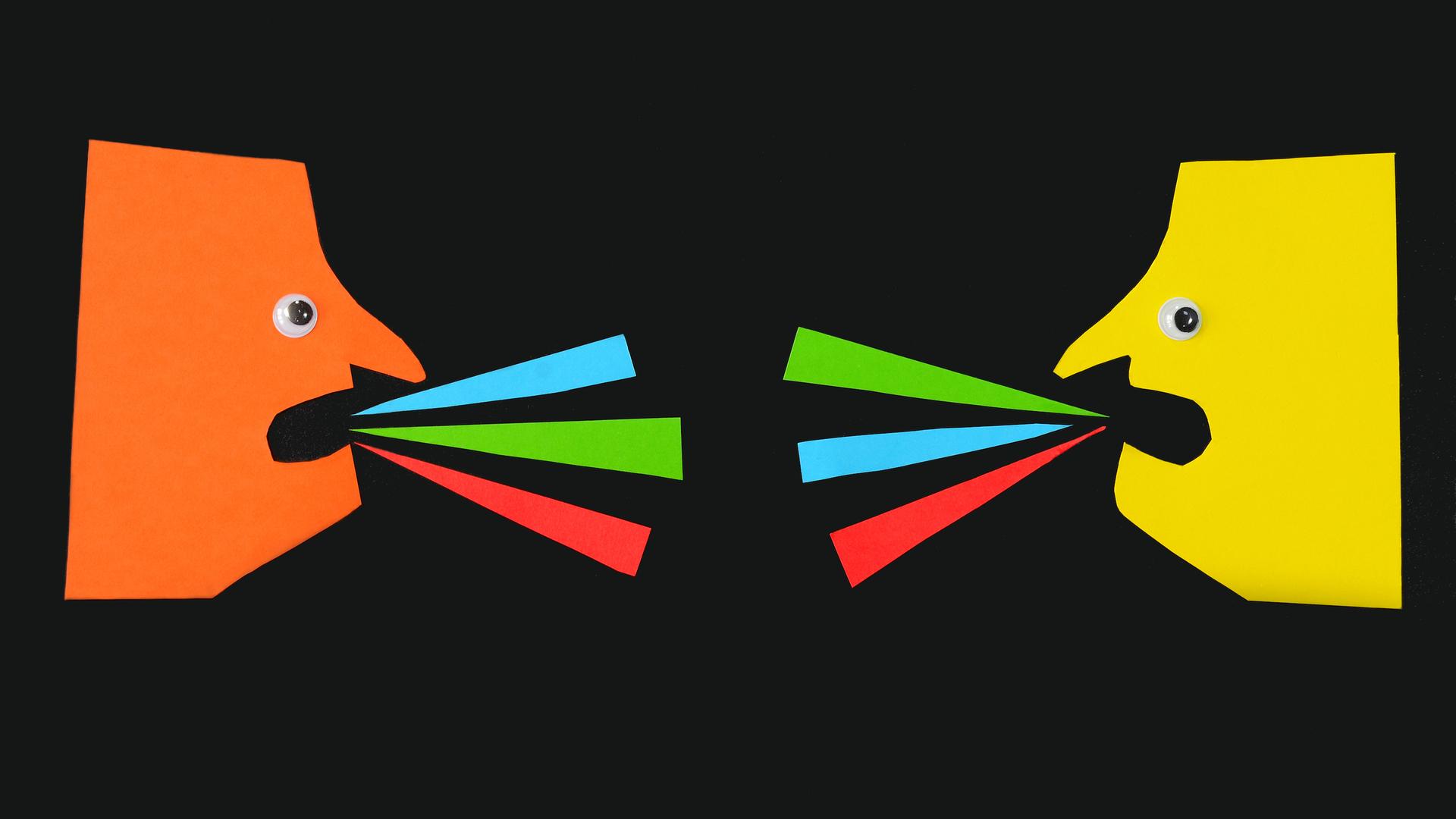
„Wichtig ist immer, auf der Beziehungsebene zu bleiben“, sagt Buchzik und rät, „nicht ins Faktenbingo“ hineinzurutschen. © Getty Images / jayk7
Warum Faktenbingo nicht weiterhilft
08:39 Minuten
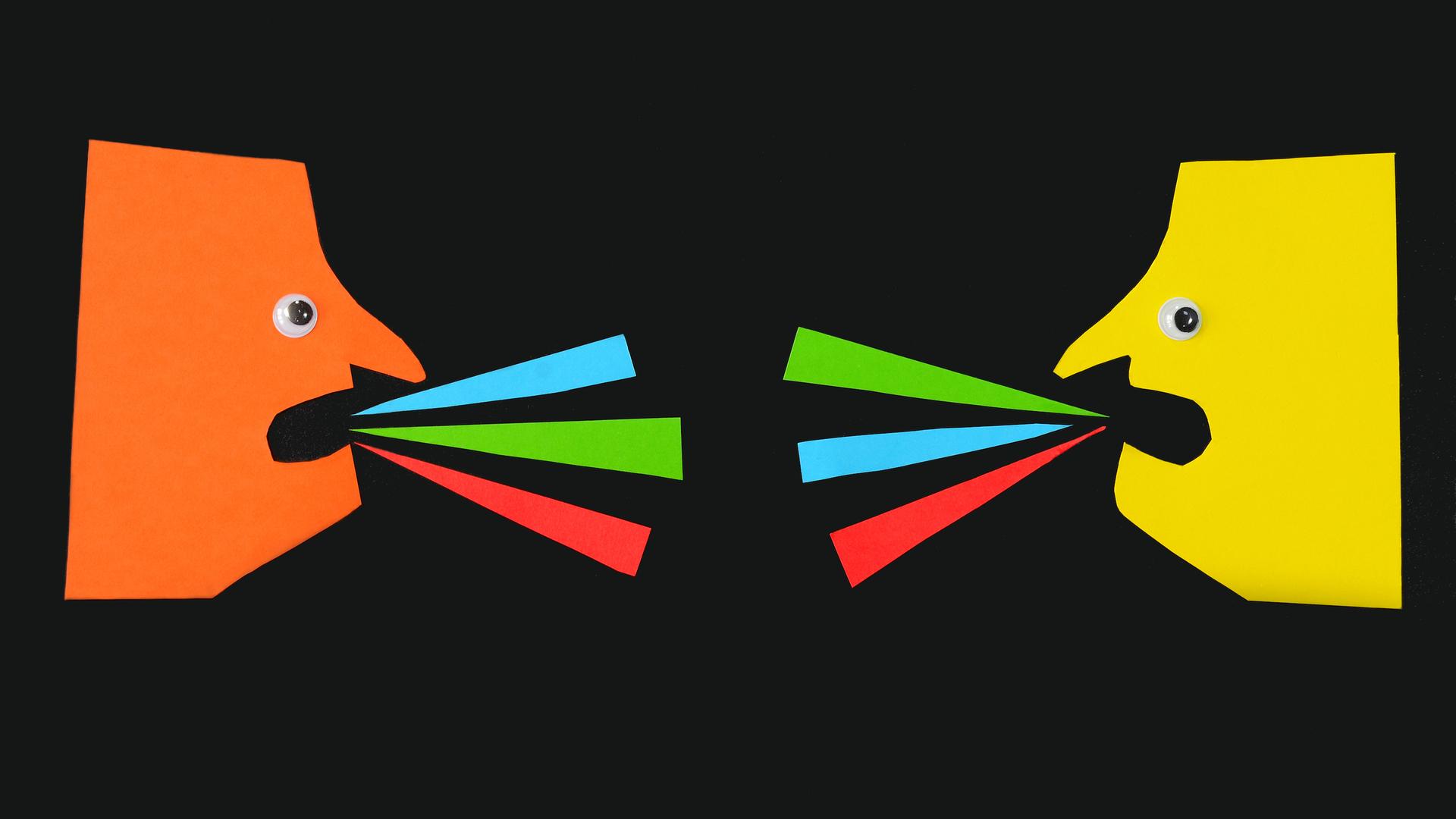
Wie hält man Kontakt zu Menschen, die in politische Parallelwelten abgedriftet sind? Mit Fakten überzeugt man das Gegenüber meist nicht, warnt die Autorin Dana Buchzik. Sie rät zu einer anderen Strategie für den Umgang mit radikalisierten Personen.
Ob sogenannte Querdenker, Verschwörungsanhänger oder politisch Radikalisierte: Der Umgang mit Menschen aus diesen Gruppen ist nicht einfach, Konflikte belasten Freundeskreise und Familien. Besonders häufig derzeit im Fokus des Streits: die Coronamaßnahmen.
Die Autorin Dana Buchzik berät Angehörige und Freunde von radikalisierten Personen und trifft dabei oft auf Verzweiflung und Ratlosigkeit. Sie hat zu dem Thema ein Buch geschrieben: "Warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren – und wie wir sie zurückholen können“.
Wer ist anfällig für Radikalisierung?
Buchzik verweist auf Erkenntnisse der Forschung, wonach niemand vor radikalisierenden Einflüssen geschützt ist. Vielmehr gilt sogar: je privilegierter, desto anfälliger. "Das Narrativ der unanfechtbaren Mitte oder der nicht radikalen Mitte ist tatsächlich eines, wovon wir uns verabschieden sollten", sagt Buchzik.
Es sei hilfreich, die "Gefahr im Alltag immer mitzudenken", betont sie. Je mehr man sich mit Manipulationstechniken radikaler Missionare auseinandersetze, desto mehr könne man sich selbst schützen. Dazu zählen laut Buchzik zum Beispiel sogenannte "love bombings": "Wenn jemand eine radikale Gruppe kennenlernt, wird er mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Schmeicheleien überschüttet."
Lassen sich Radikalisierte von Fakten überzeugen?
"Wichtig ist immer, auf der Beziehungsebene zu bleiben", sagt Buchzik und rät, "nicht ins Faktenbingo" hineinzurutschen. Ein Raucher werfe auch nicht sofort die Zigaretten weg, wenn man ihm sage, dass Rauchen ungesund sei.

Dana Buchzik setzt auf kleine Ziele statt auf das große Rettungsszenario.© Caroline Pitzke
Man müsse verstehen, "dass Radikalisierung für unser Gegenüber eine emotionale Funktion erfüllt", erklärt die Autorin. Dagegen komme man mit Diskussionen nicht an. Es gehe vielmehr darum, "das Miteinander zu stärken". Aus einer Beziehung heraus könne man dann überlegen, wie man seinem Gegenüber die "Tür zurück in die Welt" öffnen könne.
Wie lassen sich Gesprächskanäle öffnen?
Dabei sollte Buchzik zufolge der Grundsatz gelten: auf Augenhöhe begegnen, respektvoll und authentisch sein. Vor ihren Beratungen verschickt sie einen standardisierten Fragebogen: Er soll ihr Klarheit darüber bringen, welche Funktion die Radikalisierung bei der jeweiligen Person erfüllt, wie das Miteinander aussieht, wo der Streit beginnt. Sie hat drei Empfehlungen für Angehörige und Freunde:
- Sich realistische Ziele setzen:
- Grenzen setzen und dabei wertschätzend bleiben:
- Sich Allianzen suchen:






