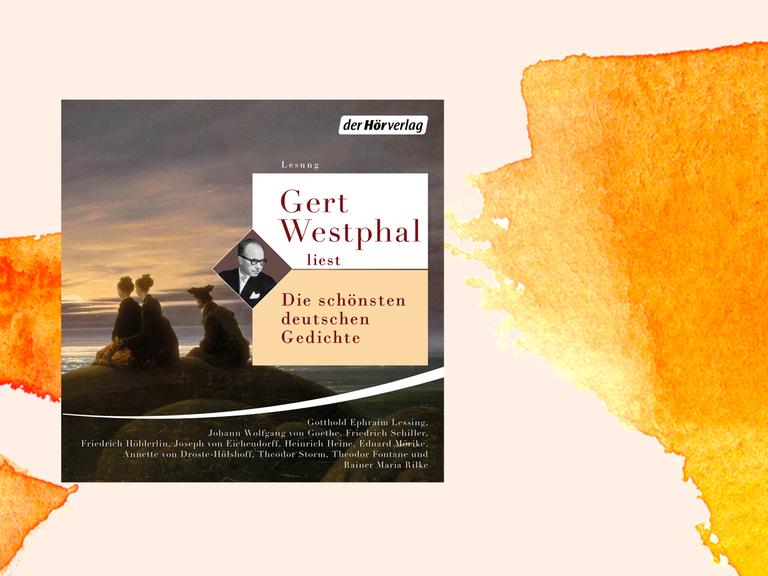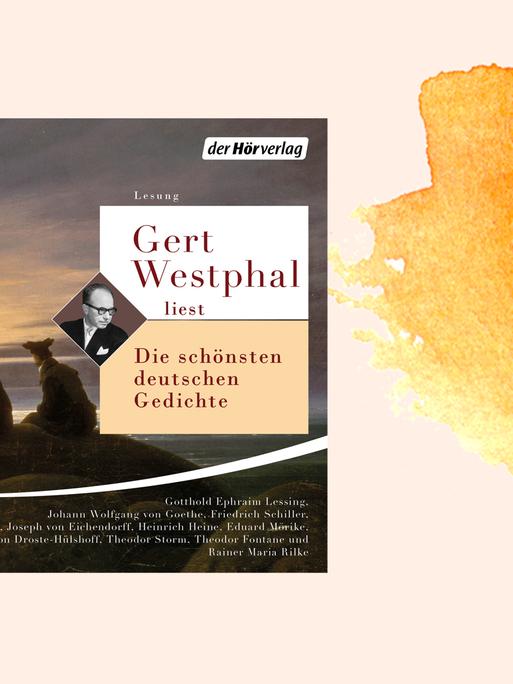Im Winter 1912 beginnt der Dichter Rainer Maria Rilke auf Schloss Duino in der Nähe von Triest mit einer Reihe von Elegien, die er zehn Jahre später nach langer Schaffenskrise 1922 beendet. Es sind die zehn „Duineser Elegien”, wie er sie im Andenken an das Schloss genannt hat. Dieses späte Werk Rilkes ist geprägt von den Brüchen der Moderne, vom Ringen des Dichters um eine Deutung menschlichen Daseins mit den Mitteln der Lyrik, aber ebenso von der Zeit des Ersten Weltkriegs.
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem
stärkeren Dasein.
Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
aus Rainer Maria Rilkes "Duineser Elegien"
„Mit einem größeren Abstand wiedergelesen hat mich erstaunt, wie stark dialogisch Rilkes Elegien sind", erzählt die Dichterin Monika Rinck, die zur Zeit Professorin am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien ist. "Es beginnt ja direkt mit einer Frage 'Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?' Es kommt aber eigentlich immer nur eine Antwort, die an der Frage vorbeigeht, und das ergibt eine eigenartige, nicht finale Rhythmik, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt."
Die "Duineser Elegien" heute gelesen
Zwei Dichterinnen und zwei Dichter sprechen über die "Duineser Elegien" und ihr Verhältnis zu diesem Spätwerk Rainer Maria Rilkes sowie über ihre neuerlichen Lesererfahrungen.
Christian Lehnert, Dichter und Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts an der Universität Leipzig, meint: „In diesen Zeilen findet sich ja eine Epochenfrage, einer Epoche, der wir noch immer angehören, die wir dabei sind zu verlassen, und wir wissen im Moment gerade gar nicht wohin. Menschen fühlen heute zunehmend, dass sie nicht ganz zu Haus sind in der gedeuteten Welt. Der Mensch ist brüchig geworden, und wo uns diese Verunsicherung hinführt, ist noch nicht ausgemacht.“
Kerstin Preiwuß, Dichterin und Professorin für Literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, erläutert: "Jetzt beim Wiederlesen habe ich mich gefragt: Was dringt am meisten zu mir durch? Was schafft es, mich auch sprachlich am meisten zu beschäftigen? Es sind nicht die hymnischen Anklänge, sondern wenn er einsilbig wird und es sich verengt, dann sagt er mir am meisten zu.“
Henning Ziebritzki, Dichter und Leiter des Verlags Mohr Siebeck in Tübingen, ergänzt: „Rilke hat den Ersten Weltkrieg erlebt. Er war eingezogen. Europa war verwüstet, die Urkatastrophe der Moderne. Das Interessante ist, dass Rilke trotzdem den Abstand und die innere Kraft gefunden hatte, sich so einem Werk zuzuwenden, in dem davon jedenfalls vordergründig nichts zu spüren ist.“
Erinnerungen an Schloss Duino
Im Februar 1922 hatte Rainer Maria Rilke die Arbeit an einer Sammlung von zehn Elegien abgeschlossen und ihr den Namen "Duineser Elegien" gegeben. Zehn Jahre hatte es gebraucht, um sie zu vollenden. In einem Brief erklärte er 1923:
Die Elegien heißen die "Duineser" zu Erinnerung an das Schloss Duino, wo, in der Einsamkeit eines unbeschreiblichen Winters 1912, die ersten beiden Gedichte (und manche Bruchstücke der geplanten weiteren) geschrieben wurden. Der Umstand, dass das Schloss am Ende des Krieges zerstört worden ist, hat dazu beigetragen, den Namen des Hauses für immer in ihren Zusammenhang einzubeziehen.
Rainer Maria Rilke in einem Brief aus dem Jahr 1923
Das Schloss Duino in der Nähe von Triest war 1916 durch Artilleriebeschuss weitgehend zerstört worden. Bereits in den 1920er-Jahren wurde es originalgetreu wiederaufgebaut.
"Jeder Engel ist schrecklich"
Monika Rinck erinnert sich an einen Besuch: „Ich war vor einigen Jahren auf Schloss Duino. Wir standen auf diesem Hof und sahen, wie die Mauersegler und die Schwalben wirklich halsbrecherische Manöver flogen. Wir überlegten kurz: Möglicherweise sind genau dies die schrecklichen Engel, diese so entschlossenen und willkürlichen Flugmanöver der Schwalben auf Schloss Duino.“
Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir,
ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele,
wissend um euch.
aus Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“
„Engel kommen aus dem, wofür mir noch die Worte fehlen. Vielfach sind die Engel bei Rilke Wesen, die einen poetischen Impuls auslösen“, sagt Christian Lehnert. „Das eigene kreative Sprechen setzt immer irgendwo an, wo ich noch nicht bin, vor mir, vor dem Eigenen. Das umschreibt Rilke vielfach mit den Engeln, Zwischenwesen zwischen Eigenem und Fremdem. Und Rilke schreibt ja selbst, dass er diese ersten Verse gewissermaßen wie ein Diktat empfangen hat.“
Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie sonst nur
Heilige hörten.
Nicht, dass du Gottes ertrügest
die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende höre,
die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet.
aus Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“
Die Elegien und der Krieg
Doch nach den ersten beiden Elegien stockt der poetische Impuls. Im Mai 1912 verlässt der Dichter Schloss Duino und stürzt sich in eine rastlose Reisetätigkeit. 1915 ist Rilke in München. Dort entsteht in kürzester Zeit die vierte Elegie. Der kreative Aufschwung findet jedoch ein abruptes Ende, als ihn Ende November 1915 der Musterungsbefehl erreicht und er für tauglich befunden wird.
Ich habe am 4. Januar nach Turnau einzurücken, was wärs mir gewesen, jetzt, da sie endlich wieder sich geben wollte, an meiner Arbeit zu bleiben. Was ahnte ich nicht alles, was glühte nicht alles in mir eben noch, vor dieser Verschüttung.
Rainer Maria Rilke
"Ich bin aufgrund der aktuellen Situation des Krieges jäh in der vierten Elegie gelandet“, sagt Kerstin Preiwuß. „Jetzt muss man wissen, dass die vierte Elegie die einzige ist, die er in der Zeit des Ersten Weltkriegs geschrieben hat. Das wirft natürlich die Frage auf, die mich extrem beschäftigt und erschüttert: Wie verhalte ich mich jetzt dichterisch im Krieg? Und wie hat Rilke sich dichterisch verhalten gegenüber dem Krieg? Der Erste Weltkrieg war auch eine Zäsur in der bisher gedeuteten Welt, einer immerfort gedeuteten Welt, die sich aber nicht mehr deuten lässt. Vielleicht war das ein Problem.“
O BÄUME Lebens, o wann winterlich?
Wir sind nicht einig. Sind nicht wie die Zug-
vögel verständigt. Überholt und spät,
so drängen wir uns plötzlich Winden auf
und fallen ein auf teilnahmslosen Teich.
aus Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“
„Ich finde da die Unwissenheit dargestellt und dieses überrannt zu werden, und nicht reagieren zu können, nicht wie die Zugvögel, denen das Wissen eingeschrieben ist, wohin sie gehen und wie ihre Routen sind. Diese Routen sind vorbei.“
Schreiben über Leid und Schmerz
Monika Rinck ergänzt: „Das ganze Bühnengeschehen, all das wird hinweggefegt, und dann heißt es nur noch am Ende: 'Ich bleibe dennoch. Es giebt immer Zuschaun', quasi als Zeuge.'"
Henning Ziebritzky sagt: „Dass die Elegien vor hundert Jahren erschienen sind - der Abstand als solcher spielt keine Rolle, aber der historische Kontext, in dem sie entstanden sind. Das bringt mich oft zum Nachdenken, weil Rilke ein durch und durch der Innerlichkeit zugewandter Lyriker ist. Wenn er von Schmerz spricht, von Leid und solchen Dingen, dann scheint das ja auf den ersten Blick abzusehen von dem wirklichen sozialen Leid, das es damals auch gab, von dem Leid in militärischen Auseinandersetzungen. Das gibt mir viel zu denken, zumal diese Texte ja nicht so wirken, als wären sie imprägniert gegen die wirkliche Welt."
Ich war fast alle Jahre des Krieges abwartend, immer denkend, es müsse ein Ende nehmen, nicht begreifend nicht begreifend! Nicht zu begreifen: ja, das war meine ganze Beschäftigung diese Jahre.
Rainer Maria Rilke in einem Brief
Versuch einer Deutung menschlichen Daseins
Für Rilke sind es darüber hinaus Jahre des Ringens um eine Deutung menschlichen Daseins mit den Mitteln der Dichtung. An eine Freundin schreibt er: „Wie ist es möglich zu leben, wenn doch die Elemente dieses Lebens uns völlig unfasslich sind? Wenn wir immerfort im Lieben unzulänglich und dem Tod gegenüber unfähig sind? Mein ganzes Staunen, dass die Menschen seit Jahrtausenden mit Leben umgehen und diesen Aufgaben so armsälig gegenüberstehen.“
Christian Lehnert meint dazu: „Die Aufgabe des Dichters ist aber, das in den Worten zu hören, was sie bedeuten können, worauf sie hinweisen, wohin sie sich aufmachen. Immer wieder kreist er darum, immer wieder um das Sterben. Der Tod ist eine Grenze, er ist die völlige Fremde, der Punkt, an dem das Offene sich eben in aller Radikalität zeigt. Es ist die völlige Negation unserer Deutungen der Welt.“
Das dichterische Schaffen versiegt
Am 9. Juni 1916 erhält Rilke dank der Fürsprache einflussreicher Freunde die Entlassungspapiere vom Militärdienst und kehrt im Juli nach München zurück. Sein dichterisches Schaffen aber versiegt in den folgenden Jahren fast ganz.
Erst Anfang Februar 1922 löst sich der Schreibknoten, und in nur wenigen Tagen vollendet Rilke die Elegien. Er schreibt: „Endlich der gesegnete, wie gesegnete Tag. Es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist (wie damals auf Duino) – an Essen war nie zu denken, Gott weiß, wer mich genährt hat.“
Klage und Jubel
Elegien hat Rilke die Sammlung seiner zehn Gedichte genannt: Klagen angesichts der Zerrissenheit menschlichen Daseins, Klagen angesichts von Tod und Vergänglichkeit. Dennoch will seine Elegiendichtung nicht nur die dunklen, tiefen Töne anschlagen, wie Christian Lehnert meint.
„Seine Elegien sind ja ganz gewaltige Flügelschläge an der Grenze der Existenz. Diese Bewegungsform geht in der Klage nicht auf. Die Klage der Elegie korrespondiert mit dem Jubel. In diesem Jubel schlägt die Sprache über sich selbst hinaus und gelangt in eine Fülle, die sie selbst nicht fassen kann, wie die Lerche hochsteigt und immer höher steigt und immer höher steigt. Eigentlich ist es eine Bewegung ins Unendliche, die zutiefst beglückend ist.“
Dass ich dereinst, an dem Ausgang der grimmigen Einsicht,
Jubel und Ruhm aufsinge zustimmenden Engeln.
Dass von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens
keiner versage an weichen, zweifelnden oder
reißenden Saiten.
aus Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“
Kerstin Preiwuß ergänzt: „Wenn man Klage denkt als Abwärtsbewegung, im Sinne einer Verlusterfahrung, die Gegenbewegung wäre der Aufstieg. Ein jähes, momenthaft aufblitzendes Wissen um das sonst nicht ineins zu Kriegende, um das, was zusammengehört. Und daraus erwächst dann womöglich das Bewusstsein, über eine Schwelle getreten zu sein, und das löst Jubel aus.“
Texte von unverbrauchter Frische
Begonnen hatte Rilke die Elegien auf Schloss Duino, beendet hat er sie zehn Jahre später im Château de Muzot, einem kleinen, mittelalterlichen Wohnturm im Schweizer Rhonetal, seiner letzten dichterischen Zufluchtsstätte. Von dort schreibt er im Dezember 1925 im Rückblick auf sein Elegienwerk an einen Freund: „Dass ein Mensch, der sich durch das heillose Zusetzen jener Jahre bis in seinen Grund zerspalten gefühlt hatte, erfährt, wie unter diesem aufgerissenen Spalt die Kontinuität seiner Arbeit und seines Gemüts sich wiederherstellte, scheint mir mehr als nur ein privates Ereignis zu sein; viele, die sich zerrissen glauben, dürften aus diesem Beispiel eine eigentümliche Tröstung ziehen.“
Christian Lehnert findet es beim Wiederlesen "verblüffend, dass die Duineser Elegien für mich eine geradezu unverbrauchte Frische haben. Rilke rückt mir da ganz unmittelbar nah. Da ist eine ganz unverbrauchte Kraft und ich glaube, sie ist mehr als der Zeitstrahl erfasst. Ich entdecke immer etwas Neues, immer ist wieder etwas enthalten, was ich früher nie gelesen habe. Man wächst mit den Texten.“
Mitwirkende: Cristin König und Christoph Gawenda
Regie: Stefanie Lazai
Ton: Hermann Leppich
Redaktion: Dorothea Westphal